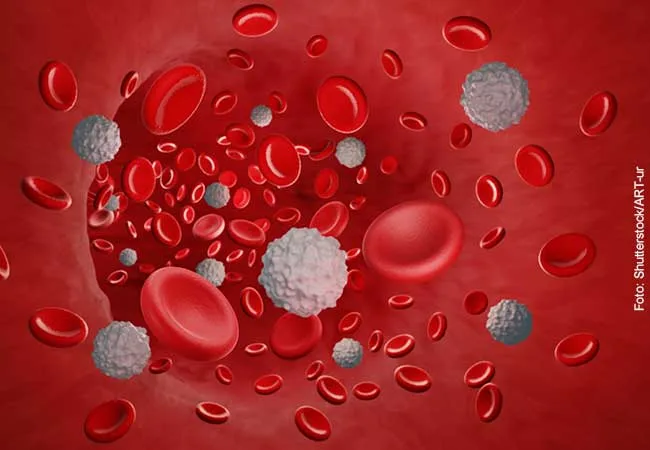Interview mit Prof. Volker Wieland, Stiftungsprofessor für monetäre Ökonomie und Geschäftsführender Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) der Goethe-Universität, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Herr Professor Wieland, in der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ist kein Ende in Sicht. Wie schätzen Sie den geldpolitischen Kurs der EZB ein?
Nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rats Anfang Juni ist zumindest eine leichte Wende in der Geldpolitik angedeutet. Der EZB-Rat spricht nun nicht mehr davon, dass es weitere Zinssenkungen geben könnte. Aber die massiven Anleihekäufe gehen weiter. Ein Ausstieg aus der quantitativen Lockerung wurde nicht in den Raum gestellt. Die EZB hätte schon längst eine Strategie und einen Zeitplan für das Auslaufen der massiven Wertpapierkäufe kommunizieren sollen. Sie befindet sich noch immer im geldpolitischen Krisenmodus, obwohl sich die Wirtschaft im Euroraum deutlich erholt hat und sich diese Erholung weiter festigt. Eine Straffung der Geldpolitik ist angesichts der makroökonomischen Entwicklung überfällig.
Wo sehen Sie die Gefahren dieser Geldpolitik?
Im Hintergrund bauen sich durch die sehr lockere Geldpolitik neue Risiken auf: Ein zu langes Festhalten an der Niedrigzinspolitik gefährdet die Finanzstabilität. Dies lässt sich insbesondere an den Zinsänderungsrisiken im Bankensektor festmachen. Wenn wirklich einmal die Zinswende kommt, können die Banken in Schwierigkeiten geraten. Riskant ist die Niedrigzinspolitik auch für einige Krisenländer. Sie haben die Möglichkeiten der Niedrigzinspolitik nicht genutzt, um die Konsolidierung ihrer Staatsfinanzen konsequent umzusetzen und Strukturreformen anzugehen. Einige Mitgliedstaaten hängen am Tropf der niedrigen Zinsen und Staatsanleihekäufe.
In den Vereinigten Staaten gibt es Bestrebungen, die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Federal Reserve an Regeln zu knüpfen. Die Fed müsste sich dann in ihrer Geldpolitik und in der Kommunikation auf diese Regeln beziehen. Wie beurteilen Sie das?
Das ist nichts grundsätzlich Neues. Bereits in der Vergangenheit gab es einmal die Pflicht, im Bericht an den Kongress zweimal jährlich die Entwicklung der Geldmenge relativ zu einer Zielzone zu diskutieren und etwaige Abweichungen zu erklären. Die Gesetzesvorlage in den USA, die bereits durch das Repräsentantenhaus abgesegnet wurde, würde von der Fed verlangen, eine nach ihrer Einschätzung effektive Zinsregel zu kommunizieren. Außerdem müsste sie dann Abweichungen von dieser Regel und von einer bekannten Regel aus der wissenschaftlichen Literatur erklären. Es geht also nicht um einen Zwang, sondern um eine Verbesserung der Kommunikation und der Rechenschaftspflicht. Darin liegen Chancen für die Notenbank. So würde die Unabhängigkeit der Notenbank gestärkt, etwa wenn ein Präsident versuchen sollte, Druck auf die Fed auszuüben, den Leitzins für längere Zeit niedrig zu halten, um die wirtschaftliche Aktivität weiter anzukurbeln. Die Notenbank kann sich dann auf die Regeln zur Geldpolitik berufen.
Zur deutschen Wirtschaft: Deutschland sieht sich immer wieder mit Kritik an dem hohen Leistungsbilanzüberschuss konfrontiert, zuletzt vor allem aus den Vereinigten Staaten. Ist diese Kritik gerechtfertigt?
Produkte aus Deutschland wie Autos oder Maschinen sind im Ausland gefragt, das ist zunächst einmal erfreulich und keinesfalls verwerflich. Der Leistungsbilanzüberschuss ist kein zwingendes Anzeichen für ein makroökonomisches Ungleichgewicht. Um zu beurteilen, ob die Wirtschaft im Gleichgewicht ist, sollte man sich vielmehr die Auslastung der Wirtschaft und die Nachhaltigkeit der Wachstumsrate anschauen. Dazu vergleicht man das Bruttoinlandsprodukt mit dem langfristigen Potenzial. Hier zeigt sich, dass die Wirtschaft wohl primär aufgrund der sehr lockeren Geldpolitik über Potenzial wächst. Der Wechselkurs ist für Deutschland zu niedrig. Dies trägt zum Leistungsbilanzüberschuss bei. Insofern passt die Geldpolitik nicht auf Deutschland. Was die Kritik aus den USA betrifft, sollte man nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Die Vereinigten Staaten verzeichnen bereits seit Anfang der 1980er Jahre ein Leistungsbilanzdefizit. Das heißt, sie importieren Kapital. Das ist unter anderem möglich, weil die Vereinigten Staaten die Weltwährung US-Dollar bereitstellen und viele Staaten und Anleger Liquiditätsreserven in US-Dollar halten. Statt dies anzuerkennen beschweren sich amerikanische Präsidenten immer wieder in wechselnder Intensität über den Exportüberschuss ihrer Handelspartner. In den 1980er und 1990er Jahren war Japan das Ziel der Vorwürfe, nach der Jahrtausendwende war es China. Deutschland ist Teil der Eurozone, deshalb macht es keinen Sinn, den Überschuss gegenüber den USA isoliert von den anderen Mitgliedern der Eurozone zu betrachten. Die Eurozone insgesamt hat übrigens erst seit der Finanzkrise einen Leistungsbilanzüberschuss, seit nämlich die Leistungsbilanzdefizite der von der Krise stark betroffenen Volkswirtschaften wie etwa Spanien und Italien zurückgegangen sind.
Eines Ihrer aktuellen Forschungsprojekte ist der Aufbau einer öffentlichen Plattform für makroökonomische Vergleichsmodelle. Was ist das Besondere an diesem Projekt?
In die offene Datenbank für Modelle, die sogenannte Macroeconomic Model Data Base, können Forscher die Formeln und Codes der von ihnen entwickelten Modelle einspeisen. Andere Ökonomen können sie dann nachvollziehen, anwenden und auch verbessern. Aus den Modellen lassen sich wiederum Handlungsempfehlungen für die Geld- oder Fiskalpolitik und regulatorische Maßnahmen ableiten. Auf der Website www.macromodelbase.com ist die Datenbank für jeden erreichbar. Mehr als 7500 Ökonomen weltweit nutzen die Plattform, die derzeit 93 Modelle beinhaltet. Die Macroeconomic Model Data Base ist zudem Teil eines neuen Projekts zur Vergleichbarkeit makroökonomischer Modelle gemeinsam mit dem Hoover-Institut. Diese Initiative, die Macroeconomic Model Comparison Initiative (MMCI), wird von der New Yorker Sloan-Stiftung gefördert. In diesem Zusammenhang haben wir ein Netzwerk geschaffen, innerhalb dessen Forscher einmal jährlich zusammenkommen, um ihre Ergebnisse zu präsentieren und diskutieren.
Die Fragen stellte Natascha Lenz