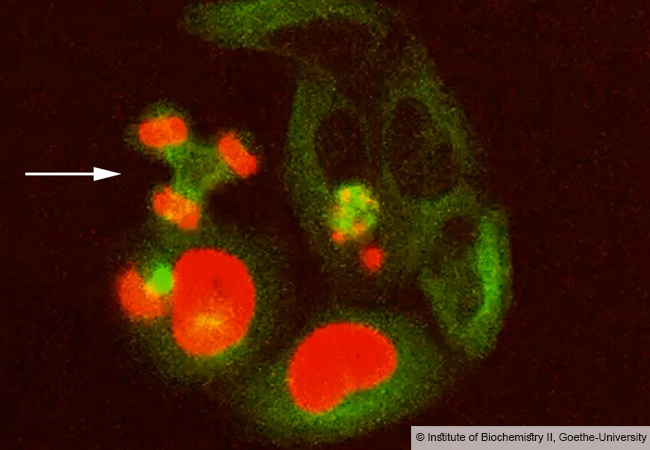Wir erleben eine enorme Beschleunigung, besonders im Berufsleben. Unser Alltag ist überfrachtet von Dringlichem und Deadlines. Und dann mit über 60 folgt der Ausstieg aus dem ausgefüllten, für manche erfüllten Berufsleben: Welche Risiken birgt dieser Übergang? Dazu der Sozialpsychologe Prof. Rolf Haubl (65) im Gespräch mit Ulrike Jaspers (60).
Jaspers: Was passiert, wenn wir uns aus der Taktung, die das Berufsleben vorgibt, verabschieden?
Haubl: Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Was ich selbst erlebe und was ich in unseren Forschungen beispielsweise zur Nachfolge in Familienunternehmen oder zum Ausstieg von älteren Führungskräften, die sich selbstständig machen, gesehen habe: Selbst diejenigen, die prognostizieren, der Übergang wird problemlos sein, müssen sich doch mit dieser Zäsur auseinandersetzen. Vor allem für Menschen, die sich mit ihrer Arbeit identifizieren, ist das ein spürbarer Einschnitt. Übrigens ist diese Identifikation bei Männern vor allem in höheren Positionen deutlich stärker als bei Frauen, das lässt sich statistisch nachweisen. Da Männer im Laufe ihres Berufslebens oft nur Bekannte oder Freunde aus ihrem Arbeitsumfeld haben, tragen sie ein besonders hohes Risiko, in dieser Übergangsphase einsam zu werden.
Jaspers: Gibt es die Konstellation »Mann im Top-Management, Frau hält ihm zu Hause den Rücken frei«, denn noch?
Haubl: Ja, das ändert sich langsamer, als wir denken. Es gilt noch der Befund, je höher die berufliche Position, desto traditioneller sind die Beziehungen. Wenn diese Männer dann aus dem Beruf ausscheiden, führt das nicht selten zu Konflikten in der Ehe – das haben unsere Forschungen aus dem vergangenen Jahr gezeigt.
Jaspers: Na, lassen Sie uns diese Frage nochmal in zehn Jahren diskutieren, hoffentlich mit anderem Ergebnis! Was kann man tun, um zu Beginn der Rente nicht in ein Loch zu fallen?
Haubl: Menschen, die aus dem Berufsleben ausscheiden, sollten noch einen anderen Lebensentwurf haben, der nicht nur von Arbeit geprägt ist. Solche Lebensentwürfe greifen oft liegengelassene Träume wieder auf.
Jaspers: Und das funktioniert?
Haubl: Zum Teil. Es ist allerdings nicht einfach, an frühere Träume anzuknüpfen, die man vor Jahrzehnten abgelegt hat. Das klappt nur, wenn ich nicht unterschlage, dass ich den Wunsch zu einem Zeitpunkt formuliert habe, als ich noch ein anderer war. Bewusst oder unbewusst spielt noch etwas anderes eine große Rolle bei dem Übergang von der Arbeitswelt in die Rente – das biografische Bilanzieren: Was ist aus mir geworden? Was kann aus mir noch werden? Bilanz zu ziehen und sich neu auszurichten, ist nicht unproblematisch, gehört aber unbedingt zusammen. Denn es führt dazu, dass man sich auch mit Belastendem auseinandersetzt. Um das zu vermeiden, versuchen viele Menschen in der Rente die Strukturen beizubehalten, in denen sie sich zu Hause fühlen. Nach dem Muster: Das Leid, das ich kenne, ist immer noch erträglicher als das Risiko einer offenen Zukunft.
Jaspers: Und wenn man den Mut hat, die Zukunft gestalten zu wollen, wie geht man mit diesem Risiko um?
Haubl: Wichtig ist es, dass man in einem Umfeld lebt, das darin bestärkt, neue Ideen zuzulassen. Der Übergang muss gestaltet werden, das geschieht nicht von allein, auch Risiken sind einzukalkulieren. Man sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen, das eigene Leben Revue passieren zu lassen und wirklich hinzuschauen: Was habe ich gemacht? Was war daran gut, was schlecht? Was kann ich mir realistisch für die nächste Zeit vornehmen?
 Jaspers: »Abdankung« bedeutet – so Dudens Deutsches Universalwörterbuch – freiwilliger Verzicht auf ein hohes Staatsamt, den Thron – (in der Schweiz übrigens »Trauerfeier«). Das ist ein selbstbestimmter Akt, solange es gut läuft und der äußere Druck nicht zum Abdanken zwingt. Der Durchschnittsbürger dankt normalerweise nicht ab, er wird in Rente geschickt. Was bedeutet das für die Betroffenen? Gibt es doch etwas Verbindendes zwischen den beiden Ausstiegsszenarien?
Jaspers: »Abdankung« bedeutet – so Dudens Deutsches Universalwörterbuch – freiwilliger Verzicht auf ein hohes Staatsamt, den Thron – (in der Schweiz übrigens »Trauerfeier«). Das ist ein selbstbestimmter Akt, solange es gut läuft und der äußere Druck nicht zum Abdanken zwingt. Der Durchschnittsbürger dankt normalerweise nicht ab, er wird in Rente geschickt. Was bedeutet das für die Betroffenen? Gibt es doch etwas Verbindendes zwischen den beiden Ausstiegsszenarien?
Haubl: »Die Kunst des Abdankens« haben wir vor zwei Jahren eine Tagung genannt, weil in dem Wort »Abdanken« der »Dank« enthalten ist. Da das Abschiednehmen für Menschen – egal aus welcher Position – ein Problem ist, wird es häufig ritualisiert. In der Regel wissen die Beteiligten, dass eine Abschiedsfeier ein Ritual ist und damit wird es nur halb ernst genommen. Aber alle haben auch ein mulmiges Gefühl und Angst davor, dass falsche Töne angeschlagen werden und das Ritual platzt. Der Wunsch desjenigen, der geht, ist klar: Er will gelobt werden. Gleichzeitig weiß er aber, wenn das über den grünen Klee geschieht, dann stimmt etwas nicht. Eine solche Abschiedsfeier ist eine aufregende Situation, weil zum Bilanzieren des eigenen Lebens auch gehört, ob ich etwas hinterlasse, was dankenswert ist, ob Konflikte in irgendeiner Weise bereinigt sind oder ob ich damit rechnen muss, dass meine Gegner dieses Ritual nutzen, um mir nochmal die Meinung zu sagen und mir den Abschied zu vermiesen.
Jaspers: Mit dem Abschied ist auch oft die Frage verbunden: Wie gehe ich mit dem Nachfolger, der Nachfolgerin um?
Haubl: Diese Situation spielt im Coaching zunehmend eine Rolle. Die häufigste Empfehlung ist: Wenn du gehst, dann lass alles hinter dir, die anderen sollen das machen, wie sie wollen. Aber so einfach und unbelastet läuft das meist nicht. Stellen sich doch besonders bei Menschen, die sich mit ihrer Arbeit stark identifiziert haben, solche Fragen ein: Wird derjenige oder diejenige, die mir nachfolgt, das fortführen, was mir wichtig war, oder wird alles Bisherige fallen gelassen? Wird mein Lebensentwurf negiert werden?
Jaspers: Wie haben Sie diesen Wechsel erlebt, als Sie 2014 als Professor für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität und 2016 als Direktor des Sigmund-Freud-Instituts ausgestiegen sind?
Haubl: Zum Glück kann ich sagen, dass mir mit Vera King, die für dieses Heft einen Beitrag über »Die Macht der Dringlichkeit« geschrieben hat, eine Kollegin nachgefolgt ist, mit der ich voll einverstanden bin und mit der es eine Möglichkeit gibt, vieles von dem, wofür ich stehe, auch weiterzutragen. Aber ich habe an mir selbst gemerkt, dass das innere Begleiten dieser Berufung schon mit der Frage verbunden war: Was mache ich denn, wenn jemand kommt, der sagt, alles was der Vorgänger gemacht hat, ist eigentlich Quatsch? Mit einem Wechsel wird die Erwartung verbunden, dass die Neuen hoch innovativ sind. Das lässt sich sehr gut in Unternehmen beobachten, wenn es um Nachfolgeregelungen geht: Der Neue profiliert sich schnell dadurch, dass er das, was der Alte gemacht hat, schlechtredet und zur Seite schiebt. Wir haben Einblicke in Firmen nehmen können, wo nichts konsolidiert worden ist, sondern, wo die High Potentials – wie sie heute heißen – verpflichtet worden sind, innovativ zu sein. Das führt dazu, dass es gar keine Traditionen mehr gibt.
Jaspers: Was macht dieser Traditionsbruch mit denjenigen, die abtreten und noch mit warmen Worten der »Wertschätzung « verabschiedet werden?
Haubl: Ihre Skepsis gegenüber dem Wort »Wertschätzung« teile ich, weil es so inflationär gebraucht wird. Die Art und Weise, wie die anderen mit meiner Tradition umgehen, signalisiert mir meinen Wert – mehr als warme Worte. Und wenn ich plötzlich erlebe, dass das für unwert erklärt wird, was ich vielleicht 30 Jahre lang gemacht habe, ist das eine sehr belastende, schwer zu ertragende Situation. Ein Indiz dafür ist, dass die Selbstmordrate beim Übergang in die Rente signifikant steigt.
Jaspers: Altersgrenzen sind nicht für alle bindend – man denke nur an Familienunternehmer oder Politiker. So sagte der 87-jährige Konrad Adenauer, als er seinen Abschied aus dem Amt des Bundeskanzlers verkündete: »Ich gehe nicht leichten Herzens.«
Haubl: Zu Adenauer fällt mir diese schöne Anekdote ein: Der 90-jährige Adenauer hat sein Enkelkind auf dem Schoß und fragt: »Was willst du denn mal werden?« – Der Enkel antwortet: »Bundeskanzler«. Darauf Adenauer: »Aber das bin ich schon.« Diese Anekdote spielt natürlich auf Unsterblichkeitsfantasien an. Dazu haben wir interessante Befunde in unserer Studie über die Nachfolge in Familienunternehmen – die unterscheiden sich oft von den nicht von Familien geführten Unternehmen, wo ja Traditionsbrüche an der Tagesordnung sind. Bei den Familienunternehmen geht der Alte oft nicht, und die Jungen harren aus in der Erwartung, dass sie einmal die Firma übernehmen – und das dauert und dauert. In dem Moment, wo der Alte endlich abdankt, ist es im Grunde genommen schon alles zu spät, weil die anstehenden Innovationen nicht gemacht werden konnten, weil der Sohn Angst hatte, das anzurühren, was für den Vater identitätsstiftend war. Und aus der Perspektive des Alten geht die Vorstellung des Abdankens einher mit dem Gedanken »der Tod naht«. Die Idee weiterzumachen, scheint auch die Versicherung seines Lebens zu sein. Eines müssen wir festhalten, es ist eine hoch vulnerable Situation, in die wir geraten, wenn wir abdanken oder in Rente gehen. Es gibt auch den Typus, der geht, ohne sich umzudrehen und ward nie mehr gesehen. Auch das ist letztlich eine Form von Entwertung dessen, was zurückgelassen wird.
Jaspers: Schwingt in diesen Situationen nicht auch die Angst der Endlichkeit mit?
Haubl: Klar, unser aller Sehnsucht ist, nie sterben zu müssen. Aber es ist ein unkalkulierbares Risiko, sich einfach in das Leben nach der Berufstätigkeit hineintreiben zu lassen. Es erleichtert den Ausstieg, wenn man schon eine Vorstellung für das weitere Leben entwickelt. Da gibt es den Typus, der ins Ehrenamt geht und seine Kompetenzen anderen zur Verfügung stellt, aber es gibt auch denjenigen, der plötzlich anfängt, zu malen oder Sport zu machen.
Jaspers: Weitermachen im Ehrenamt bedeutet auch: Der Terminplan ist zum Glück weiter angefüllt. Dahinter lässt sich mehr vermuten als nur ein altruistisches Motiv.
Haubl: Der Altruismus hat immer auch seine Gegenseite: Oft übernehme ich eine Aufgabe nicht aus freien Stücken, sondern weil andere es von mir erwarten. Beim biografischen Bilanzieren ist es wichtig, sich klarzumachen: Was habe ich eigentlich in meinem Leben gemacht? Was war eher Zwang? Das würde ich ablegen! Was war eher freiwilliges Engagement? Das würde ich fortführen! Bei Topmanagern finden wir sehr häufig folgendes Motiv für ihr ehrenamtliches Engagement: Sie wollen etwas zurückgeben. Als Führungskraft war der Manager oft gezwungen, Entscheidungen zu fällen, die er als Rollenträger, aber nicht als Person getroffen hat. Das hinterlässt ein Gefühl der Schuld und den Wunsch, etwas wiedergutmachen zu wollen.
 Jaspers: Auf Gewohntes zu verzichten, fällt schwer. Auch mit dieser Erfahrung müssen Menschen umgehen, die aus dem Berufsleben ausscheiden.
Jaspers: Auf Gewohntes zu verzichten, fällt schwer. Auch mit dieser Erfahrung müssen Menschen umgehen, die aus dem Berufsleben ausscheiden.
Haubl: Besonders schwer fällt es dem Narzissten. Er hat die Vorstellung, dass er die Welt ist, verzichten müssen immer nur die anderen, er selbst natürlich nicht, weil er die vollständig entwickelte Persönlichkeit ist. Aber grundsätzlich ist zu bedenken, wer verzichtet, hat die Chance, auch seine Kräfte zu bilanzieren. Verzicht ist eben nicht nur etwas, was ich verliere, sondern im Verzicht gewinne ich auch neue Freiheiten, weil ich mein Herz nicht mehr an bestimmte Dinge hängen muss. Ich kann akzeptieren, dass ich weniger Ressourcen habe als früher, und ich bin damit von vielem entlastet. Insofern ist Verzicht – wenn man von einer Ethik des Verzichtes reden will – vor allem für diejenigen, die es nicht müssen, sondern es freiwillig tun, eine neue Freiheit: Ich muss nicht mehr jede neue Mode mitmachen, ich muss nicht mehr jede neue Theorie kennen, ich muss nicht auf den zentralen Urlaubsorten dieser Welt herumturnen; sondern ich kann etwas tun, was andere womöglich auch irritiert, und ich tue auch etwas gegen die Erwartungshaltung anderer, weil ich mit dem Verzicht ein Stück näher an dem dran bin, was mein Eigenes ist.
Jaspers: Wie sind Sie mit dieser Option des Verzichts umgegangen?
Haubl: Ich bin an der Uni zweieinhalb Jahre früher in vorzeitigen Ruhestand gegangen, als Direktor des Freud-Instituts etwas später. Und das hat viel damit zu tun, dass ich in den letzten Jahren viel zum Thema Arbeit und psychische Gesundheit geforscht habe, was landläufig »Burn-out« heißt. Da tauchte auch für mich die Frage auf: Was bedeutet mir eigentlich Selbstfürsorge? Als psychoanalytisch Orientierter habe ich mir die Zeit genommen, darüber nachzudenken, und kam zu dem Ergebnis: Meine Kräfte sind so ausbalanciert, dass ich jetzt noch was machen kann, und ich bin nicht drauf angewiesen, die letzten Euro zusammenzukratzen, da sind mir die Freiheiten von zweieinhalb Jahren lieber. Ich habe es nicht bereut, obwohl die innere Auseinandersetzung mit diesen Fragen ein Dauerthema ist, auch wenn man im Ruhestand ist.
Jaspers: Die Psychoanalyse spricht vom drohenden Objektverlust, von der Verunsicherung des Ichs, wenn es um Trennung von Bindung geht. In dieser Übergangsphase werden Bindungen gekappt, andere gewinnen wieder an Bedeutung.
Haubl: Ja, die Abstimmung mit den engsten Bezugspersonen wird wichtiger, denn es geht niemand allein in Rente – das betrifft die Familie in vielen Situationen und weckt Erwartungen, mit denen ich mich arrangieren muss. Dagegen steht häufig der eigene Anspruch, jetzt nutze ich aber endlich mal meine Freiräume. Wenn die Beteiligten nicht erkennen, dass es sich hier um ein soziales Phänomen handelt, führt das häufig dazu, dass sie sich aus dem Weg gehen. Eine paradoxe Situation: Da könnten beispielsweise Paare endlich mehr zusammen machen, haben aber kaum mehr etwas miteinander zu tun.
Jaspers: Und dann folgt nicht selten die Scheidung jenseits der 60!
Haubl: Nicht nur Scheidung! Männer suchen oft nochmal erotische Abenteuer – übrigens nicht ohne schlechtes Gewissen, dass sie damit ihrer Familie etwas antun, und auch verbunden mit dem Willen, sich gegen die Ansprüche der Familie zur Wehr setzen zu wollen. Auf die Gruppe der Topmanager bezogen bedeutet das: Der erlebte Wirksamkeitsverlust wird ein Stück weit durch erotische Abenteuer abgefangen. Häufig mit der Idee: Ich habe es verdient! Solche sexuellen Eskapaden haben wir in unserer Studie zu Familienunternehmen häufiger gefunden. Der Gründer geht erst aus dem Unternehmen, nachdem er sich eine junge Geliebte genommen hat, und manchmal hat er mit dieser Frau dann das Erbe seiner Kinder durchgebracht.
Jaspers: In »Statuspassagen« wird das Leben durcheinandergerüttelt, etwas Neues passiert – ob im Privaten oder Beruflichen. Das passiert in aktuellen Erwerbsbiografien häufiger als früher: befristete Arbeitsverträge, Unterbrechungen durch Elternzeit, häufige Jobwechsel, Veränderungen des Wohnorts. Können Sie sich vorstellen, dass sich diese Menschen leichter tun, wenn sie aus dem Beruf ausscheiden?
Haubl: Beschleunigung und Wechsel konfrontieren die Berufstätigen mit vielen Trennungen von Menschen oder Orten, das ist ganz anders als in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Insofern könnte man – allerdings etwas zynisch – sagen: Sie sind Trennungen gewöhnt und deswegen dürfte es ihnen nicht mehr so viel ausmachen. Aus psychoanalytischer Perspektive ist das aber nicht zu erwarten. Denn diese häufigen Trennungen sind eine Überforderung, sie gehen einher mit einer Sehnsucht nach Bindungen, die aber gar nicht mehr gelebt werden kann, weil die ganze Gesellschaft auf schnelle Taktung aus ist.
Jaspers: Die Menschen werden also nicht cooler, sondern eher verletzlicher! Gute Argumente für einen flexiblen Ausstieg aus dem Berufsleben sind nicht zu überhören, meist aber aus finanziellen Gründen nicht zu realisieren. Sind Sie dafür, dass die individuellen Aspekte stärker berücksichtigt werden?
Haubl: Der selbstgewählte Zeitpunkt erhöht die Chancen, mit dem Ausstieg besser klarzukommen. Dann mache ich mir nämlich selbst Gedanken, wann für mich der richtige Zeitpunkt ist. Wobei derjenige, der dies selbst bestimmt, in unserer auf Arbeiten fixierten Gesellschaft »verdächtig « erscheint. Und sei es der Neideffekt, dass sich jemand so etwas leistet.
Jaspers: Professoren sind ja eine ganz besondere Spezies, wenn es um die Kunst des Abdankens geht. Früher gingen die Emeriti bei vollem Gehalt und behielten ihre Ausstattung im Institut bis an ihr Lebensende. Heute ist es eher so, dass pensionierte Professoren oft ohne Ressourcen weiterforschen oder eine vergütete Seniorprofessur annehmen. Ist es für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen besonders schwierig auszusteigen?
Haubl: Da gibt es natürlich solche und solche. Also was mir wichtig ist, weil ich das auch an mir erlebe, ist das »Werkbewusstsein « – also wenn jemand unabhängig von äußerlichen Zwängen weiter an seinem Thema arbeitet, ein Werk vollenden möchte, weil es ihn leidenschaftlich bewegt. Das geht durchaus einher mit einer privilegierten Position und ist eher bei Menschen zu finden, die keinen Job machen, sondern einer Berufung folgen.
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“false“ style=“1″ animation=“fadeIn“]
 Zur Person
Zur Person
Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl, Jahrgang 1951, war von 2002 bis 2015 Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Goethe-Universität und bis 2016 Direktor des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt. Er ist Supervisor und Organisationsberater bei der Deutschen Gesellschaft für Gruppenanalyse und Gruppenpsychotherapie (D3G) und bei der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv).
Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte waren Arbeitswelt und Psyche (z. B . Arbeit und Leben in Organisationen, riskante Arbeitswelten, Erwerbsarbeit und psychische Erkrankungen, eine Studie gemeinsam mit dem Institut für Sozialforschung), Krankheit und Gesellschaft (Depression und Arbeitswelt, Psyche in der Leistungsgesellschaft), sozialwissenschaftliche Emotionsforschung (u. a. zu Neid und Hass) sowie ökonomisches Alltagshandeln und seine Psychopathologien (z. B . Kaufsucht und Überschuldung, Paarbeziehungen und Geld). haubl@soz.uni-frankfurt.de
[/dt_call_to_action]
Dieser Artikel ist in Forschung Frankfurt (Ausgabe 1.2017) erschienen.