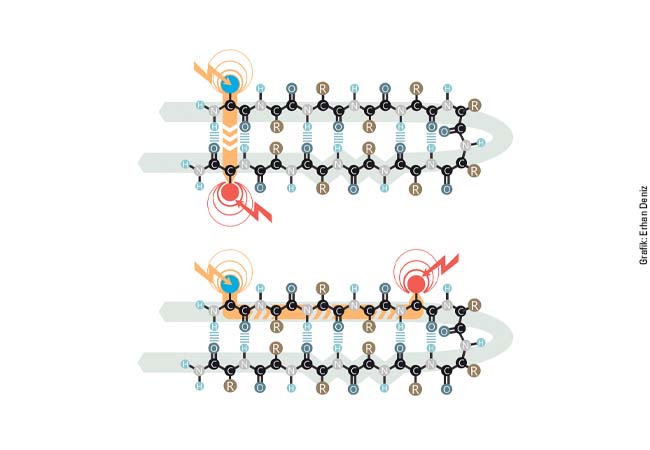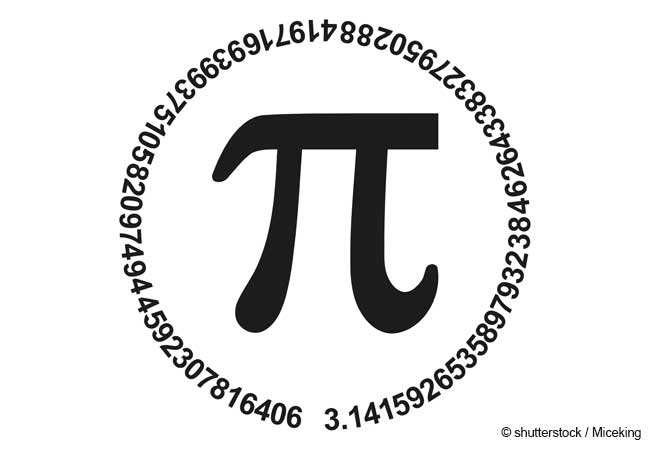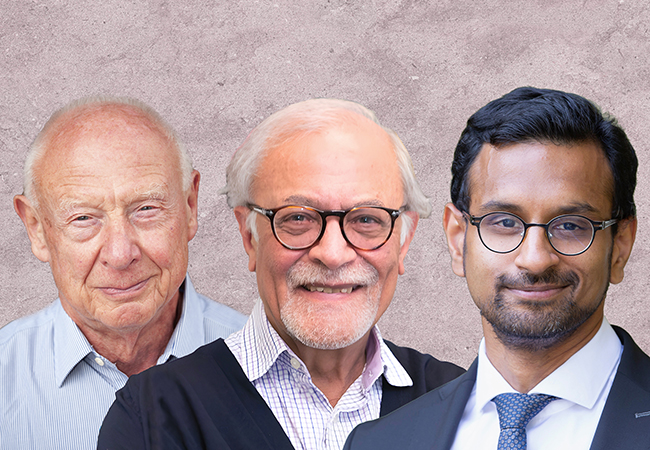Das Thema Drogen vermag wie kaum ein anderes die Öffentlichkeit zu beschäftigen. Aktuelle Berichte einer regelrechten »Drogenepidemie« in den USA dürften viele Beobachter auch in Europa beunruhigt haben, denn neben einer hohen Zahl an Suchtkranken fällt vor allem die extrem hohe Zahl an Drogentoten in manchen Landstrichen der USA auf: Im Jahr 2016 starben 64.000 Amerikaner an den Folgen einer Opioid-Sucht. Was hat es auf sich mit der so genannten »Opioid-Krise«, welche Implikationen hat sie für die Drogenpolitik auch in Deutschland?
Das Thema Drogen vermag wie kaum ein anderes die Öffentlichkeit zu beschäftigen. Aktuelle Berichte einer regelrechten »Drogenepidemie« in den USA dürften viele Beobachter auch in Europa beunruhigt haben, denn neben einer hohen Zahl an Suchtkranken fällt vor allem die extrem hohe Zahl an Drogentoten in manchen Landstrichen der USA auf: Im Jahr 2016 starben 64.000 Amerikaner an den Folgen einer Opioid-Sucht. Was hat es auf sich mit der so genannten »Opioid-Krise«, welche Implikationen hat sie für die Drogenpolitik auch in Deutschland?
Dr. Bernd Werse vom Centre for Drug Research (CDR) an der Goethe-Universität erläutert den Hintergrund: „Seit den 90er Jahren wurden in den USA medizinische Opioide als Schmerzmittel für alle möglichen Gelegenheiten massiv beworben. Pharmakonzerne ergriffen recht aggressive Werbemaßnahmen und wirkten stark auf Ärzte ein. Viele Patienten aus der Mittelschicht wurden opioidabhängig.
Dann wurde die Verschreibungspraxis geändert, sodass die Patienten nicht mehr so leicht an die Medikamente kommen.“ Das hatte fatale Folgen: Nun griffen viele Abhängige auf illegale Opioide wie Heroin oder Fentanyl zurück. Neben dem hohen Abhängigkeitspotenzial liegt die Gefahr in der schmalen Spanne zwischen einer erlaubten und einer tödlichen Dosierung von Opioiden.
„Der Fall zeigt deutlich, was in der Drogenpolitik auch schiefgehen kann, wenn psychoaktive Substanzen einer derartigen Vermarktung und Verfügbarkeit unterliegen“, so Werse. Er betont aber, dass die Opioid-Krise in keinem Zusammenhang mit der Legalisierung und der industriellen Herstellung von Cannabis in einigen US-Bundesstaaten stehe.
Allerdings sieht er durchaus ein Problem darin, wenn Cannabis beliebten Produkten wie Schokoriegeln zugesetzt werde: „Das kann bei unerfahrenen Konsumenten zu sehr unangenehmen Rauschzuständen führen“, so Werse. Eine Situation wie in den USA wäre, was die Verbreitung und den Konsum von Opioiden angeht, in Deutschland unvorstellbar:
„Das Betäubungsmittelgesetz setzt da klare Grenzen.“ Werse plädiert bei psychoaktiven Substanzen für eine Verfügbarkeit im „mittleren Bereich“: Extreme Verbote seien wenig zielführend, eine schrankenlose Verbreitung und Vermarktung wie bei den Opioiden in den USA sei aber auch nicht wünschenswert. „Bei jeder Droge sollte das jeweilige Gefahrenpotenzial bedacht werden.“
Situation in Frankfurt
Weit weniger dramatisch erscheint demgegenüber der Drogenkonsum in Frankfurt, wenngleich durchaus in großstadtspezifischen Szenen härtere Drogen eine hohe Akzeptanz genießen. „Das vor Jahren durch Medienberichte und auch durch Fernsehserien bekannt gewordene Crystal Meth ist hier aber nach wie vor fast bedeutungslos“, erklärt Werse.
Das Centre for Drug Research (CDR) untersucht, gefördert von der Stadt, seit 2002 im Monitoring-System Drogentrends (MoSyD) Entwicklungen im Bereich des Konsums psychoaktiver Substanzen und neue Konsumtrends in Frankfurt. Im Fokus stehen dabei zum einen die Drogenszene im Bahnhofsviertel, zum anderen die Szenen in Clubs und Bars.
Seit ca. 20 Jahren spiele in der ‚harten‘ Drogenszene Frankfurts vor allem Crack eine große Rolle, so Werse; dabei handelt es sich um eine chemische Abwandlung von Kokain, die meist in kleinen Pfeifen geraucht wird. Die Wirkung, so der Drogenforscher, setze unmittelbar ein, flache dann schnell wieder ab und führe oft zu neuerlichen Konsumphasen.
Während Heroin zu einer körperlichen Abhängigkeit führe, erzeuge Crack eher eine psychische Abhängigkeit. In der so genannten Partyszene hingegen spiele in den letzten Jahren Ecstasy wieder eine größere Rolle; daneben seien Speed, Cannabis und natürlich auch Alkohol die dominanten Drogen in diesem Bereich. Auch den Shisha-Konsum, der sich häufig in speziellen Bars abspielt, haben Werse und sein Team im Blick.
„Es handelt sich zumindest quantitativ betrachtet um den größten Drogentrend der letzten 15 Jahre“, so Werse; heute gäben mehr Jugendliche an, schon einmal eine solche Wasserpfeife ausprobiert zu haben, als eine Zigarette. Allerdings werden Shishas nicht so regelmäßig wie andere Tabakwaren konsumiert. Gewarnt wurde aber zuweilen vor einem erhöhten Ausstoß von Kohlenmonoxid in den Shisha-Bars, der durch Verbrennungsprozesse entstehen könne.
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]
Mehr zum Centre for Drug Research und zu verschiedenen downloadbaren Studien unter www.uni-frankfurt.de/57482210/WEV_AG_CDR
[/dt_call_to_action]
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 6.17 (PDF-Download) des UniReport erschienen.