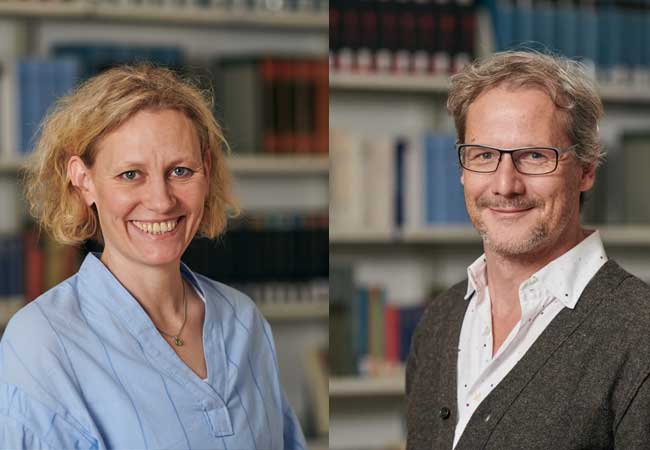Thomas Emmrich und Achim Geisenhanslüke über literarische Verarbeitungen von Seuchen und anderen Infektionsereignissen
Seuchen sind treue Begleiter der Menschheitsgeschichte. Dass sie gleichfalls die Literaturgeschichte prägen, zeigt die europäische Überlieferungsgeschichte bereits in ihren Anfängen: Homers Ilias beginnt mit einer Pest, die Apoll den Griechen zur Strafe sandte, da sie seinen Priester Chryses beleidigt haben: „Denn dieser zürnte dem König, / Sandte verderbliche Seuche durch das Heer, und es sanken die Völker“ (Ilias, 1, 10f.), heißt es dort. Der Lichtgott Apoll zeigt sich von seiner dunklen Seite: Als Pestbringer droht er, das griechische Heer zu vernichten, und nur eine Sühnegabe kann ihn mühsam genug beschwichtigen. Die Seuche ist eingebunden in das komplexe Geflecht einer Tauschökonomie zwischen Göttern und Menschen, aus der heraus dann der Streit zwischen Achill und Agamemnon erwächst, von dem das Epos erzählt.
Heute schießt kein Gott mehr Pfeile in feindliche Lager, dennoch sinken auch jetzt die Völker, und das über den ganzen Globus verbreitet. Die Welt scheint größer und kleiner zugleich geworden zu sein. Die globale Verbreitung von COVID-19 verdeutlicht jedenfalls, dass kollektive Infektionsereignisse keineswegs einer dunklen oder archaischen Vergangenheit der Menschheit angehören, sondern auch eine Bedrohung für deren Gegenwart darstellen. Was scheinbar verschwunden ist, das ist die Ökonomie des Tausches zwischen Menschen und Göttern, innerhalb derer sich die Krise bewältigen ließ. Was geblieben ist, sind archaische Muster der Deutung, die dem Ungeheuerlichen Sinn zu verleihen versuchen. Verschwörungstheorien unterschiedlicher Schattierungen glauben heute noch daran, dass die Seuche von einem Gott oder einem Tier, jedenfalls voll böser Hintergedanken, zu den Menschen gebracht wurde, um sie Demut zu lehren und zu unterwerfen. Zu einer großen Erzählung wie der Ilias fehlt bisher allerdings der Stoff.
Literatur als Arznei gegen die Pest
Dabei kennt nicht nur die Antike große Erzählungen, die um die Seuche kreisen. Fast immer ist es die Pest, die dazu angeregt hat, von ihr zu berichten oder berichtend von ihr abzulenken. Im Jahre 1348 ziehen sich je sieben junge Frauen und Männer, aus der Großstadt kommend, auf ein Landgut zurück und erzählen sich zehn Tage lang insgesamt hundert heitere und sinnenfrohe Geschichten. Was zunächst wie ein vergnügter Ausflug oder Ausbruch aus dem Alltag anmuten mag, ist in Wirklichkeit eine Flucht, eine Suche nach Schutz. Die Kulisse für den Rückzug der jungen Leute in die ländliche Idylle bildet in Giovanni Boccaccios Decamerone eine Pestepidemie in Florenz. Das Wüten des Schwarzen Todes wird dabei auf der thematischen Ebene des Textes weitestgehend ausgeklammert, und gerade darin besteht der Witz der von Boccaccio kunstvoll miteinander verflochtenen Novellen. Im Zentrum seiner monumentalen Erzählung steht das Erzählen selbst, das von ihm als eine Abwehr- und Immunisierungsstrategie gegen den Tod inszeniert wird: Literatur ist eben nicht nur ein Zeitvertreib, sondern auch eine geistige Arznei, die es den jungen Leuten erlaubt, sich von der Pest zu erholen, eine Gabe, deren Schutzfunktion sich auf das Leben und Überleben in Zeiten der Krise bezieht.
So ist es auch keine Überraschung, dass in Deutschland, Frankreich und Italien die Verkaufszahlen von Albert Camus’ La Peste, einem weiteren kanonischen Zeugnis der Seuchenliteratur, in den vergangenen Monaten merklich gestiegen sind, das Buch zeitweise sogar vergriffen war, wie man es sonst nur von aktuellen Bestsellern kennt. Die Geschichte des Dr. Bernard Rieux, der einsam gegen die Pest kämpft, deren Ausbruch an der algerischen Küste von vielen zunächst geleugnet wird, scheint von seltener Aktualität zu sein. Und auch hier steht der Streit um die Deutung des ungeheuerlichen Geschehens ganz im Zeichen des Streits von Menschen und Göttern: Rieux’ Antipode ist der Pater Panelou, der in der Seuche die gerechte Strafe Gottes für die Sünden der Menschen erblickt, während der Atheist Rieux die Sisyphosarbeit des Kampfes gegen die Krankheit auf sich nimmt, ohne ihr eine Bedeutung jenseits der Absurdität der menschlichen Existenz zuzumessen. Den neuerlichen Erfolg von Camus’ Roman erklärt Béatrice Lacoste, Mitarbeiterin des Verlags Gallimard, in dem La Peste 1947 erstmals erschienen ist, mit der Rolle der Literatur als Refugium, als Reflexionsmedium sowie als Hilfe, die durch COVID-19 verursachte Erosion von (vermeintlichen) Sicher- und Gewissheiten geistesgeschichtlich einzuordnen und dadurch ein Stück weit Sicherheit zurückzuerlangen. Nicht zuletzt wegen des Erfolgs von La Peste erhielt Camus 1957 den Nobelpreis für Literatur.
Verschwörungsnarrative
Wie die momentane Lage exemplarisch belegt, stellen länder-, gar kontinentübergreifende Infektionsereignisse individuelle, gesellschaftliche und interkulturelle Beziehungen auf die Probe. In einer derartigen Situation sind der Reflex zur gegenseitigen Schuldzuweisung und Abschottung, das bereits angesprochene Reüssieren von Verschwörungserzählungen sowie eine nationalistische und populistische Instrumentalisierung der Krankheit zu beobachten: „The Chinese virus“ nennt einer der weltweit bekanntesten amerikanischen Verschwörungstheoretiker Corona. Die Sinnlosigkeit, von der Camus’ Roman in der Nachkriegszeit Zeugnis abzulegen versuchte, scheint auch heute noch kaum erträglich zu sein, und so müssen Erklärungen her, die auch dem scheinbar Sinnlosen Sinn zu verleihen vermögen – selbst wenn es das Phantasma einer Weltverschwörung ist, deren Ziel einzig darin liegt, die Menschen durch disziplinäre Maßnahmen gegen die Epidemie einem geheimen Regime zu unterwerfen. Zu verzeichnen sind aber auch die Bereitschaft zur Kooperation und Solidarität, eine intensivierte Epochenwahrnehmung und das verstärkte Bewusstsein, einer Weltgemeinschaft anzugehören. Überdies bietet sich die Möglichkeit, etablierte Denkmuster zu durchbrechen und alternative Lebens-, Gesellschafts- und Weltmodelle zu diskutieren, was aktuell u. a. darin seinen Niederschlag findet, dass die Globalisierung, ihre Chancen und Risiken einer genauen Prüfung unterzogen werden.
Nun kann man von der Literatur sicher nicht erwarten, dass sie Lösungen für die durch die Seuche heraufbeschworene globale Krise bereithält. Das wäre eine groteske Überforderung. Aber die Literatur ist auch mehr als ein bloßer Zeitvertreib, der in schweren Zeiten hilft, von der Seuche abzulenken. Sie ist ein historisches Archiv, aus dem sich ablesen lässt, welche Spannungen nicht nur die Pest, sondern auch Epidemien wie Cholera, Diphtherie oder Polio in menschliche Verhältnisse eintragen. Und die Liste der Texte, die für eine Befragung des Zusammenhangs von Literatur und Seuche infrage kommen, ist lang: Sie reicht neben der bereits angesprochenen Ilias Homers, dem Decamerone Boccaccios und Camus’ La peste bis zu Philip Roths Nemesis. Zu nennen wären sicherlich: Sophokles: König Ödipus; Lukrez: De rerum natura; Abraham a Sancta Clara: Merck’s Wienn! Das ist: des wüthenden Tods umständige Beschreibung; Daniel Defoe: A Journal of the Plague Year; Friedrich Hölderlin: Anmerkungen zum Oedipus; Mary Shelley: The Last Man; Heinrich Heine: Ich rede von der Cholera. Ein Bericht aus Paris von 1832; Edgar Allan Poe: The Masque of the Red Death; Jeremias Gotthelf: Die schwarze Spinne; Jens Peter Jacobsen: Pesten i Bergamo; Karl May: Von Bagdad nach Stambul; Ricarda Huch: Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren; Georg Heym: Das Schiff; Thomas Mann: Der Tod in Venedig; Andrzej Szczypiorski: Msza za miasto Arras; García Márquez: El amor en los tiempos del cólera; Lukas Hartmann: Die Seuche; Mirjam Pressler: Dunkles Gold, schließlich Martin Meyers Corona. Unabhängig von der Frage, wie erweiterbar die Liste noch wäre, ist eines sicher: Auch in Zeiten von COVID-19 geht der Lesestoff nicht aus. Denn das ist nur ein erster Überblick über eine Überlieferungsgeschichte, die reich ist an Zeugnissen, deren Wert nicht allein in der historischen Dokumentierung, sondern auch der ästhetischen Stilisierung des Geschehens liegt.
Erzählungen vom Ende des Schreckens
Eins ist allen Erzählungen in diesem Zusammenhang gemein: Sie transformieren die Epidemie in ein Narrativ, das sich auf das medizinische Wissen der Zeit stützt, sich in diesem aber nicht erschöpft, sondern darüber hinaus die grundsätzliche Frage nach dem Lebensrecht des Menschen auf dem Planeten Erde stellt. Nicht die Literatur tritt dabei als Epidemie auf, als Virus, der sich über die ganze Welt verbreitet hat, sondern der Mensch. Als eine epidemisch auftretende Krankheit, die die Erde zu zerstören droht, hat schon Nietzsche den Menschen in Also sprach Zarathustra verstanden haben wollen. Den Ekel am Menschen versuchte er mit der Idee zu bewältigen, dass alles, was geschehen ist, ohne ein absehbares Ende immer wiederkehrt: Die Vorstellung des absoluten Schreckens, der ewigen Wiederkehr des Gleichen unterworfen zu sein, sollte jeden konkreten Schrecken tilgen. Die Erzählungen von den Epidemien, darin ungleich humaner als der Ansatz Nietzsches, gehen meist umgekehrt vor: Sie stiften Hoffnung, indem sie zeigen, dass alles, auch die scheinbar nicht zu bewältigenden Seuchen, ein Ende haben wird. In der Ilias gelingt es den Griechen, den zürnenden Gott zu besänftigen, und die Florentiner Jugend Boccaccios findet nach dem Rückzug auf das Land ein neues Leben in der alten Heimat. Camus hat La Peste unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geschrieben und den Schwarzen Tod eindrucksvoll als Metapher für die jüngst erlebten Schrecken genutzt, deren Ende lange nicht absehbar und dann umso befreiender war. Nicht unter jedem Schlusssatz eines Romans steht das Wort Ende. Aber jeder Schlusssatz zeigt, dass hier ein Ende erreicht ist. Und so sind literarische Berichte von Epidemien, die katastrophisch über die Menschen hereinbrechen, immer auch Erzählungen, die die Seuche symbolisch beenden. Der große Roman über COVID-19 ist noch nicht geschrieben, und vielleicht wird er es auch nie. Wenn es ihn geben wird, dann aber vermutlich als eine Geschichte vom Ende der Seuche.
Achim Geisenhanslüke ist Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität;
Dr. Thomas Emmrich ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 6.20 (PDF) des UniReport erschienen.