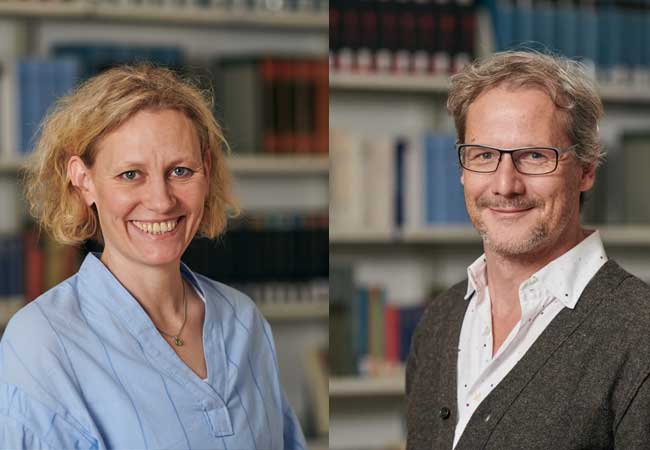Winfried Menninghaus ist Literaturwissenschaftler, der sich nach Jahrzehnten der Beschäftigung mit klassischer und moderner Rhetorik, Poetik und Ästhetik der empirischen Literaturwissenschaft zugewandt hat.
Seit 2013 arbeitet Prof. Winfried Menninghaus am Max-Planck-Institut für Empirische Ästhetik in Frankfurt. Er ist einer der Gründungsdirektoren und leitet die Abteilung „Sprache und Literatur“. Menninghaus war vorher an der Freien Universität Berlin und begründete dort 2007 den Exzellenzcluster „Languages of Emotion“.
Menninghaus ist Hölderlin-Experte, hat viel zur Romantik geforscht und sich mit poetologischen und ästhetischen Fragen beschäftigt. Sein Wechsel in die empirische Literaturwissenschaft mag für Außenstehende eine Zäsur darstellen. Dafür ist er gewissermaßen vom gemütlichen Professoren-Schreibtisch ins Hightech-Labor gewechselt und beobachtet mit Methoden der ‚harten‘ Forschung, welche Wirkung Lyrik auf Leser hat.
Defizite der herkömmlichen Literaturwissenschaft
Menninghaus betont, dass auch sein aktuelles Interesse an Sprache und Wahrnehmung sich durchaus aus seiner langjährigen Beschäftigung mit Rhetorik und Poetik speise: Denn traditionell verfügten diese Disziplinen über die Expertise nicht nur für die künstlerische Bearbeitung von Sprache, sie enthielten zugleich das gesamte Wissen ihrer Zeit über Sprache überhaupt und über die psychologischen Mechanismen ihrer Wirkung.
Die Ästhetik des 18. Jahrhundert, und zumal Kants, habe darüber hinaus Tuchfühlungen mit der Biologie ihrer Zeit gehalten. Mit der Ausdifferenzierung der akademischen Disziplinen im 19. Jahrhundert – und vor allem der Kritik an Rhetorik als einer reinen Technik der Manipulation – sei dann aber dieser umfassende Blick auf Sprache und Emotionen zunehmend, wenn auch nie vollständig verschwunden.
Die philosophische Ästhetik habe zwar keinen vergleichbar massiven Ansehensverlust erlitten, aber in ihr spiele die Literatur nurmehr eine untergeordnete Rolle und sei zunehmend hinter Musik und Bildkünste zurückgetreten. Die herkömmliche Literaturwissenschaft, so Menninghaus’ Kritik, habe in ihrer Hinwendung zu einer breiten Erforschung kulturelle Kontexte das Interesse an Erkenntnissen und Fragestellungen sprachwissenschaftlicher und ästhetischer Natur weitgehend verloren.
Auch ganz unabhängig davon habe die klassische Literaturwissenschaft ein weiteres Defizit: Sie sei ein reiner Diskurs von Experten für andere Experten und könne von sich aus wenig bis nichts darüber sagen, inwiefern ihre Interpretationen irgendetwas erfassen, was für die Mehrheit der Leser von Literatur relevant ist. Sie könne damit letztlich auch nichts dazu sagen, was die Literatur mit dem Leser mache, gerade auch im Hinblick auf persönliche, kulturelle und historische Variablen.
Eben hier setzt die empirische Ästhetik als eine „Ästhetik von unten“ (Fechner) an; nur sie könne auch die vielen kulturellen und persönlichen Variablen des konkreten Text-Erlebens von Lesern hochauflösend analysieren, und zwar auf Zeitskalen, die von der Millisekunde bis hin zu wiederholten Lesevorgängen über Jahre hinweg reichen.
Tränen und Gänsehaut
Der Vorwurf vieler Skeptiker, es gehe bei der empirischen Literaturwissenschaft nur um geistloses Messen, sei falsch. Vielmehr komme es bei der Empirischen Literaturwissenschaft nicht nur auf die Methoden, sondern stets ebenso auf genuin theoretische Annahmen an. Menninghaus konzediert, dass empirische Untersuchungen bei hohem methodischen und zeitlichen Aufwand oft nur bescheidene Ergebnisse liefern.
Er betont aber zugleich: Empirische Forschung beweise nicht nur trivial wirkende Annahmen, sie habe durchaus das Potential, auch umstrittene und letztlich ungelöste philosophische Fragen zu klären. „So wurde etwa von einigen modernen Philosophen gegen eine lange Tradition seit Aristoteles behauptet, dass es im Kunsterleben letztlich keine negativen Gefühle gebe und dass Rezipienten nur fälschlich glauben und entsprechend fälschlich berichten, dass sie negative Gefühle empfinden.
Dieser Hypothese kann man mit allerlei Gründen zustimmen oder widersprechen; rein mittels philosophischer Argumentation kann ein solcher Disput aber kaum entschieden werden.“ In einer Versuchsreihe konnten Wissenschaftler aus Menninghaus’ Gruppe anhand mehrerer kontinuierlich und in Echtzeit erhobener physiologischer Maße für positive und negative Affekte nachweisen, dass es tatsächlich negative Affektivität in der Kunst- und Medienrezeption gibt und dass starke positive und negative Gefühle dabei oft auch strikt gleichzeitig vorkommen
. Als besonderer Befund ergab sich dabei auch, dass die antagonistischen Zweige des Autonomen Nervensystems (Sympathicus und Parasympathicus) etwas tun, was vorher kaum bekannt war: Sie erreichen gleichzeitig hochintensive Aktivierungsgrade, speziell bei gleichzeitigem Vorkommen der Parasympathicus- gesteuerten Tränen und der Sympathicus- gesteuerten Gänsehaut-Reaktion.
Gewiss sind solche „goosetears“ („Gänsetränen“) sehr spezielle Reaktionen, aber sie erlauben aufgrund ihrer Intensität eine prägnante Einsicht in die Natur „gemischter Gefühle“, in denen positive und negative Gefühle eine enge Verbindung eingehen. „In diesem Zusammenhang ist auch die Erkenntnis der neueren Psychologie sehr interessant, dass wir generell negative Gefühle bevorzugt prozessieren, als besonders intensiv erleben und auch tendenziell länger im Gedächtnis speichern.
Die ganze Tradition der Poetik hat ja die Künste als Techniken der Aufmerksamkeits- Erzeugung verstanden. Negative Gefühle sind insofern prädestinierte Verbündete der Künste. Vertiefte Aufmerksamkeit, Intensität der Involvierung und Langzeitwirkung im Gedächtnis sind mit rein positiven Gefühlen allein nicht zu erreichen.“
Fehlendes Selbstbewusstsein der Geisteswissenschaften?
Für Menninghaus stellt die Empirische Literaturwissenschaft weder eine Alternative zu noch eine Bedrohung für die herkömmliche Literaturwissenschaft dar. Zuallererst sei das Ziel gar nicht dasselbe: um die Literatur selbst und ihre Geschichte kennenzulernen, sei das klassische Studium der Literaturwissenschaften der einzig richtige Weg.
Und für die Psychologie und Ästhetik des Literatur-Lesens gebe es bislang nur sehr wenige Lehrstühle, nicht zuletzt wegen des hohen technischen Aufwandes, der betrieben werden müsse. Eine deutlich größere Bedrohung sieht er der klassischen Literaturwissenschaft dagegen in den Digital Humanities erwachsen. Erstens könnten diese grundsätzlich – von erhöhten Anforderungen an Rechenleistungen abgesehen – mit einer Infrastruktur betrieben werden, die nicht sehr verschieden sei von derjenigen einer literaturwissenschaftlichen Abteilung.
Und zweitens sei jetzt schon erkennbar, dass die klassischen Literaturwissenschaften und die Digital Humanities sich letztlich die gleichen Ressourcen teilten und sich in ihrer Entwicklung deshalb wie kommunizierende Röhren verhielten. Gegen ein Nebenfach „Empirische Literaturwissenschaft“ spricht sich Menninghaus vehement aus:
„In einem Nebenfach oder Modul würde sicherlich nicht die notwendige Expertise erworben, um auf Augenhöhe mit empirischen Psychologen zu forschen“, fürchtet Menninghaus. Eine nicht vorhandene „Satisfaktionsfähigkeit“ der Absolventen in der empirischen Forschung ginge überdies wahrscheinlich einher mit Defiziten in der klassischen Literaturkenntnis.
Die Geisteswissenschaften sollten im härter werdenden Konkurrenzkampf deshalb ihre genuinen Stärken nicht nur bewahren, sondern auch besser zur Geltung bringen. Keine andere Disziplin wisse so gut Bescheid über Literatur wie die klassische Literaturwissenschaft. Auch wenn die Beschäftigung mit Hochliteratur weiterhin im Fokus stehen müsse, könne es nicht schaden, auch etwas mehr in die Niederungen hinabzusteigen.
„Auch ein Erfolgsbuch wie ‚Fifty Shades of Grey‘ kann mit Gewinn einer literaturwissenschaftlichen Analyse unterzogen werden, gerade auch bei Einbeziehung der Frage, wer die Leser sind und was sie in diesen Büchern suchen und finden.“ Ein anderes Beispiel ist für Menninghaus ist die Sprache der Werbung:
„Dort kann man analysieren, wie sehr sich die Texter an den Prinzipien der Rhetorik orientieren.“ Ein übergreifendes, auch philosophisch und politisch relevantes Paradigma, wie es die Geisteswissenschaften für einige Zeit in der Kritischen Theorie, der Foucault’- schen Diskursanalyse oder dem Dekonstruktivismus gefunden hätten, sei von Studierenden allerdings momentan sowohl in der klassischen Literaturwissenschaft als auch in der empirischen Ästhetik kaum zu finden.
Interdisziplinarität anstelle von Grabenkämpfen
Menninghaus kann die Kritik an der empirischen Wende auch in anderen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern durchaus nachvollziehen. Dies gehe mitunter einher mit einer neuen Form von Wissenschaftsgläubigkeit: „Jetzt will die Öffentlichkeit von der empirischen Literaturwissenschaft endlich wissen, was es denn mit der Literatur auf sich habe“, meint er augenzwinkernd.
Empirische Studien zu lesen sei manchmal kein Hochgenuss: „Die klingen oft sehr technokratisch, sind oft nahezu unlesbar, weil sie erheblichen Aufwand auf den Nachweis verwenden müssen, dass sie tatsächlich genau das und nur das gemessen haben, was sie messen wollten, und dass es keine anderen verursachenden Faktoren gegeben hat.“
Ohne solche oft peniblen Nachweise komme man nun einmal in kein angesehenes Journal. Die Lagerkämpfe von quantitativ und qualitativ arbeitenden Forschern lehnt Menninghaus ab: „Wenn man sich gegenseitig als ‚empirische Reduktionisten‘ und ‚qualitative Schwafler‘ beschimpft, kommt man keinen Schritt weiter.“
Menninghaus wünscht sich stattdessen, dass Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Disziplinen gemeinsam an einer Frage forschen: „Empirische Literaturwissenschaft wird nicht die herkömmliche Literaturwissenschaft ersetzen, aber sie kann vielleicht dafür sorgen, dass die Reflexion auf Literatur im modernen Gewand wieder näher an die Rhetorik, Poetik und Ästhetik herangeführt wird.“
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 3.18 des UniReport erschienen. PDF-Download »