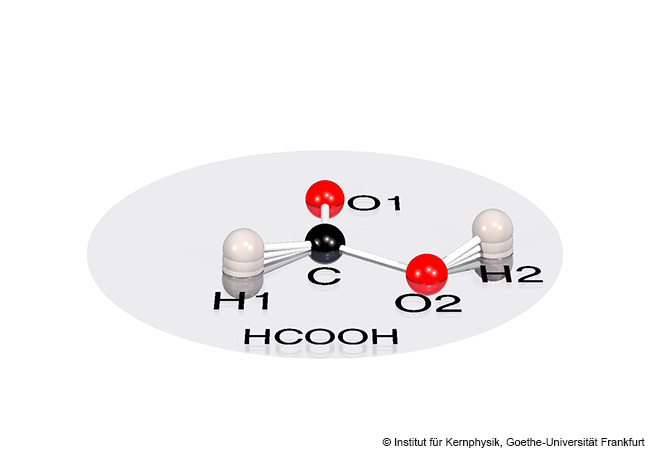Der Wirtschaftswissenschaftler Leo Kaas hat in einer Forschergruppe untersucht, wie im Rahmen eines US-Corona-Hilfsprogramms Unternehmen künstlich am Leben erhalten wurden, die eigentlich nicht mehr tragfähig waren.
UniReport: Herr Prof. Kaas, Sie haben das amerikanische Corona-Hilfsprogramm »Paycheck Protection Program« analysiert. Wäre das nicht auch mit einem vergleichbaren deutschen beziehungsweise europäischen Programm möglich gewesen?
Leo Kaas: Wir sind ein internationales Team von Ko-Autoren, zum Teil mit US-Hintergrund. Das Paper ist für ein internationales Publikum gedacht, da war es schon naheliegend, für eine solche Makro-Analyse die US-Wirtschaft zu untersuchen. Zudem ist die Datengrundlage für die amerikanische Wirtschaft auch besser als für die in Deutschland. Da hätten uns an der einen oder andere Stelle Daten gefehlt.
Wie lässt sich der etwas bildhafte Begriff »Zombie-Unternehmen« bestimmen?
Wir können in der Tat in unserem strukturellen Modell ziemlich genau sagen, wann es gut ist, dass ein Unternehmen überlebt und wann nicht. Mit ‚gut‘ ist hier gemeint: Es ist besser für die Gesellschaft, ein Unternehmen in der Krise zu retten. Bei einem „Zombie-Unternehmen“ wäre hingegen dessen Tod zu bevorzugen. Ursprünglich stammt der Begriff aus Japan, dort bezogen auf Banken („Zombie-Banken“), die nach der Finanzkrise in den 1990ern durch staatliche Unterstützung zu lange am Leben gehalten wurden. In der Corona-Krise stellte sich die Frage, ob in den USA (und auch anderswo) mit staatlichen Hilfen zu viele Unternehmen am Markt gehalten wurden.
Die staatlichen Hilfen kamen vor allem kleinen Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern zugute. Ist das aus makroökonomischer Sicht sinnvoll oder war das eher der Stimmung in der Bevölkerung geschuldet?

(Foto: privat)
Ja, die sind mitunter gar nicht so klein, bei uns würde man wohl KMUs (= kleine und mittlere Unternehmen) dazu sagen. Die Idee hinter dem Förderprogramm war eben, dass es eher die kleinen Unternehmen sind, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten haben. Auf der einen Seite ist ihnen die Nachfrage weggebrochen, zum anderen waren Unternehmen in bestimmten Dienstleistungsbranchen direkt von Lockdowns betroffen. Diesen Unternehmen wollte man unter die Arme greifen. Denn Unternehmen dieser Größe haben auch schlechtere Zugänge zu den Kapitalmärkten, müssen aber weiter ihre Fixkosten stemmen. Gerade zu Beginn der Pandemie wusste man ja auch gar nicht, wie lange die Corona-Schutzmaßnahmen andauern werden, daher wollte man kein massenhaftes Unternehmenssterben sehen – damit nachher nicht alle Restaurants, Hotels oder Fitnessstudios verschwunden sind.
War das nicht auch der politischen Stimmung im Land geschuldet? Weil vielleicht auch gerade die kleinen Unternehmen den Leuten besonders am Herzen liegen?
Wenn sehr viele kleine Unternehmen zumachen müssen, ist das auch volkswirtschaftlich fatal: Da können viele Arbeitsplätze wegbrechen. In Deutschland gab es bereits im März 2020 Soforthilfen, die schnell und unbürokratisch ausgezahlt wurden, was dann bei den späteren Überbrückungshilfen nicht mehr ganz der Fall war. Man wollte sowohl ineffiziente Kapitalliquidationen, aber auch einen massiven Verlust an Arbeitsplätzen verhindern. Während in Deutschland zusätzlich das bewährte Instrument der Kurzarbeit eingesetzt wurde, musste man in den USA, wo es so etwas nicht gibt, ein anderes Programm aufsetzen – eines, das eher nach dem Prinzip Gießkanne funktioniert hat.
Welche Möglichkeiten stellen sich denn, um Mittel besser und effizienter zu verteilen?
Man hätte Auflagen machen können, dass die Unternehmen ihre Gehaltslisten offenlegen, oder man hätte die Umsatzverluste im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigen können. Die Prüfung dieser Auflagen wäre aber natürlich mit hohen Kosten für den Staat verbunden gewesen.
Salopp gesagt wäre es aus ökonomischer Sicht also besser, schwache Unternehmen »sterben« zu lassen?
Grundsätzlich ist es nicht schlecht, dass Unternehmen aus dem Markt ausscheiden, neue dafür eintreten. Wenn man versucht, zu breitflächig zu helfen, dann verhindert man unter Umständen den Prozess einer kreativen Zerstörung. Dieser Begriff geht auf den Ökonomen Josef Schumpeter zurück. Demnach haben Rezessionen auch einen reinigenden Effekt. Die ungezielte Politik hat letztlich auch Unternehmen gerettet, die wenig produktiv waren oder es gar nicht benötigt hätten; darunter waren dann auch zum Teil „Zombie-Unternehmen“. Nach unseren Berechnungen waren das immerhin 16 Prozent aller durch das staatliche Programm geretteter Unternehmen.
Warum hat der amerikanische Staat das nicht im Vorhinein gesehen?
In früheren Krisen hat der amerikanische Staat tatsächlich weniger eingegriffen. In der Pandemie hatte man es aber mit einer zuvor nie bekannten Situation zu tun, da in Folge der Lockdowns und der Zurückhaltung der Verbraucher bestimmte Branchen nahezu komplett dichtmachen mussten. Man wollte die betroffenen Unternehmen schützen, da ansonsten Kapital und Arbeitskräfte verloren gehen, die nach der Pandemie wieder benötigt werden. Man sieht das ja jetzt auch in Deutschland und anderswo, dass sogar trotz der Rettungspakete in manchen Branchen händeringend Mitarbeiter gesucht werden. Das Problem wurde von der Politik früh erkannt und grundsätzlich wurde schnell und angemessen reagiert.
Werden Staaten an den hohen Kosten der Hilfsprogramme noch länger zu knapsen haben? Die Krisen haben ja nicht gerade abgenommen.
Unsere Studie beschäftigt sich natürlich im Kern nur mit dem US-Programm. In Deutschland lief es insgesamt besser, so meine Einschätzung. Aber klar: Die Belastbarkeit eines Staatshaushalts ist begrenzt. In den USA sind die Staatsschulden noch stärker gestiegen, weil dort auch durch Bidens Fiskalprogramme viel ausgegeben wurde. Aber auch in Europa gibt es natürlich Staaten, die hoch verschuldet sind, man denke nur an Italien. Hohe Schuldenstände begrenzen aktuell die staatlichen Möglichkeiten, in der Energiekrise besonders stark betroffene Unternehmen und Haushalte zu unterstützen.
In Deutschland wurde aber auch großen Unternehmen wie der Lufthansa geholfen. Müsste man dort auch hinschauen?
Die Diskussionen dazu gab es ja durchaus vor zwei Jahren. Da haben aber andere Überlegungen eine Rolle gespielt: Im Falle eines großen Unternehmens wie der Lufthansa kann man schon sagen „too big to fail“. Im Unterschied zu kleinen Unternehmen konnte sich hier der Staat aber mit Eigenkapital beteiligen und damit zahlreiche Auflagen verbinden.
Questions: Dirk Frank