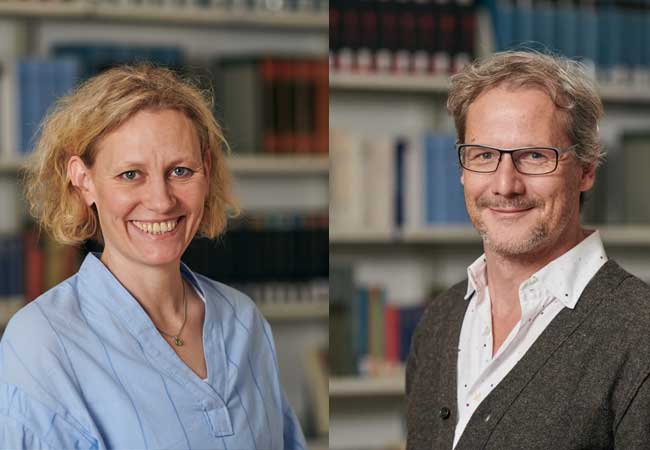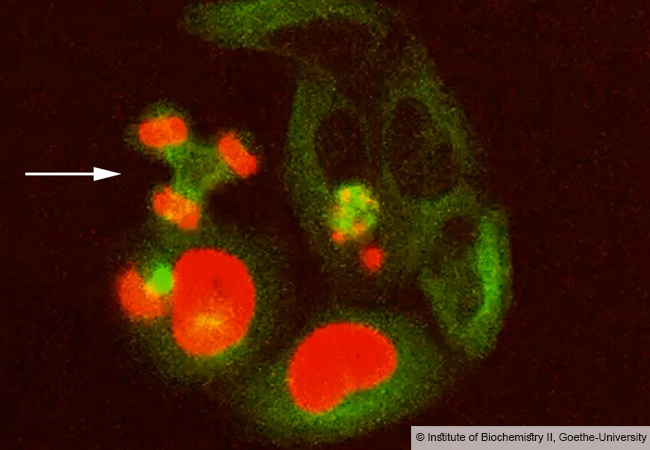Ein Gespräch mit Prof. Simon Wendt, Amerikanist an der Goethe-Universität, über Rassismus und Protestbewegung in den USA.

Anke Sauter: Der afroamerikanische Schriftsteller Colson Whitehead, Autor des Buches Underground Railroad, gab sich in der FAZ sehr desillusioniert: Selbst die massiven Proteste würden nichts am Rassismus ändern. Teilen Sie diesen Pessimismus?
Prof. Simon Wendt: Wie Whitehead bin ich pessimistisch. Seit den 1960ern, als die ersten Unruhen Amerika und die Welt schockiert haben, hat sich wenig geändert. In der Regel sind die Leute immer sehr überrascht, woher diese Wut und die Gewalt kommen, aber es geht meistens nicht über diese Überraschung hinaus. Denn es wären fundamentale Veränderungen notwendig, und dazu ist fast niemand bereit. Die aktuellen Ereignisse geben allerdings Anlass zu ein bisschen Hoffnung. Mehrere Städte und Bundesstaaten haben sich sehr zügig dazu entschlossen, die Polizei zu reformieren bzw. umzuorganisieren. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob weitere Bundesstaaten folgen werden und ob der amerikanische Kongress diese Reformen per Gesetz unterstützen wird.
Das größte Problem momentan ist sicherlich die Polizeigewalt, der strukturelle Rassismus. Aber wie verankert ist der Rassismus in der Breite der Bevölkerung?
Es gibt natürlich Untersuchungen, aber Prozentzahlen sind sehr schwierig zu ermitteln. Natürlich wissen die Leute heutzutage, dass es problematisch ist, rassistische Überzeugungen zu äußern und halten sich mit ihren wahren Einstellungen entsprechend zurück. Im Ergebnis sieht man dann einen Rückgang von rassistischem Gedankengut. Aber im Alltag erlebt man, dass der Rassismus nach wie vor sehr präsent ist. Gleichzeitig geben immer mehr weiße Menschen in Umfragen zu, dass Rassismus ein Problem ist, das angegangen werden muss. Auch wird sich noch zeigen, ob derartige Umfragen auch zu mehr Unterstützung für konkrete Veränderungen in der Gesellschaft führen werden.
Können Sie ein Beispiel für Alltagsrassismus nennen?
Da gibt es diesen Vorfall vor einigen Wochen in New York, als eine weiße Frau im Central Park ihren Hund hat ausführen wollen. Als ein Afroamerikaner, der dort Vögel beobachtet hat, sie darum bat, den Hund anzuleinen, wie es den Vorschriften entspricht, hat sie sich von diesem Mann vor allem bedroht gefühlt und die Polizei angerufen. Beim Anruf hat sie immer wieder betont, dass es sich um einen Afroamerikaner handelt: „Hier ist ein Afroamerikaner, der mich bedroht!“ Diese Angst vor vermeintlichen schwarzen Vergewaltigern sitzt ganz tief. Sie drückt sich in solchen kleinen Situationen aus, die jeden Tag passieren.
Ein schwarzer Amerikaner kann also ganz alltägliche Dinge nicht tun, ohne verdächtig zu sein – zum Beispiel Vögel beobachten?
Ja. Deshalb gibt es jetzt den Hashtag bei Twitter #whileblack, also während man schwarz ist, z.B. barbecuing while black oder jogging while black. Das heißt, es geht um Alltagssituationen, für die sich eigentlich niemand interessieren würde, aber wenn es sich um Afroamerikaner handelt, dann wird oft die Polizei gerufen, weil es irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Nach dem Motto: Es ist entweder illegal, oder sie führen was im Schilde. Das ist sehr schockierend!
Müsste man nicht eigentlich sowieso in den Köpfen anfangen, das heißt beim Bildungssystem? Inwiefern wird die Geschichte der Afroamerikaner denn an amerikanischen Schulen behandelt?
Die afroamerikanische Geschichte bzw. die Sklaverei spielt seit den 1970ern bzw. 80ern in Schulbüchern eine größere Rolle. Aber dadurch, dass die Bildung zum Teil von Bundesstaaten bzw. lokalen school boards geregelt wird, gibt es einen Flickenteppich. Das fängt beim amerikanischen Bürgerkrieg an: Im Süden gibt es Schulbücher, die versuchen, die Rolle der Südstaaten bzw. die Rolle der Sklaverei in den Hintergrund treten zu lassen. Und wenn über afroamerikanische Geschichte gesprochen wird, dann im Sinne eines „dunklen Kapitels“, das aber ja mittlerweile hinter uns liegt.
Und eine Verbindung zur Gegenwart findet nicht statt?
Nein. Ich halte es für problematisch, dass sich die USA nach wie vor als besondere Nation ansieht, die zwar in der Vergangenheit Probleme hatte, diese aber gemeistert hat. Die amerikanische Geschichte ist immer nur eine Geschichte des Fortschritts. Es gibt in den USA keinen Versuch, mit der Sklaverei oder deren Erbe kritisch umzugehen. Wenn dann sowas passiert wie der Mord an George Floyd, sind die Leute immer so ein bisschen schockiert, mittlerweile auch die Republikaner.
Worin unterscheidet sich die Bestürzung der Konservativen von der der Liberalen?
Bei den Reaktionen von konservativen Amerikanern bzw. Politikern gibt es ein sehr typisches Muster: Sie sagen, natürlich dürfen die Leute protestieren, aber da sieht man wieder, dass die Afroamerikaner diese radikalen Ideen haben. Wir müssen die öffentliche Sicherheit wiederherstellen. Insofern wird die Ursache dafür, dass diese Proteste überhaupt entstanden sind, zu einer Fußnote.
Und Sie halten es nicht für wahrscheinlich, dass die aktuellen Proteste zu Veränderungen führen?
Ich bin skeptisch, aber nicht vollkommen hoffnungslos. Vor einiger Zeit schon hat ein Kongressabgeordneter ein Gesetz vorgeschlagen, das der Polizei den Würgegriff verbietet. Aber das ist eine kosmetische Sache, denn es wurden Tausende Afroamerikaner erschossen. Man müsste die Polizeiarbeit grundsätzlich reformieren, aber es geht auch um wirtschaftliche Ungleichheit, Gesundheitsvorsorge und um Bildung. Der demokratische Kandidat Bernie Sanders, der sich mittlerweile aus dem Rennen verabschiedet hat, hat solche grundlegenden Veränderungen vorgeschlagen, die in Richtung eines europäischen Sozialstaates gehen. Aber dafür sehe ich keine politische Mehrheit. Gleichzeitig haben die Proteste einen bisher nicht dagewesenen Denkprozess in Gang gebracht, an dessen Ende zumindest Veränderungen auf lokaler oder bundesstaatlicher Ebene möglich sein könnten.
Nochmal einen kurzen Blick auf uns in Deutschland. Auch bei uns gibt es Rassismus. Inwiefern lässt sich der deutsche Alltagsrassismus mit dem in den USA vergleichen?
Jeder nicht-weiße Mensch wird Ihnen auch hierzulande von rassistischen Erfahrungen berichten können. Das fängt bei Kaufhausdetektiven an, die nicht-weiße Menschen verfolgen, weil sie glauben, dass sie stehlen. Oder Polizisten, die nicht-weiße Menschen anhalten, weil sie vermuten, dass sie Drogendealer sind. Da gibt es Muster, die denen in den USA ähneln, z.B. dass nicht-weiße Menschen eher als Kriminelle gesehen werden und ihnen das Deutschsein abgesprochen wird. Es gibt also durchaus Ähnlichkeiten. Der große Unterschied: Die Gefahr, bei einer Polizeikontrolle erschossen zu werden, ist bei uns nicht so groß wie in den USA. Als amerikanischer Staatsbürger läuft man theoretisch jeden Tag Gefahr, ermordet zu werden, wenn man keine weiße Hautfarbe hat.
Also besteht der Unterschied in der Verfügbarkeit von Waffen?
Dass Rassismus gepaart mit Gewalt eine ganz andere Stoßkraft hat, sieht man nicht nur bei der Polizei. Immer wieder zünden rechtextreme Täter Kirchen an oder ermorden Afroamerikaner, weil die rassistische Ideologie mit Gewalt verbunden ist und die Täter Zugang zu den Waffen haben, die es ihnen ermöglichen, die Gewalt auszuüben. Wenn wir in Deutschland nicht so strenge Waffengesetzte hätten, dann wäre auch hierzulande mehr Gewalt vorstellbar. Deshalb ist es ja auch so erschreckend, dass Teile der Bundeswehr rechtsextrem unterwandert sind, dass es rechtsextreme Zellen gibt, die ja auch schon gemordet haben. Aber es ist nicht nur die Gewalt in den USA: Die Kombination aus schlechter Gesundheitsvorsoge, schlechten wirtschaftlichen Aussichten und schlechten Bildungschancen stellt diese Gruppe vor solche Probleme, dass es eigentlich viel mehr und öfter Proteste geben müsste.
Welche Voraussetzungen müssten gegeben sein, damit diese Proteste doch zu etwas führen?
Wahrscheinlich wird sich nur auf lokaler bzw. bundesstaatlicher Ebene etwas ändern. Das wird ein Flickenteppich von Vorschriften, von Vorstößen sein, wie man verhindern kann, dass diese Minderheit ständig malträtiert und umgebracht wird. Viel mehr wird nicht zu erwarten sein. Diese Chance hat man in den 1960ern mit den Bürgerrechtsgesetzen verpasst. Ich bezweifle, dass sich auf Bundesebene viel tun wird, aber Veränderungen in bestimmten Regionen wäre ja schon mal ein Anfang.
Wie hätte man mit den Bürgerrechtsgesetzen weitergehen müssen?
Damals wurde ein war on poverty, ein Krieg gegen die Armut, deklariert. Es gab Programme, um armen Gemeinden in den Innenstädten, die in erster Linie von Afroamerikanern bevölkert wurden, zu helfen. Aber diese Programme waren nicht breit genug angelegt. Sie haben sich eher an Individuen gerichtet und waren zudem zeitlich begrenzt. Viele Wissenschaftler sind der Auffassung, dass man flächendeckende Verbesserungen hätte erreichen können. Aber hinterher weiß man es immer besser. Klar ist, dass wir eine Verschränkung von Klasse, wirtschaftlichen Problemen und race haben, das ist schwierig in den Griff zu bekommen.
Vielleicht sind die sozialen Medien ein Motor von Veränderungen?
Die sozialen Medien spielen eine große Rolle: Regelverstöße und Gewalttaten können dokumentiert werden, die sonst verschwiegen worden wären. Aber die wenigsten Polizisten, denen Verstöße nachgewiesen wurden, wurden auch verurteilt bzw. angemessen bestraft, trotz Videobeweis. Ein Polizist muss nur glaubhaft machen, dass er sich bedroht fühlte. Der andere wichtige Punkt ist, dass die Leute sich mit den sozialen Medien ganz anders vernetzen und eine Bewegung auf die Beine stellen können. Aber black lives matter wurde 2013 als Reaktion auf die Polizeigewalt gegründet als extrem basisdemokratisch orientierte Bewegung. Das heißt, es gibt keine wirkliche Struktur oder einen Anführer bzw. eine Anführerin. Das macht es schwierig, sich auf gemeinsame Ziele zu einigen und diese auf einer zentralen Ebene durchzusetzen. Allerdings hat man in den letzten Wochen beobachten können, dass die Proteste besser koordiniert werden. Diese Organisationsstrukturen könnten in den nächsten Jahren zu nachhaltigem Aktivismus führen.
Das heißt, man müsste sich besser organisieren?
Ja. Gleichzeitig sollte man sich bewusstwerden, was will man eigentlich? Das ist ein Unterschied zur Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 60er. Da war klar: Wir wollen die Abschaffung der illegalen Rassentrennungsgesetze, dieser Wahlverhinderungsgesetze. Aber alles andere konnte nicht abgeschafft werden. Es ist schwierig, den Rassismus durch Gesetze zu eliminieren, weil es eine Kombination aus sozialer Ungleichheit und rassistischem Gedankengut in den Köpfen ist. Es gibt kein konkretes Ziel. Und das ist der Grund, warum ich und so viele andere Leute so skeptisch sind. Ein Lichtblick ist wie gesagt, dass sich vielleicht auf lokaler Ebene etwas tut und es dort positive Veränderungen gibt.
Die Idee, dass man jemanden töten darf, nur, weil man sich bedroht fühlt, ist ja auch schon problematisch.
Ja, und das ist der schwierigste Teil. Man braucht bestimmte Regularien, damit die Leute, die Rassisten sind, sich auch daranhalten. So war es auch bei der Bürgerrechtsbewegung. Die Leute haben nicht gesagt: Oh ja, stimmt, das war alles so schlimm, es tut mir leid und jetzt ändere ich mich, sondern sie mussten sich an die Gesetze halten, weil ihnen sonst Geldstrafen oder Gefängnis drohten.
Womit befassen Sie sich momentan in Ihrer Forschung?
Zum einen läuft unter meiner Leitung momentan ein Projekt zum Thema Selbstverteidigung in den USA. (…) Darüber hinaus bin ich gerade dabei, eine Tagung über die Black Power Bewegung vorzubereiten, die in zwei Jahren an der Goethe-Universität stattfinden soll. Da wird es genau um diese Themen gehen, über die wir in diesem Interview gesprochen haben, Rassismus, soziale Ungleichheit, Polizeigewalt.
Da werden wahrscheinlich auch viele amerikanische Wissenschaftler dabeisein?
Ja, es werden viele amerikanische Kollegen und Kolleginnen da sein. Aber es gibt auch viele deutsche Wissenschaftler, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Wir versuchen, amerikanische, britische und deutsche Wissenschaftler, speziell Historiker und Historikerinnen, zusammenzubringen, um über die neusten Ansätze der Forschung zu Black Power zu diskutieren.
Wie ist denn das Verhältnis zu den amerikanischen Wissenschaftlern?
Es ist so, dass das Feld der African American Studies sehr stark politisiert ist, was dazu führt, dass eine Gruppe von afroamerikanischen Wissenschaftlern glaubt, dass weiße Menschen es eigentlich nicht so richtig verstehen können, was es heißt, ein Opfer von Rassismus zu sein. Was ja auch stimmt, aber als Wissenschaftler mit bestimmten Methoden an bestimmte Probleme zu gehen, sollte immer möglich sein. Ich selbst bin wegen meines Buches zum bewaffneten Widerstand in der Bürgerrechtsgesetzgebung von afroamerikanischen Wissenschaftlern teilweise angefeindet worden, die gesagt haben, ich solle lieber über den Holocaust schreiben.
Verstehen Sie diese Zurückweisung?
Ein stückweit schon. Der Rassismus hat ja auch dazu geführt, dass sich Afroamerikaner zurückziehen. Dass sie sagen, wir können nicht mit Weißen zusammenarbeiten bzw. wir vertrauen euch nicht, dass ihr die Dinge so analysiert, dass wir einen Gewinn davon haben. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das sollten nur Afroamerikaner machen, weil nur die wissen, was es heißt, schwarz zu sein. Das nennt man identity politics. Aber natürlich gibt es bestimmte wissenschaftliche Methoden, die jeder anwenden kann, und die Ergebnisse kann man dann debattieren. Vielleicht ist man nicht immer einer Meinung. Es gibt nun aber auch afrodeutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich durchaus für die Verknüpfungen zwischen dem Rassismus in Deutschland und in den USA interessieren. Am Ende versuchen wir doch alle, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und wir glauben, dass unsere wissenschaftliche Tätigkeit einen Beitrag dazu leisten kann. Wenn jeder nur noch seine Gruppe untersucht, ist nicht zu erwarten, dass bahnbrechende Dinge dabei herauskommen. Wenn einem ein Thema am Herzen liegt, muss man sich auch gegen Widerstände durchsetzen.
Interview: Anke Sauter