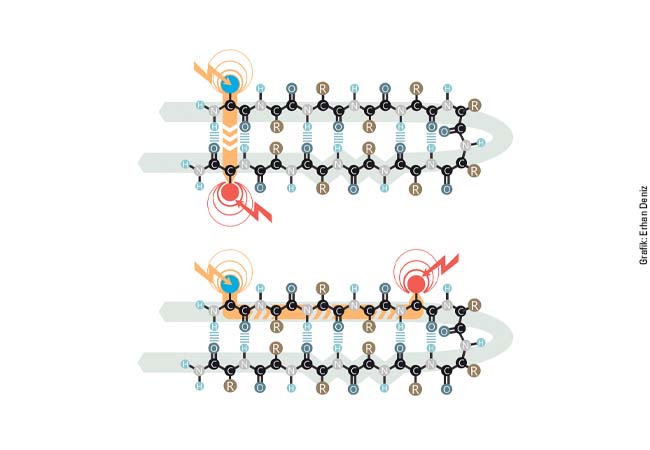Intersektionalität – ein zentrales Konzept feministischer Gegenwartsanalyse
Wer kommt gut durch die Corona-Krise? Wer verliert und wer profitiert sogar davon? Wer ist im besonderen Maße gefährdet oder verletzbar? Diese Fragen bilden derzeit neben täglichen Statusmeldungen zum Stand der Infektionen, zu Debatten um Schutzmaßnahmen und ihre Lockerungen, Auseinandersetzungen um die Einschätzung der Gefahr, Entscheidungen über eine Priorisierung von Behandlungsbedürftigen („Triage“) und Nachrichten zu Hilfeangeboten für Familien, Großfirmen, mittelständische Betriebe und Solo-Selbstständige als „life stories“ den Hintergrund der Diskussion. Mediale Aufmerksamkeitsökonomien bestimmen dabei die öffentliche Wahrnehmung der „Corona-Pandemie“ und der damit verbundenen Problemlagen ganz entscheidend. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtet sich z.B. auf „systemrelevante“ Berufe oder auch auf die Frage, wie Familien und dabei überproportional Frauen den Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung meistern. Weniger wird jedoch darüber gesprochen, dass geflüchtete Menschen – darunter auch viele Familien – in Massenunterkünften keine Möglichkeit haben, die geforderte Distanz zueinander einzuhalten und sich damit in Lebensgefahr bringen können. In ähnlichen Situationen befinden sich Obdachlose und andere marginalisierte Gruppen. Kaum thematisiert, wird die äußerst prekäre Situation trans*- und intersexueller Personen. Menschen sind durch das Virus in unterschiedlicher Art und Weise betroffen, da die Ressourcen für einen schützenden und rettenden Umgang damit ungleich verteilt sind.
Soziale Ungleichheitsverhältnisse zeigen sich jetzt in besonders zugespitzter Weise. Unterschiedliche Betroffenheit und Verletzbarkeit ist allerdings keineswegs zufällig disparat verteilt, sondern ein Effekt von sozialen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen. Konkret geht es dabei um die historischen und kontextuellen Verflechtungen von Geschlecht, Sexualität, sozialer Klasse, nationaler und ethnischer Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Alter – Faktoren also, die Einfluss haben auf die Frage, wem Schutz und Unterstützung zuteilwird mithilfe welcher Ressourcen Handlungsmöglichkeiten gefördert und strukturiert werden und welche Ansprüche als legitim gelten.
Im Kontext der Schwarzen Frauenbewegung wurde im Laufe der vergangenen 30 Jahre ein Ansatz entwickelt, der heute als theoretisches und heuristisches Konzept weltweit in der Geschlechter- und Ungleichheitsforschung etabliert ist, das Konzept der Intersektionalität. Im Folgenden werden wir erläutern, wie und warum wir Intersektionalität – nicht nur in der „Corona-Pandemie“ – für einen zentralen wissenschaftlichen, juristischen und politischen Zugang zur Analyse und Veränderung von Macht- und Ungleichheitsverhältnissen halten.
Intersektionalität
Die „intersektionale“ Perspektive richtet den Blick auf Kreuzungen (engl. „intersection“) und Wechselwirkungen verschiedener Un- gleichheitsverhältnisse. Entwickelt wurde dieser Ansatz, um soziale Platzanweiser wie „race“, „class“ und „gender“ in ihrer Verschränkung sichtbar zu machen. Bevor die Rechtswissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw 1989 den Begriff etablierte, hatten bereits andere Schwarze Akademikerinnen und Aktivistinnen, wie z. B. Angela Davis, Patricia Hill-Collins oder das Combahee-River Collective während und nach der Bürgerrechtsbewegung darauf hingewiesen, dass sich die Diskriminierung und Unterdrückung von Schwarzen Menschen nicht auf eine Kategorie reduzieren lässt, sondern in ihrer kategorialen Verflechtung wirksam wird. Dagegen, so ihr Argument, führt die monistische Betrachtung der Benachteiligung aufgrund von Geschlecht oder von sozialer Klasse oder von „Race“ oder von Sexualität dazu, dass interkategoriale Verbindungen und Verstärkungen unsichtbar (gemacht) werden. Auch eine Addition der Kategorien, so die Kritik, wird der spezifischen Form der Ausgrenzung und Diskriminierung nicht gerecht.
Intersektionalitätsdebatten werden mittlerweile in globalen feministischen wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen geführt. Mithilfe rassismuskritischer, post- und dekolonialer Perspektiven werden Analysen von komplexen Unterdrückungsverhältnissen vorgenommen, um auf dieser Grundlage Gerechtigkeitspolitiken zu erarbeiten, Handlungsstrategien und neue Methodologien zu entwickeln. Intersektional zu denken und zu handeln, ist dabei mehrfachbegründet: durch Ausschlüsse Schwarzer Frauen, durch das Antidiskriminierungsrecht und durch die Notwendigkeit einer Revision von wissenschaftlichen feministischen Politiken und Erkenntnistheorien. Den Mittelpunkt intersektionaler Ansätze bildet ein „doppelter Blick“ auf Unterdrückungsverhältnisse und Privilegien einerseits und auf die Bedeutung von Zuschreibungs-/ Othering-Prozessen andererseits. Letztere zeigen sich etwa in der Konstruktion der „Dritte-Welt-Frau“ oder der Figur der Migrantin als „unterdrückte andere“, als Gegenbild zur emanzipierten, westlichen Frau, mit deren Hilfe „Befreiung“ als Kernelement eines Feminismusverständnisses im Globalen Norden thematisiert werden konnte. Im Zuge seiner transatlantischen Reise wurden die relevanten Kategorien ergänzt, so dass heute neben Gender, sozialer Klasse, Race/ Ethnizität und Sexualität, auch Dis/ability, Nationalität/Zugehörigkeit, Religion, Alter und sozialer Raum berücksichtigt werden. Als Gegenstände intersektionaler Zugänge können die Ko-Konstitution von Macht- und Herrschaftsverhältnissen und die damit verbundenen Hervorbringungen von Subjektivierungsprozessen, Handlungsmöglichkeiten und -begrenzungen und ihre Folgen für individuelle Lebenslagen beschrieben werden.
Intersektionalität versteht Subjektpositionen als vermittelt durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Es geht dabei nicht um (selbstgewählte) Identitäten, sondern um Effekte dieser Verhältnisse (Heteronormativität, Sexismus, Rassismus, Nationalstaatlichkeit), um Normen, Rechte, Fremdpositionierungen und Erwartungen, die die Handlungsmöglichkeiten und Entfaltungsspielräume konkreter Menschen strukturieren. In der „Corona-Pandemie“ wurde durch die Grenzschließungen zwischen EU-Staaten (sogar innerstaatlich zwischen Bundesländern) eine scharfe Unterscheidung zwischen „uns Zugehörigen“ (Staatsbürger*innen) und „euch nicht Zugehörigen“ (Ausländer*innen) gezogen, die nicht nur zum Erliegen grenzüberschreitender Arbeitsmobilität führte und harte Eingriffe in grenzüberschreitende Lebensgemeinschaften nach sich zog, sondern auch dazu, dass viele Betroffene ihre Arbeit verloren. In England, den Vereinigten Staaten und Australien sind als Folge von verweigerten Bildungschancen, schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen sowie hohen Gesundheitsrisiken und schlechteren Behandlungsmöglichkeiten die Todesopfer unter Schwarzen Bürger*innen im Vergleich zu ihrem Anteil an der Bevölkerung unverhältnismäßig hoch. Überproportional ist die Infektionsrate unter Schwarzen Männern, worin die Gender-Dimension in ihrer Überschneidung mit anderen Faktoren sozialer Benachteiligung zum Ausdruck kommt. Intersektionalitätsanalysen können diese Zusammenhänge sichtbar machen und müssen folglich ein spezifisches Verständnis von Gesellschaft und Machtverhältnissen beinhalten.
Gesellschaftliche Strukturen und Prozesse bringen als symbolische, diskursive und materielle Verhältnisse Subjekte, Handlungsmöglichkeiten und oft genug auch Leidenserfahrungen hervor, die sich im Laufe von Biographien unterschiedlich entfalten. So können, wie sich in der Parole „Black is Beautiful“ der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den 1970er Jahren und dieser Tage in „Black-Lives-Matter“-Demonstration gegen Polizeigewalt zeigt, Fremdpositionierungen und Ausgrenzung in widerständige Akte – der Kniefall mit der gereckten Faust – umgedeutet werden; diskriminierte Individuen und Gruppen sind also dem rassistischen Diskurs und dem institutionalisierten Rassismus nicht vollständig unterworfen. Und mittlerweile gibt es auch Demonstrant*innen, die bei diesen Protesten darauf verweisen, dass sie sich aufgrund ihrer privilegierten Positionierung als weiße Männer und Frauen nicht in vergleichbarer Weise vor Polizeigewalt und brutalen Übergriffen schützen müssen. Hier zeigt sich, dass Differenzordnungen und Subjektpositionen prinzipiell infrage gestellt werden können; ob dies langfristig zur Zurückweisung rassistischer, sexistischer, heteronormativer Diskurse und Praktiken im Alltagshandeln führen wird, bleibt abzuwarten.
Intersektionalität im Kreuzfeuer? Kolloquien des CGC im SoSe2020 und WS 2020/21

„Intersektionalität“ ist kein in Stein gemeißeltes Theoriegebäude. Es ist ein lebendiges Konzept, das sich im Streit und durch politisch- wissenschaftliche Debatten verändert und erneuert. Wenn es um die Frage nach Ausschlüssen geht, stehen nicht nur die der „Anderen“ zur Diskussion, sondern der Blick wird auch auf Privilegien und gesellschaftliche Verhältnisse gerichtet. Anstöße zur Selbstkritik und Positionsbestimmung, weiterführende theoretische Reflexionen, die Schärfung des methodischen Instrumentariums und die interdisziplinäre/transdisziplinäre Auseinandersetzung mit und Zusammenführung von fachwissenschaftlichen Debatten stehen auf der Tagesordnung. „Differenzen“ sind keine beliebigen Unterschiede, sondern Unterscheidungen, die aufgrund der gesellschaftlichen und politischen Herrschaftsverhältnisse, in die sie eingebunden sind, einen Unterschied machen.
In der Kolloquiumsreihe des Cornelia Goethe Centrums werden aktuelle Debatten aufgegriffen, die sich sowohl auf den erkenntnistheoretischen Status von Intersektionalität als auch auf Potenziale und Grenzen für einzelne Disziplinen beziehen; darüber hinaus wird die Frage diskutiert, wer mit dem Intersektionalitätskonzept wie arbeiten kann. Im Wintersemester 2020/21 werden wir die Reihe mit Vorträgen, die im Sommersemester Corona-bedingt nichtstattfinden konnten, fortsetzen.
Von Bettina Kleiner, Helma Lutz und Marianne Schmidbaur
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 4.20 des UniReport erschienen.