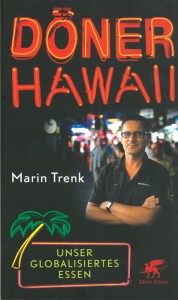 Der Ethnologe Marin Trenk untersucht in seinem neuen Buch »Döner Hawaii – Unser globalisiertes Essen« den Wandel unserer Essgewohnheiten und erläutert, wie kulinarische Fiktionen entstehen.
Der Ethnologe Marin Trenk untersucht in seinem neuen Buch »Döner Hawaii – Unser globalisiertes Essen« den Wandel unserer Essgewohnheiten und erläutert, wie kulinarische Fiktionen entstehen.
Herr Prof. Trenk, wie sind Sie als Ethnologe zum Thema Essen gekommen – sind Sie ein Hobby-Koch?
Nein, mit dem „gastrosexuellen“ Mann, wie man heute sagt, habe ich nichts zu tun. Ich koche eher wie eine gute Hausfrau: jeden Tag, wenn meine Zeit es zulässt. Das Interesse an Esskulturen ist auf Reisen und im Rahmen meiner Forschungen entstanden. Ich habe gemerkt, dass ich an fremden Kochtöpfen nur schlecht vorbeigehen kann. Ich esse nämlich nicht nur gerne, sondern frage auch gerne nach. 2004 besuchte ich Laos und Thailand. Da springt einen die Esskultur in den Straßen förmlich an. Das war für mich der Anstoß darüber nachzudenken: Was passiert eigentlich mit dem Essen in der globalisierten Welt?
Hat die Bedeutung von Kochen und Ernährung zugenommen, wo doch andererseits auch darüber geklagt wird, dass in vielen Haushalten Fastfood und Fertiggerichte dominieren?
Speziell in Deutschland wurde dem Essen noch nie so viel Bedeutung beigemessen wie heute. Aus unterschiedlichsten Gründen: aus gesundheitlichen, aus ethisch-moralischen, oder ganz einfach aus Freude am guten Essen, um so den kulinarischen Zivilisationsrückstand gegenüber unseren südlichen Nachbarn ein wenig zu überwinden. Was aber den Koch-Hype angeht: Viele lassen sich im Fernsehen gerne von einem Tim Mälzer bespaßen, verzehren dabei aber ungerührt ihre Tiefkühl-Pizza. Da mutiert die Kochshow eher zum Ersatz fürs eigene Kochen.
Sie unterscheiden „drei Wellen kulinarischer Globalisierung“: die des Kolumbus, mit Verbreitung der Kartoffel und des Mais von der Neuen in die Alte Welt; eine zweite, mit der Verbreitung einzelner Speisen und Gerichte; und schließlich eine dritte Welle, mit der globalen Verbreitung von kompletten Küchen wie der italienischen oder chinesischen.
Alle drei Wellen halten immer noch an, auch die nach Kolumbus benannte. So ist beispielsweise die Avocado erst vor wenigen Jahrzehnten bei uns angekommen. Die Leute standen damals im Supermarkt und rätselten, was man mit einer „Avocadobirne“ wohl machen könne. Das Entscheidende an dieser ersten Welle ist freilich, dass keine Rezepte ausgetauscht wurden. Keiner interessierte sich damals in Europa dafür, wie die Inka ihre Kartoffeln zubereiten oder welche Köstlichkeiten aztekische Köchinnen aus Mais, Tomaten und Chili zu zaubern verstanden. Erst im kolonialen Kontext wurden Rezepte ausgetauscht, in denen man die elementare Form des kulinarischen Lebens sehen kann. Und so kam etwa der Curry nach England oder Maggi nach Afrika. Mit der dritten Welle schließlich brachten Einwanderer ihre ganzen Küchen mit. Seither gibt es überall „Italiener“ und „Türken“, während man in Städten wie Frankfurt heute auf ein riesiges Angebot stößt, bis hin zu Nigerianisch oder Uigurisch.
Sie stellen fest, dass gerade die typischen regionalen Gerichte häufig eine Mischung aus Tradition und Fremdem darstellen – ist die „eigene“ Küche also eine Schimäre?
Was heute als „kulinarische Kernidentität“ verstanden wird, war den Menschen gestern noch fremd. Denke Sie an die Kartoffel oder neuerdings an Latte macchiato. Das vergessen die Leute, übrigens auf der ganzen Welt. Ich habe Thais getroffen, die es kaum fassen konnten, dass das für ihre Küche wichtige Chili aus Südamerika stammt. Wie auch die Papaya, Tomaten und Erdnüsse, ohne die es keinen Papaya-Salat gäbe. Die uns bekannte Thai-Küche ist kaum 200 Jahre alt.
Sie sprechen aber auch von „Ethno-Fantasy-Gerichten“ in manchen Innenstädten, von einem kulinarischen Disneyland. Anthing goes ist vielleicht nicht immer gut?
Aber auch nicht immer schlecht! Wenn ich von „Ethno-Fantasy-Gerichten“ spreche, dann denke ich an pseudo-asiatische Ketten wie Coa, MoschMosch oder Thai-Express. Ich bin kein Esskritiker, was ich kritisiere, ist nicht die Qualität des Essens. Und immerhin wird im Prinzip frisch gekocht, was ja schon mal nicht schlecht ist. Worauf ich als Ethnologe hinweisen möchte ist, dass es sich um kulinarische Fiktionen handelt. Das Ganze wird als Street Food verkauft, weil die Kundschaft anscheinend gerne den Eindruck des Authentischen haben möchte. Dabei wurden die meisten Gerichte eigens für uns erfunden, einige wie „Ente süß-sauer“ bereits vor über 40 Jahren im altmodischen Chinarestaurant.
Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf eine berühmte Episode mit Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl, der sich auf einer Dienstreise in China einmal etwas Süß-saures wünschte …
… und die Köche mussten sich erstmal beraten (lacht). „Schweinefleisch süß-sauer“ oder „Ente süß-sauer“ spielen in den chinesischen Esskulturen eine eher geringe Rolle, während in Deutschland diese Geschmacksnote seit Jahrhunderten beliebt ist, wie z. B. beim Rheinischen Sauerbraten. Auch Königsberger Klopse werden süß-sauer abgeschmeckt, die Weißwurst mit süßem Senf verzehrt. Und wie schmeckt ein altdeutscher Entenbraten mit Rotkohl und Preiselbeeren? Ente süß-sauer ist eben typisch deutsch. Im Chinarestaurant finden Deutsche den Geschmack wieder, den sie immer schon geschätzt haben. Das beschäftigt mich als Ethnologe: Wie übernehmen wir fremde Gerichte? Wir passen gewissermaßen alles unbewusst in unsere kulinarische Grammatik ein. Wir essen etwa gerne Gerichte mit Sauce, und darum wird auch unser Döner mit Sauce verzehrt.
Während das deutsche Bier im Ausland gerne getrunken wird, ist die deutsche Küche nicht gerade ein Exportschlager – warum eigentlich?
Ich würde da etwas widersprechen: Die deutsche Küche wird durchaus exportiert, auch wenn uns Deutschen das gelegentlich geradezu peinlich ist. Was aber als deutsche Küche im Ausland gilt, das sind ein paar bayerische Gerichte. Das könnte an dem unglaublichen Renommee des Oktoberfestes liegen. Für mich war in dieser Hinsicht Thailand der Augenöffner: Die Thais lieben deutsches Bier, die jungen Trendsetter in Bangkok mit Vorliebe Weißbier. Dazu essen sie dann eine deutsche Wurstplatte oder Schweinshaxe, natürlich mit Sauerkraut, das bekanntlich süß-sauer schmeckt.
Aber die Deutschen sind offensichtlich besonders gut darin, die heimische Küche zu vergessen.
Ja, wir pflegen eine Art kulinarisches Überläufertum. Deutsche Esstraditionen geraten in Vergessenheit und werden marginalisiert. Kein Uni-Empfang ohne Tiramisu oder Panna cotta, aber wo gibt es noch Kirschenmichel oder Götterspeise? Dafür gibt es gelegentlich abenteuerliche Fusionen, etwa „Tiramisu mit Pumpernickel“ (lacht). Hier in Frankfurt muss man nur den Main überschreiten und trifft in Sachsenhausen auf eine Vielzahl von traditionellen Äppelwoi-Lokalen. Aber nördlich des Weißwurst-Äquators ist das anders. Ich lebte früher in Hannover, wo man sich wirklich schwertut, deutsche Kost oder Regionales zu finden. Wie auch in Berlin gibt es kaum die alltägliche heimische Küche, die über Bulette oder Currywurst hinausgeht.
In Sven Regeners 80er-Jahre-Roman „Herr Lehmann“ wird ja deshalb der Schweinebraten in der Kreuzberger Markthalle als etwas Besonders gepriesen.
Während meines Studiums in Berlin war das für uns Studenten ein exotischer Ort, weil man dort sogar noch Eisbein essen konnte. Und gerade diese Markthalle ist heute interessanterweise die Hochburg der so genannten Foodtruck- und Streetfood-Bewegung, von der man sicher noch hören wird.
Wenn es Globalisierungsgewinner unter den Küchen gibt, dann darf man die Globalisierungsverlierer nicht unerwähnt lassen. Könnte man auch die jugoslawische Küche dazu zählen?
Ganz sicher, wobei die Küche meines Geburtslandes hierzulande nicht komplett verschwunden ist, sondern nur von den Innenstädten in die Vororte verbannt wurde. Beim Balkan-Grill standen immer die Fleischberge im Mittelpunkt – nicht mehr unbedingt das, was junge Leute anspricht. Was der Balkan-Küche am Anfang geholfen hat, nämlich die Nähe zur deutschen Küche, hat ihr am Ende eher geschadet. In der Nachkriegszeit war das eine erfreuliche, irgendwie vertraute Exotik. Und heute? Kein Discounter ohne Cevapcici im Tiefkühlfach.
Sie beklagen in Ihrem Buch, dass ehemals weit geschätzte Fleischsorten wie Innereien heute in Deutschland immer weniger auf Zuspruch stoßen. Es gebe eine „Invisibilisierung“, eine Unsichtbarmachung von Fleisch und seiner Herkunft.
Meine Studierenden zeigten in einer Befragung eine große Abwehrhaltung gegenüber Innereien: 75 % essen diese prinzipiell nicht, von den meisten haben sie noch nie probiert. Aber sie sind überzeugt, dass es einen „Innereiengeschmack“ gibt, vor dem sie sich ekeln. Da half auch meine verblüffte Frage „Wie schmeckt eigentlich Obst? Gibt es auch einen Obstgeschmack?“ wenig. Wie man als Ethnologe weiß, werden in fast allen Kulturen Innereien sehr geschätzt, gerade weil einige wahre Geschmackswunder sind. Doch in unseren Supermärkten taucht fast nur noch Muskelfleisch auf, kaum noch Innereien oder ein Ochsenschwanz oder gar ein
Kalbskopf. Man will anscheinend nicht an das Tier erinnert werden, daher dominieren zunehmend Hackfleisch und Chicken Nuggets.
Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang den bewussten Verzicht auf Fleisch, wie im Rahmen einer vegetarischen oder veganen Ernährung?
Ich sehe darin auch einen Entfremdungsprozess von Mensch und Tier. Denn Vegetarier weiten die grassierenden Speisetabus auf das ganze Tier aus, Veganer sogar auf dessen Produkte. Wenn ich allerdings eh’ nur noch geschmacksneutrale Putenbruststreifen auf dem Salat esse, dann wäre es nur konsequent, auf Fleisch zu verzichten. Denn Tofu schmeckt auch nicht anders. Dabei wird heute insgesamt nicht weniger Fleisch gegessen. Die Mehrzahl aber hält sich an Billigprodukte und ist dann entsetzt, wenn mal wieder durch einen Lebensmittelskandal herauskommt, was ihnen da aufgetischt wurde.
Sie sprechen ja auch von Massentierhaltung als Grund für diese Entfremdung. Sie prägen in Ihrem Buch den interessanten Spruch „Tiere achten und sie schlachten“.
Unseren bäuerlichen Vorfahren war es über Jahrtausende geläufig, respektvoll mit Tieren umzugehen. Schon bei den Wildbeuterkulturen fällt der respektvolle Umgang mit dem Jagdwild auf. Den lässt die Massentierhaltung freilich vermissen, wenn junge Puten unter ihrem Zuchtgewicht kollabieren oder einem Hühnerküken binnen 30 Tagen eine Brust angemästet wird, die bei einem Sumo-Ringer Erstaunen hervorrufen würde. Ich bin für Fleisch, es darf allerdings auch etwas weniger sein (lacht). Im ländlichen Balkan aufgewachsen, ist die Schlachtung eines Tieres für mich etwas relativ Normales. Auf Fleisch und Tierprodukte komplett zu verzichten, käme einem beispiellosen Kahlschlag unserer Esskultur gleich. [Die Fragen stellte Dirk Frank]













