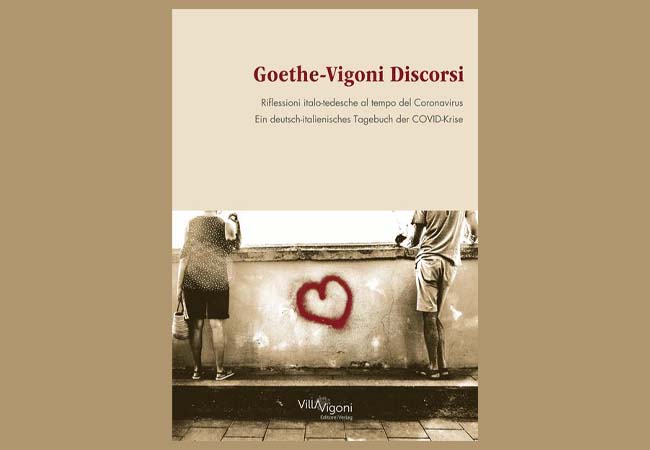Ein Beitrag von Prof. Dr. Sandra Eckert
Das neue Jahrtausend hielt für Europa bis dato jede Menge Herausforderungen parat: die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, eine Gefährdung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedstaaten, 2016 den Brexit und nun eine Pandemie. Die Krisenrhetorik wurde einmal mehr bemüht. Wieder war vom Schicksalsmoment für Europa die Rede.
Aus meiner Sicht wird die Krisenrhetorik überstrapaziert, zumindest dann, wenn es um das europäische Projekt geht. Ich will nicht in Abrede stellen, dass Covid-19 eine massive Krise herbeigeführt hat. Es ist auch richtig, dass in der unmittelbaren Reaktion auf diese ein Rückzug ins Nationale zu beobachten war. Europa war in der ersten Phase des Krisenmanagements kaum sichtbar, und gerade Italien fühlte sich als erstes massiv von der Pandemie betroffenes Mitgliedsland von der EU im Stich gelassen. Aber wir beobachten inzwischen einen Aufbruch nach Europa, und womöglich ist dies ein Aufbruch in ein neues Europa.
Ich forsche im dänischen Aarhus und war im März als Gastprofessorin nach Lyon eingeladen. Gerade hatte ich meine Lehrtätigkeit in Lyon aufgenommen, da erreichte mich die Nachricht des nationalen Lockdowns und der Grenzschließung Dänemarks. Frankreich ließ sich länger Zeit, dann wurden einschneidende Restriktionen verhängt. Auch Frankreich griff wie andere Mitgliedstaaten zum Mittel der Grenzschließung. In der unmittelbaren Reaktion auf die Ausbreitung der Pandemie in Europa konnten wir einen nationalen Reflex beobachten, der das Undenkbare möglich machte: nationale Grenzen innerhalb der Europäischen Union wurden für den Personenverkehr geschlossen. Auch der ungehinderte Verkehr von Gütern und Waren wurde durch die Grenzschließung erheblich erschwert. Zudem gab es temporär das Ansinnen von Mitgliedstaaten, auch Deutschland, den Export von als kritisch eingestuften Waren zurückzuhalten. Damit sind zwei Eckpfeiler europäischer Integration temporär ausgesetzt worden. Da die Grenzschließung weitgehend unkoordiniert und unilateral ablief, wurde mit Bezug auf eine Wiederöffnung der Grenzen der Ruf nach einer Abstimmung zwischen den europäischen Partnern lauter. Erneut gibt es aber ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Bleiben wir bei Dänemark: Restriktionen wurden aufgrund der Stagnation der Pandemie innerhalb des Landes frühzeitig aufgehoben, die Grenzschließung wurde aber bis auf wenige Ausnahmen beibehalten. Im Gegensatz dazu steht etwa Italien, das nach wie vor stärker von Covid-19 betroffen ist, aber besonders aufgrund der wirtschaftlichen Wichtigkeit der Tourismusbranche rasch eine Einreise wieder zuließ.
Die Historie dieser Grenzschließungen und Wiederöffnungen hat das Projekt Schengen auf eine Probe gestellt. Es stellt sich die Frage, ob man wieder vollständig zum Geist der offenen Grenzen in Europa zurückkehren kann. Wie bereits in der Flüchtlingskrise geschehen, hinterlässt der nationale Reflex für ein supranationales Projekt Blessuren. Paradoxerweise haben die national divergierenden Maßnahmen den Blick auf die Nachbarländer aber auch geschärft: Wie gehen Italien und Frankreich mit dem Virus um, warum sind Portugal und Griechenland weniger betroffen, welche Konsequenzen hat Schwedens Sonderweg? Die gemeinsame Erfahrung, zu Hause zu bleiben, hat eine neue Gemeinsamkeit gestiftet, geteilte LockdownErlebnisse sind ein verbindendes Element. Dass es nicht bei rein nationalen Antworten auf die Krise bleiben kann, ist schon aus ökonomischem Eigeninteresse das Gebot der Stunde. Europas Wirtschaft ist offen und exportorientiert, und das eben nicht nur im Binnenverhältnis der EU-Mitgliedstaaten. Gerade die „sparsamen Vier“ sind wie Deutschland offene Marktwirtschaften, die mittel- und langfristig hart von der Krise getroffen sein werden. Hinzu kommen zu diesem wohl noch länger andauernden Wirtschaftseinbruch die Kosten für nationale Auffangmaßnahmen. Zusätzliche Ausgaben für einen aufgestockten europäischen Haushalt und den EU-Wiederaufbauplan stoßen insofern in den Mitgliedstaaten, auch in Deutschland, nicht nur auf Gegenliebe.
Gerade die Menschen, die selbst stark vom wirtschaftlichen Einbruch betroffen sind, werden zunächst vor allem auf Hilfsmaßnahmen durch die eigene Regierung setzen und die Notwendigkeit gesamteuropäischer Solidarität als weniger prioritär ansehen. Auch wenn Deutschland bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen ist, sind auch hierzulande die Folgen gravierend. Hier bedarf es einer effektiven politischen Kommunikation, die dann erfolgreich sein kann, wenn sie die nationalen wirtschaftlichen Interessen in einen europäischen Zusammenhang stellt. Dies hat Angela Merkel zuletzt getan, und natürlich stößt sie hiermit innenpolitisch auch auf Widerstand. In jenen Mitgliedstaaten, in denen es derzeit an den fiskalischen Möglichkeiten für umfassende Rettungsmaßnahmen fehlt, richtet sich der Blick auf Europa.
Auch hier spielt verantwortungsbewusste Politik eine wichtige Rolle, und mitunter ist ein einmal gesetzter politischer und medialer Diskurs nur schwierig wieder einzufangen. Italien zeigt dies in einem besorgniserregenden Ausmaß. War das Land bereits in der Vergangenheit von einer politischen Vertrauenskrise vor allem bezüglich der nationalen Politik geprägt, so war die Mehrheit der italienischen Bevölkerung doch proeuropäisch eingestellt. Dies hat sich massiv verändert, da seit der ersten Wirtschafts- und Finanzkrise in diesem Millennium auch das Vertrauen in die supranationale Ebene signifikant abgenommen hat. Es wird hier entscheidend sein, wie die italienische politische Elite die europäischen Maßnahmen kommuniziert, aber es wird auch darauf ankommen, ob Italien über die politische und administrative Kapazität verfügt, um abrufbare europäische Mittel auch wirklich zu nutzen und zu verausgaben. Die Erfahrung mit der geringen Ausschöpfung von verfügbaren europäischen Strukturfondsmitteln deutet hier auf strukturelle Defizite hin.
In wenigen Wochen und Monaten hat sich das Verhältnis von Wirtschaft und Politik auf nationaler und europäischer Ebene massiv verändert. Die europäische Grundordnung setzt hier auf einen schlanken Staat, das Europarecht hat etwa die Liberalisierung von ehemals staatlichen Monopolen forciert. Genau diese Wirtschaftsordnung könnte nach der Krise zur Debatte stehen, zumal der ökonomische (und politische!) Liberalismus als Prinzip der europäischen und internationalen Grundordnung schon seit einiger Zeit zur Disposition gestellt wird. Auch deshalb wird man nicht ohne weiteres zur Situation vor der Krise zurückkehren können. Es wird eine verstärkte Nachfrage geben nach politischer Intervention, womöglich sehen wir eine neue Dekade von Nationalisierungen. Insofern stellt sich für die auf europäischer Ebene primärrechtlich verankerte Wirtschaftsordnung die Frage, ob diese mittel- und langfristig in der jetzigen Form Bestand haben wird. Die aktuelle Entwicklung etwa im Bereich der durch die Europäische Kommission genehmigten staatlichen Beihilfen zeigt, dass ein sehr politisches Verständnis von unabhängiger Wettbewerbspolitik vonnöten ist, um die umfangreichen Hilfsmaßnahmen zu ermöglichen. Der von Emmanuel Macron und Angela Merkel unterbreitete Vorschlag öffnet das Fenster zu einer neuen Phase europäischer Integration. Falls der Vorschlag Erfolg hat, würden den Mitgliedstaaten finanzielle Ressourcen im Rahmen des Wiederaufbaufonds zur Verfügung gestellt, um zu große Disparitäten in der Krisenbewältigung zu vermeiden. Zentrale Fragen wie die nach der Höhe des Fonds, seiner Zusammensetzung sowie den anwendbaren Kontrollmechanismen werden unter deutscher Ratspräsidentschaft zu verhandeln sein. Dies zeigt: Die Krise befördert neue Möglichkeiten.
Der „Wiederaufbau“ bietet Chancen für eine Neuausrichtung, etwa im Sinne des Green Deal oder der Digitalisierung. Bisherige Tabus können gebrochen werden, im positiven Sinne. Vieles, was uns selbstverständlich, ja unabdingbar schien, kann plötzlich auf den Prüfstand gestellt werden. Das kann der Aufbruch in ein neues Europa sein. Deutschland übernimmt zum 1. Juli die Ratspräsidentschaft. Das ist in vielerlei Hinsicht ein Glücksfall. Kein anderes Mitgliedsland ist wie Deutschland derzeit in der Lage, in Europa eine Führungsrolle und gesamteuropäische Verantwortung zu übernehmen. Mit dem deutsch-französischen Schulterschluss hat Angela Merkel als neue Ratspräsidentin bereits im Mai für diesen Neuaufbruch die Weichen gestellt. Gemeinsam mit der deutschen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der französischen EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird sie die Geschicke Europas für die kommende Dekade prägen.
Prof. Dr. Sandra Eckert, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften

Dieser Artikel erscheint in der Reihe Goethe-Vigoni Discorsi und ist zuerst am 13. Juli 2020 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht worden.