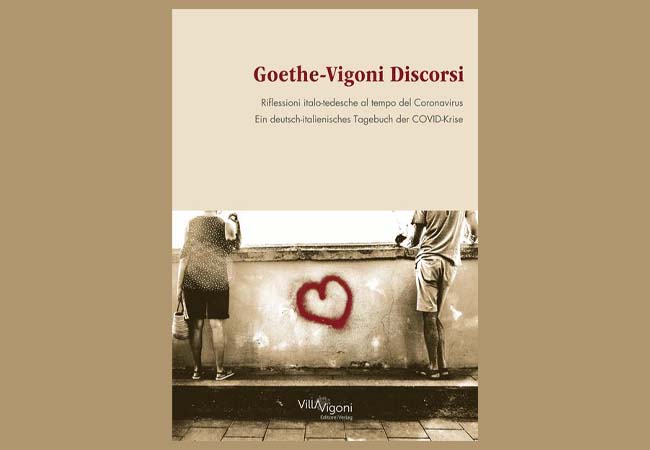Ein Beitrag von Christian Sewing
Die Corona-Pandemie hat bereits tiefgreifende Folgen, aber sie wird die Weltwirtschaft nicht völlig auf den Kopf stellen. Wichtige Trends, die sich bereits vor Corona abzeichneten, werden nicht gestoppt, sondern beschleunigt. Für Europa ist das eine große Herausforderung – aber auch eine Chance für einen Neustart.
Wissenschaftler haben immer wieder vor den Gefahren einer Pandemie gewarnt. Und doch hat Covid-19 fast alle unvorbereitet getroffen. Binnen weniger Wochen sah unser Leben ganz anders aus als vorher – inklusive der Arbeitswelt. Dabei erscheint es mir bis heute sehr erstaunlich, wie schnell wir uns an eine neue Realität gewöhnt haben. Im März spielte die Fußball-Bundesliga noch, das Berliner Konzerthaus, wo wir wenig später unser 150-jähriges Jubiläum feiern wollten, öffnete praktisch Abend für Abend seine Pforten. Und in meinem Kalender standen immer noch viele Reisen. Dann, fast von einem Tag auf den anderen, eine ganz andere Realität: nur noch Videokonferenzen statt Besuche, Bürotage in Frankfurt statt Nächte im Flieger, und unsere Jubiläumsfeier mussten wir absagen. Es war der radikale Abschied von vielem, was bis dahin planbar schien. Wenn es alle trifft, ist auf einmal normal, was zuvor undenkbar wirkte.
Und gleichzeitig erinnerte ich mich an die Finanzkrise 2008. In solchen Momenten geht man zurück, versucht Parallelen zu finden, aber eben auch Unterschiede. Waren die Banken 2007 und 2008 Auslöser der Krise, können sie nun Teil der Lösung werden. Weil wir unsere Bilanzen erheblich gestärkt haben und so Unternehmen über die Krise helfen können. Weil wir mitten drin sind, das Herz-Kreislaufsystem der Wirtschaft. Weil wir der Politik helfen können zu erkennen, wo Hilfe ansetzen muss. Uns war schnell klar: Der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft würde außergewöhnlich wichtig sein. Deshalb haben wir unsere Unterstützung angeboten. Und sie wurde gerne angenommen.
Dabei wussten Politiker und Notenbanker nur zu genau, was drohte, wenn sie nicht schnell handeln würden. Fast alle Regierungen und Notenbanken haben das Richtige getan, indem sie dem System Sauerstoff, sprich Geld, zugeführt haben. Entschlossen und schnell. Das verdient Respekt. Deutschland war hier sicher ein Paradebeispiel.
Was allerdings fehlte, war eine europäische Antwort auf die gesundheitlichen Herausforderungen der Pandemie. Europa hat hier zunächst eine Chance verpasst. Die Chance, füreinander einzustehen und wieder näher aneinander zu rücken. Stattdessen dominierten gerade in der Anfangsphase die nationalen Lösungen – wenn wir von wenigen Hilfsaktionen absehen. Wir hätten mehr Solidarität zeigen müssen, als die Covid-19-Pandemie die Lombardei mit voller Wucht traf. Wir hätten gemeinsam in Krankenhauskapazitäten und Prävention investieren sollen – als Zeichen dafür, dass wir ein Europa sind. Anschließend hätten wir immer noch Zeit gehabt, um über Eurobonds zu streiten.
Daraus muss Europa lernen und gemeinsam die zweite Phase anpacken. Während die akute Corona-Bedrohung abflaut und die Länder Europas unterschiedlich gut darauf reagiert haben, geht es nun darum, möglichst schnell aus der Wirtschaftskrise herauszukommen. Es geht um Geld- und Fiskalpolitik. Aber auch darum, dass Europa sich den tiefgreifenden Trends stellt, die durch Corona noch beschleunigt werden.
Das gilt zum Beispiel für die Globalisierung. Hier wurde in den vergangenen Monaten eine jähe Kehrtwende vorhergesagt – angesichts der Herausforderungen für Lieferketten und Absatzmärkte. Ich sehe das anders: Natürlich werden manche Konzerne ihre Wertschöpfungsketten neu ordnen, um sie weniger störanfällig zu machen. Manche Geschäftsbeziehungen, die in der Pandemie zerbrochen sind, werden nicht wiederhergestellt werden.
Aber die internationale Arbeitsteilung an sich ist keine Mode-Erscheinung. Sie hat sich durchgesetzt, weil sie gewaltige wirtschaftliche Vorteile bringt. Weil Unternehmen erfolgreicher sind, die die jeweiligen Vorteile verschiedener Standorte nutzen. Weil die Globalisierung unterm Strich zu mehr Wohlstand für mehrere Milliarden Menschen geführt hat – auch wenn wir nicht besonders gut darin waren, diese Gewinne gerecht zu verteilen. Und weil die Globalisierung zu dem Lebensstil passt, den sich heute viele Menschen wünschen. Dabei denke ich nicht nur an die globale Elite in Politik und Unternehmen, für die Internationalität der Normalfall ist. Gut gebildete junge Erwachsene sind zu Hause in einer digitalisierten Welt, sie sind es gewohnt, sich über soziale Medien international zu vernetzen. Englisch ist für sie längst die zweite Alltagssprache geworden. Sie werden ihren Horizont nicht auf einmal wieder an den Landesgrenzen enden lassen.
Ich bin fest davon überzeugt: Diese mächtigen Kräfte werden die Globalisierung am Leben halten – mag der Trend im Augenblick auch noch so geschwächt wirken. Für ein Unternehmen wie die Deutsche Bank, gerade aber auch für die deutsche Exportwirtschaft, wird die entscheidende Arena der Weltmarkt bleiben.
Auch wenn dieser anders aussehen wird. Wir stehen vor der wichtigsten Zäsur seit Beginn der modernen Globalisierung in den 90er Jahren. Das liegt nicht nur, aber auch an Corona. Entscheidend sind vor allem zwei Entwicklungen: die zunehmende Konfrontation in der Wirtschaftspolitik – und die unaufhaltsame Digitalisierung. Europa wird auf Dauer kein starker Faktor in der Weltpolitik bleiben, wenn es sich hier nicht geschickt positioniert und den Herausforderungen stellt.
Im Moment geht vieles an Europa vorbei. Dreh- und Angelpunkt der globalen Konfrontation ist das Verhältnis zwischen China und den Vereinigten Staaten. Mochte man Anfang des Jahres noch auf eine zumindest vorübergehende Entspannung hoffen, so hat Covid-19 den Konflikt der beiden Wirtschaftssupermächte nur noch forciert. Dabei geht es nicht allein um die burschikose Rhetorik des amerikanischen Präsidenten: Selbst bei einem demokratischen Wahlsieg im Herbst wäre klar, dass die USA auch künftig China als wichtigsten wirtschaftlichen und geopolitischen Rivalen ansehen werden. Es ist eine Grundhaltung des Misstrauens und der Konkurrenz, die das Klima der amerikanischen Handels- und Wirtschaftspolitik prägt. China wiederum – dem Status einer verlängerten Werkbank für den Westen längst entwachsen – fällt weniger durch laute Töne auf als vielmehr durch einen schleichenden, aber wohlkalkulierten Ausbau der eigenen Machtposition.
Wir Europäer sind in diesem Konflikt nicht vollkommen neutral, und wir sollten es auch nicht sein. Wenn wir eine liberale Gesellschaft bleiben wollen, muss im Zweifel Atlantikbrücke vor Seidenstraße gehen. Und dennoch werden wir nicht umhin kommen, uns selbst stärker mit einer eigenen Position zu behaupten. Denn künftig wird die Weltwirtschaft weniger homogen sein, als es das Regelwerk einer schon weitgehend marginalisierten Welthandelsorganisation vorsieht. Wenn internationale Regeln und Institutionen an Bedeutung verlieren und in Wirtschaftsfragen immer öfter das Recht des Stärkeren gilt, dann müssen wir alles daran setzen, dass wir nicht das schwächste Glied im globalen Trio werden.
Wir Unternehmen wiederum müssen uns auf einen Flickenteppich bei der Globalisierung einstellen. Was meine ich damit? Firmen werden auch weiterhin international arbeiten. Sie werden sich aber aus Risikoaspekten stärker diversifizieren müssen, und sie dürfen in ihrer Lieferkette nicht mehr so abhängig von wenigen Märkten sein. Manch eine Firma musste in der Krise feststellen, dass alle ihre Zulieferwege doch irgendwie durch China führten.
Die fragmentierte Globalisierung hat aber auch starken Einfluss darauf, wie Unternehmen in einzelnen Ländern agieren. Statt auf einen Weltmarkt müssen wir uns auf eine Vielzahl von lokalen Märkten einstellen – lokale Märkte, auf denen wir auch wie lokale Unternehmen auftreten müssen. Wir müssen besser darin werden, uns schnell auf nationale Besonderheiten einzustellen.
In einer solchen Welt ist es essenziell und ein besonderer Wettbewerbsvorteil, wenn unser Heimatmarkt nicht Deutschland, Italien, Frankreich oder Spanien ist, sondern Europa. Das Potenzial dazu haben wir: Auf dem Papier sind wir der zweitgrößte Binnenmarkt der Welt – wir nutzen ihn nur noch nicht gut genug. Weil etwa die Dienstleistungsfreiheit bisher noch unterentwickelt ist. Und weil Grenzkontrollen in der Pandemie selbst das ins Wanken bringen, was Europa in den vergangenen Jahrzehnten auszeichnete – den freien Waren- und Personenverkehr. Diese Rückschritte müssen wir schnell wieder durch eine kräftige Vorwärtsbewegung ablösen – weil wir einen vollständigen Binnenmarkt jetzt dringender brauchen denn je.
Das ist auch die Voraussetzung, um in einem disruptiven Trend bestehen zu können, der durch Corona noch beschleunigt wird: Die Digitalisierung wird die Gesellschaft so grundlegend umwälzen wie einst die industrielle Revolution – vermutlich aber in einem viel schnelleren Tempo. Nur wer an der Spitze dieser technologischen Revolution steht, wird in 20, 50 und 100 Jahren noch eine Chance haben, ganz vorn in der Weltwirtschaft mitzuspielen. Und das sind bisher nicht die Europäer, sondern vor allem die USA und China.
Wir sprechen hier von tektonischen Veränderungen, wie wir sie in der Weltgeschichte immer wieder mal erlebt haben. China war über Jahrhunderte die größte Volkswirtschaft der Welt. Auf sie entfiel zu Beginn der Neuzeit im 16. Jahrhundert rund ein Viertel des globalen Bruttoinlandsprodukts. Erst Ende des 19. Jahrhunderts eroberte die US-Wirtschaft den Spitzenplatz. Dabei wurden Amerika und Westeuropa vor allem deshalb so wohlhabend, weil sie bei der Transformation von der Agrar- zur Industriegesellschaft die Vorreiter waren. Ein Vorsprung, der sich über Jahrhunderte gehalten hat.
Jetzt stehen wir aber wieder an einem Wendepunkt. Das aber heißt: Wir Europäer müssen in der Datenwirtschaft schnell aufholen. Dafür müssen wir weitaus mehr als bisher investieren. Wie gut gerüstet Europa für diese neue Epoche sein wird, hängt entscheidend davon ab, wie viele Technologiekonzerne es hervorbringt. Das setzt einen gesetzlichen Rahmen voraus, der nicht zu allererst reguliert, sondern Innovationen ermöglicht. Wir brauchen die Infrastruktur dafür: Die Industrialisierung gelang nur dort, wo es zuerst Eisenbahnen und später gute Stromnetze gab. Und das nötige Wissen – deshalb ist es mindestens ebenso wichtig, dass wir unsere Talente halten und weitere für uns gewinnen. Aus Europa stammen ähnlich viele Experten für Künstliche Intelligenz (KI) wie aus den USA – doch ein Großteil arbeitet nicht hier. Stattdessen sind heute fast 60 Prozent aller KI-Forscher weltweit in den Vereinigten Staaten beschäftigt, in Europa hingegen nur 10 Prozent.
Dabei fällt die technologische Revolution des 21. Jahrhunderts zusammen mit einer weiteren epochalen Herausforderung. Die Kohlenstoff-intensive Wirtschaft, wie wir sie seit mehr als 200 Jahren kennen, hat keine Zukunft mehr. Wir müssen nachhaltiger leben und wirtschaften, um beim Klimawandel eine Trendwende zu erreichen. Auch dafür brauchen wir neue Technologien, und der Wettlauf ist längst in vollem Gange. Elektroautos sind das prominenteste Beispiel, auch hier liegen eher asiatische und amerikanische Entwickler vorn. Doch anders als in der Datenwirtschaft ist dieses Rennen noch längst nicht entschieden, und in anderen Bereichen fängt es gerade erst an – zum Beispiel beim grünen Wasserstoff, von dem wir uns in Deutschland viel versprechen. Letztendlich geht es hier aber eben nicht bloß um Wettbewerb, sondern um globale Kooperation und Koordination. Und da werden wir unser Ziel erst erreichen, wenn Europa nicht nur Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit ist, sondern auch sein ganzes Gewicht in die Waagschale wirft, um seiner Position international Nachdruck zu verleihen.
Damit sind die Trends der Zeit nach Covid-19 eine große Herausforderung für Europa – aber auch eine Chance. Wenn wir unseren Platz in der Weltwirtschaft und letztlich auch unseren Lebensstandard sichern wollen, dann müssen wir zusammenstehen – nationale Alleingänge werden uns im globalen Kräftemessen mit den USA und China schwach aussehen lassen.
Vielleicht hat die Covid-19-Pandemie hier tatsächlich eine positive Folge. Weil sie uns die Bedeutung europäischer Lösungen vor Augen führt. Weil sie uns aufgerüttelt hat aus dem kleinteiligen Streit rund um den Brexit und aus dem Dauerkonflikt um die scheinbar unlösbare Flüchtlingsfrage. Die Corona-Krise zeigt uns eindrucksvoll, dass wir Europäer einander brauchen. Sicher, es wird nicht trivial, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und die verschiedenen Kulturen, Stärken und Schwächen miteinander zu verbinden. Das wird nur gelingen, wenn wir uns auf den Kern dessen besinnen, was uns verbindet. Auf die Stärke einer stabilen Demokratie mit einer sozialen Marktwirtschaft, die ordnungspolitischen Prinzipien folgt, die sich bewährt haben. Genau darin könnte die neue Vision, das neue Narrativ für Europa liegen – im Kontrast zum chinesischen und amerikanischen Modell.
Die Europäische Union entstand nach der größten politischen und humanitären Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Nun sehen wir uns mit der größten Gesundheits- und Wirtschaftskrise des jungen 21. Jahrhunderts konfrontiert. Wir können uns damit abfinden, dass es doch die Nationalstaaten sind, auf die es in schweren Zeiten ankommt. Oder wir können diese Krise als Chance begreifen, die sich nicht oft bietet. Die Chance, als Europäer wieder zusammenzufinden und an einer gemeinsamen Zukunft zu bauen.
Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank

Dieser Artikel erscheint in der Reihe Goethe-Vigoni Discorsi und ist in einer leicht abgewandelten Version zuerst am 04.09. 2020 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht worden.