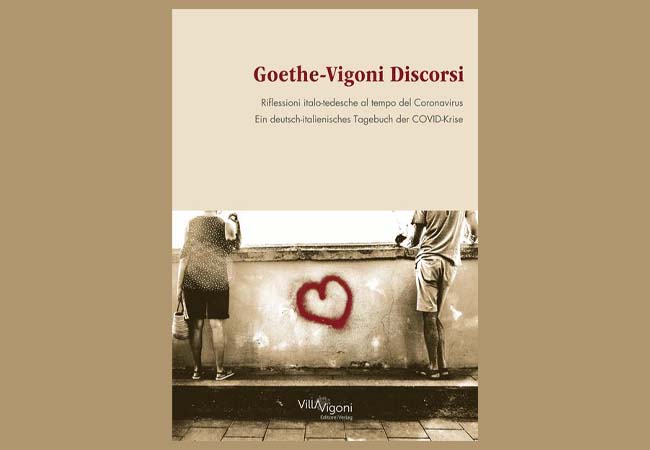Ein Beitrag von Franz Fischler
Europa steht vor großen Herausforderungen, denen die Mitgliedstaaten nur gemeinsam effektiv entgegentreten können. Fast jede und jeder, die oder der sich mit Stolz und auch einem gewissen Kampfgeist Europäer oder Europäerin nennt, hat diesen oder ähnliche Sätze unzählige Male gehört und sogar selbst oft gesagt oder geschrieben. Der Satz ist wahr, doch hat er selten eine Wirkung auf das, was dann tatsächlich in Europa passiert. Die Problemanalyse gelingt auf diesem Kontinent geradezu allen. Egal, welche Schlussfolgerungen verschiedene politische Gruppierungen daraus ziehen, so stimmen doch die meisten darin überein, dass das, was wir die Europäische Union nennen, nicht in der Lage ist, gewünschte Ergebnisse und Lösungen bei ebenjenen Themen zu erzielen, bei denen wir es von ihr erwarten.
Bürger und Bürgerinnen überall in der Europäischen Union zweifeln an der Fähigkeit und noch mehr am Willen der europäischen Entscheidungsträger, nachhaltige und faire Lösungen zu schaffen, weil sie immer und immer wieder sehen, dass die hochtrabend als die „großen Herausforderungen“ beschriebenen tiefgreifenden Probleme nicht mit befriedigenden Antworten versehen werden. Digitalriesen zahlen in Europa im Vergleich zu kleineren Betrieben immer noch keine fairen Steuern, es gibt keine EU-weite Lösung für die Migrationsthematik, das Wohlstandsgefälle zwischen West und Ost und Nord und Süd wird nicht geringer, und wann immer auf der Bühne der internationalen Politik großes Unrecht geschieht – denkt man an den Krieg in Syrien, Chinas Vorgehen gegen die Uiguren, die Errichtung eines autoritären Staates in der Türkei oder die Regenwaldvernichtung in Brasilien –, hat die EU nichts parat als Appelle zur Deeskalation. Man kann es Menschen kaum verübeln, wenn sie den Glauben an das europäische Projekt mitunter verlieren.
Die Welt und vor allem Europa waren schon vor Corona nicht in Ordnung. Seit Jahren treten wir auf der Stelle und verlieren bei bestimmten Themen, wie etwa beim Kampf gegen den Klimawandel, wertvolle Zeit, in der ein Schaden entsteht, den wir wahrscheinlich nie wiedergutmachen können. Durch die Pandemie und ihre Folgen sehen wir nun all unsere Schwierigkeiten und Probleme mit dem Set-up unserer Union wie durch ein Vergrößerungsglas. Die Corona-Krise erzeugte noch mehr Druck auf die ohnehin bereits Geschwächten, ließ Menschen, die bereits um ihr ökonomisches Überleben kämpften, vor dem völligen Nichts stehen, ließ die Einsamen noch einsamer, die Wütenden noch wütender werden.
Am deutlichsten spürten wir das viele Schlechte, das auf uns zukam, in unserem Alltag. Wir konnten auf einmal nicht gehen, wohin wir wollten, konnten Freunde nicht umarmen, nicht wie gewohnt unseren beruflichen Tätigkeiten und Freizeitbeschäftigungen nachgehen. Viele Menschen hatten und haben immer noch Angst um ihre Gesundheit oder die ihrer Liebsten. In regelmäßigen Abständen werden uns von der Politik Verhaltensregeln mitgeteilt, die kaum jemand hinterfragt und selten wer kritisiert. Es fällt einem keine Situation ein, die die Völker der Welt und jeden Einzelnen von uns so geeint hinter einem gemeinsamen Ziel versammelt hat. Die Bekämpfung des Hungers in der Welt hat bisher nicht zu so einer Einigkeit geführt und auch nicht der Wunsch nach nuklearer Abrüstung, Weltfrieden oder der Kampf gegen den Klimawandel. Dabei geht es bei all diesen Fragen langfristig gesehen um die Rettung von noch viel mehr Menschenleben.
Nationale Egos überwinden
Woran liegt das? Möglicherweise daran, dass bei dieser Krankheit auch die Reichen sterben, wenn die Armen sich in großer Zahl infizieren. Faith Osier, eine kenianische Malaria-Immunologin, die am Universitätsklinikum Heidelberg forscht, wies im Rahmen der „Black Lives Matter“-Bewegung auf eines hin: Man kann den Wert, den wir als Weltgesellschaft einzelnen Leben beimessen, zum Beispiel an den Summen ablesen, die wir in die Forschung investieren, um gewisse Krankheiten zu heilen. Wohlhabende Menschen des Westens oder globalen Nordens etwa sterben selten an Malaria, denn man kann die Prophylaxe-Tabletten bei uns in der Apotheke kaufen. Wenn Hunderttausende schwarze Menschen in Afrika daran sterben, so hat das keine Auswirkung auf die Gesundheit des europäischen Mittelstandes. Haben jedoch die Armen auf dem ganzen Globus eine Krankheit, die sich rasend schnell verbreitet und keinen Unterschied zwischen Arm und Reich macht, dann ruft das Geldgeber auf den Plan und eine Lösung soll so schnell wie möglich gefunden werden.
Wenn man darüber nachdenkt, wird man sich ein wenig wundern, dass in dieser Welt überhaupt Fortschritte gelingen, ohne dass die Menschheit Angst vor ihrer Ausrottung hat. Muss Europa wirklich seinem Untergang ins Auge sehen, um alles daranzusetzen, jene Probleme, die so oft beschrieben werden, tatsächlich zu lösen? Das kann leicht schiefgehen, doch es sieht ganz danach aus, als müsste uns die Angst tief in den Knochen sitzen, damit nationale Egos und persönliche Eitelkeiten politischer Führungsfiguren überwunden werden, um die Dinge zu verbessern.
Gleichzeitig haben wir als Gesellschaft oft kein gutes Langzeitgedächtnis. Eine Katastrophe kann uns noch so sehr in unseren Fundamenten erschüttern, wenn sie irgendwie überwunden wird, dann ist sie auch bald wieder vergessen. Der Zweite Weltkrieg hat die Worte „Niemals wieder“ zu einem integralen Teil unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses gemacht – das würden wohl die meisten von uns unterschreiben. Dennoch ist es weder gelungen, den Antisemitismus in Europa für immer in die Schranken zu weisen, noch wurde während der Balkankriege der Völkermord an den bosnischen Muslimen verhindert. Und auch der Schock, den die Berichterstattung über jene dunklen Stunden Europas bei vielen von uns verursacht hat, sitzt nicht mehr tief genug, um heute all jene europaweit abzuwählen, die Hass schüren und auf dem Rücken von Sündenböcken Politik machen.
Viele Dinge, die das Leben und die Freiheit von Menschen gefährden, existieren in Europa völlig unabhängig und schon lange vor der Pandemie; denn schon die Welt vor Corona ist keine romantische gewesen. Diese Krise hat uns vielmehr gezeigt, dass die Frist, die zur Lösung der anstehenden Probleme unseres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens zur Verfügung steht, noch kürzer geworden ist.
Der blanke Hohn
Seit einem Jahrzehnt gibt es immer wieder Menschen, die sagen, Europa brauche ein neues Narrativ, dann könnten die Menschen wieder daran glauben. Wenn jedoch bei der Implementierung keine Meter gemacht werden, helfen auch der größte Traum und das schönste Narrativ nichts. Die Europäische Union ist als Gebilde weder gut noch schlecht. Sie ist ein Instrument, das uns dabei helfen kann, gute oder schlechte Politik für Hunderte Millionen EinwohnerInnen zu machen. Dafür ist es notwendig, dass wir endlich anfangen. Reparieren wir kleine und große Dinge, eines nach dem anderen, und bleiben wir dabei geistig wendig und hartnäckig. Als zum Beispiel eine europäische Lösung der Migrationsthematik von jenen blockiert wurde, die einen verbindlichen Schlüssel ablehnten, nach dem Asylberechtigte auf die Mitgliedstaaten verteilt werden sollten, hat man dieses Thema anscheinend aufgegeben. Eine Zeitlang grassierten noch andere Ideen, etwa, dass jene, die keine Asylberechtigten aufnehmen wollen, ihre europäische Solidarität durch finanzielle Leistungen an die Aufnahmestaaten oder in der Entwicklungszusammenarbeit ausgleichen. Doch nicht einmal davon ist heute noch die Rede.
Ein anderes Beispiel ist die Frage nach einer europäischen Digitalsteuer. Während sich grundsätzlich alle einig zu sein scheinen, dass große Digitalkonzerne, die meisten davon sind keine europäischen Firmen, in Europa gerechte Steuern zahlen sollten, blockieren hier jene, die sich als Standort einen Vorteil davon erwarten, wenn sie diesen Konzernen keine fairen Steuern zumuten. Für den Bürger oder die Bürgerin, der oder die ein kleines Unternehmen betreibt, ist das der blanke Hohn.
Nicht zuletzt kann man dasselbe Phänomen bei den Verhandlungen um einerseits den sogenannten Wiederaufbaufonds der EU für die Zeit nach Corona und den Mehrjährigen Finanzrahmen beobachten. Die Nettozahler-Staaten sind um eine Vergrößerung ihrer eigenen Rabatte bemüht, denn sie wollen nicht für die schwächeren Staaten bezahlen müssen. Das ist eine Position, die man vertreten kann. Jedoch stellt sich die Frage, wie weit damit zu gehen man bereit ist. Bezahlen die wohlhabenderen Staaten nämlich irgendwann nur noch für Grenzschutz und Dinge, die ihnen wirtschaftlich in die Karten spielen, so ist die Union nicht nur keine Union mehr, sondern sie wird auch nie gewappnet sein, Lösungen für all jene Probleme zu finanzieren, die von Wien bis Madrid, Stockholm und Sofia jeder nennen kann und gelöst haben möchte.
Europa steht vor großen Herausforderungen, denen die Mitgliedstaaten nur gemeinsam effektiv entgegentreten können. Der Satz scheint abgedroschen und mag für viele Menschen keine Bedeutung mehr haben, dennoch ist er wahr. Dafür ist es aber notwendig, dass wir unseren Regierungen einiges mehr abverlangen, als wir es heute tun. Sie sollen in der Lage sein, Kompromisse einzugehen, und dabei das Wohl Europas und aller seiner Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen. Wird ein Problem beim Treffen der Regierungschefs in Brüssel nicht gelöst, so muss weiterverhandelt werden, in andere Richtungen gedacht und aufeinander zugegangen werden. Denn behandelt man eine offene Wunde nicht richtig, so vergiftet sie nach und nach den ganzen Körper und führt im schlimmsten Fall zum völligen Systemzusammenbruch. Ein Kanzler oder eine Kanzlerin, die von einem Gipfel in ihren Heimatstaat zurückkommen und sagen: „Eine Einigung ist nicht möglich“, sollte daher von den Wählerinnen und Wählern auf die Reise geschickt werden mit der Botschaft: Bitte versuchen wir es noch einmal und danach ein weiteres Mal, denn keine Lösung ist für uns WählerInnen keine Option.
Franz Fischler ist ÖVP-Politiker und war von 1989 bis 1994 österreichischer Bundesminister, von 1995 bis 2004 EU-Kommissar für Landwirtschaft. Heute ist er Präsident des Europäischen Forums Alpbach.

Dieser Artikel erscheint in der Reihe Goethe-Vigoni Discorsi und ist zuerst am 30. Juli 2020 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht worden.