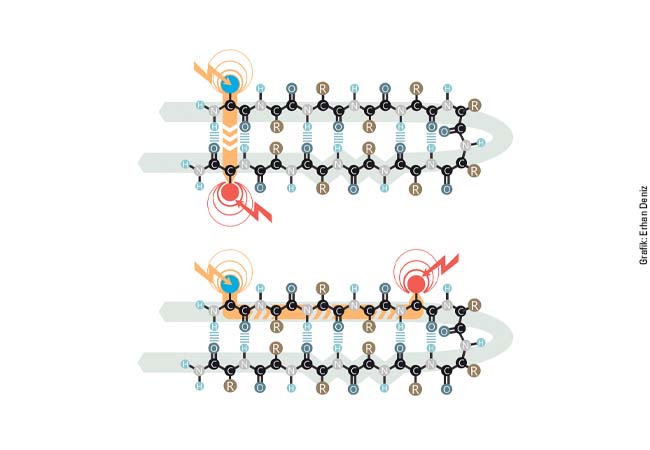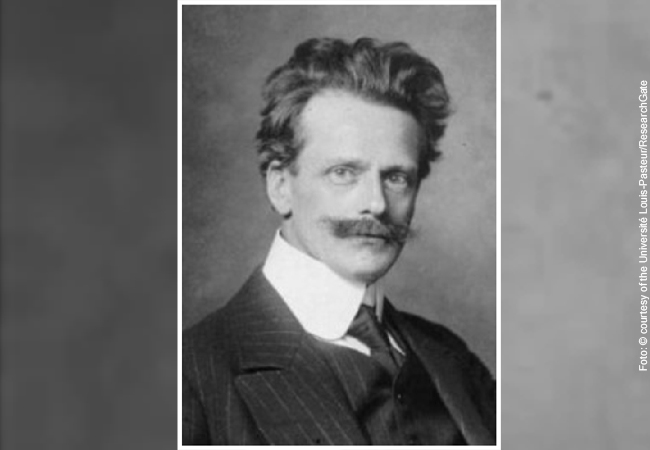
(Foto: © courtesy of the Université Louis-Pasteur/ResearchGate)
Auf den ersten, oberflächlichen Blick wirkt diese handverlesene Schar von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie aus der Zeit gefallen: Die „Wissenschaftliche Gesellschaft an der Goethe-Universität“ ist in ihrer heutigen Rechtsform 90 Jahre alt, also nur wenig jünger als die Universität, der sie nahesteht. Sie beschreibt sich selbst auf ihrer Website als Zusammenschluss von „Gelehrten“, als Ziel nennt sie die „Pflege der Wissenschaften“ – kein Wort von „exzellenter Spitzenforschung an vorderster Front“, vom „nationalen und internationalen Wettstreit um die besten Köpfe“, von „allerneuesten technologischen Entwicklungen“.
Ihre Aufnahmekriterien sind äußerst streng: Es wird nicht einfach Mitglied, wer sich für Wissenschaft interessiert. Es wird noch nicht einmal automatisch Mitglied, wer den Ruf auf eine Professur an der Goethe-Universität angenommen hat. „Zwar sind die meisten unserer Mitglieder Professorinnen und Professoren der Goethe-Universität“, sagt Herbert Zimmermann, emeritierter Professor für Neurowissenschaften und Vorsitzender der Wissenschaftlichen Gesellschaft, „aber das ist keine Voraussetzung – wir haben beispielsweise Mitglieder aus dem Städel und der Römisch-Germanischen Kommission sowie von anderen hessischen Universitäten.“
Dennoch selektiere die Gesellschaft bei der Aufnahme neuer Mitglieder sehr stark, stellt Zimmermann klar und erläutert das Prozedere: „Jedes unserer Mitglieder kann andere Wissenschaftler vorschlagen, die sie oder er für geeignet hält.“ Der Vorstand filtere die Vorschläge und hole zwei Gutachten über die Kandidatin, den Kandidaten ein, von anderen Mitgliedern ebenso wie von externen Sachverständigen. „So können unsere Mitglieder beurteilen, ob die wissenschaftliche Leistung der, des Vorgeschlagenen wirklich eine Erweiterung und Vertiefung unseres Wissens darstellt – das fordert unsere Satzung“, fährt Zimmerman fort; anschließend stimmten die Mitglieder über die Aufnahme ab.
Begrenzte Mitgliederzahl
Derzeit sind es 89 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieses Prozedere „erfolgreich durchlaufen“ haben. Satzungsgemäß können noch 11 dazukommen, weil die Anzahl der Mitglieder auf 100 begrenzt ist. Diese Regel habe schon lange Zeit bestanden, als er selbst sich der Wissenschaftlichen Gesellschaft angeschlossen habe, sagt Zimmermann, „vermutlich wurde sie eingeführt, damit der Kreis der Teilnehmer übersichtlich bleibt und die einzelnen Mitglieder sich aktiv in die Gesellschaft einbringen.“
Sie treffen sich (außerhalb der Semesterferien) einmal im Monat, und eine/einer von ihnen spricht über einen selbstgewählten Aspekt des eigenen Spezialgebietes. „Dabei sollen die Vortragenden so sprechen, dass die Mitglieder anderer Fachrichtungen verstehen, wovon die Rede ist. Im Anschluss an den Vortrag soll sich schließlich eine Diskussion über das Gehörte ergeben“, kommentiert Zimmermann. Zum Beispiel erinnert sich die Jura-Professorin Katja Langenbucher daran, wie sie ankündigte, über das „Insiderhandelsverbot“ sprechen zu wollen, also über ein kapitalmarktrechtliches Thema, dem die anderen Mitglieder zunächst ausgesprochen skeptisch begegneten. Ihr Vortrag sei dann aber sehr gut aufgenommen worden und habe den Auftakt zu einer langen Diskussion gebildet.
„Wir spezialisieren uns mit unserer Forschung immer mehr“, gibt Langenbucher zu bedenken. Umso wichtiger findet sie den interdisziplinären Austausch, den die Wissenschaftliche Gesellschaft anregt, und stimmt darin mit dem Philosophie-Professor Marcus Willaschek überein. Der ist begeistert über die Möglichkeit, mit interessanten Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern ins Gespräch zu kommen – im regulären Uni-Alltag bleibe nur wenig Zeit, über den Tellerrand des eigenen Fachs hinauszuschauen: „Es ist toll, auf diese Weise Fächer kennenzulernen, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt“, sagt Willaschek. Zum Beispiel habe ihn fasziniert, was kürzlich die Mykologin Meike Piepenbring über Pilze und die mykologische Forschung in Afrika berichtet habe.
Einheit und Eigenständigkeit
Auch diese empfindet es als bereichernd, durch die Vorträge und Diskussionen Einblicke in Disziplinen jenseits des eigenen Spezialgebiets zu erhalten. Für erfolgreiches Publizieren und das Einwerben von Drittmitteln sei es nun mal unabdingbar, auf einem eng abgesteckten Wissensgebiet Expertise zu besitzen. „Da genieße ich die Diskussionen in der Wissenschaftlichen Gesellschaft“, betont Piepenbring, „weil sie mir helfen, den Blick auf größere Zusammenhänge nicht zu verlieren.“ In ihren eigenen Beiträgen nutze sie die Gelegenheit, Themen angrenzender Wissenschaftsdisziplinen anzusprechen und von den Fachleuten mehr darüber zu erfahren, fügt Piepenbring hinzu, „daraus können auch interdisziplinäre Kooperationen entstehen.“
Die Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaftsdisziplinen ist umso leichter möglich, als die Wissenschaftliche Gesellschaft nicht in Klassen oder Sektionen eingeteilt ist – im Gegensatz zu vielen Akademien, die sich ebenfalls für die Pflege der Wissenschaften einsetzen (beispielsweise die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina oder die wissenschaftlichen Akademien verschiedener Bundesländer) und an denen es typischerweise eine mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, eine geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse und eine Klasse der Literatur und der Musik gibt. „In Frankfurt wurde die Wissenschaftliche Gesellschaft bewusst nicht so organisiert“, erläutert Herbert Zimmermann, „weil die Einheit der Wissenschaft gewahrt werden soll.“
Noch etwas soll gewahrt werden: die Eigenständigkeit der Wissenschaftlichen Gesellschaft. Sie finanziert sich selbst. Nicht durch Mitgliedsbeiträge, sondern durch Spenden und Zuwendungen, die teils von Mitliedern, teils von externen Förderern und von einem Industrieunternehmen stammen, in der Vergangenheit zeitweise auch vom Land Hessen und der Stadt Frankfurt gezahlt wurden und in Zeiten höherer Zinsen zu einer Vermögensgrundlage angewachsen sind. Dazu kommt die Unterstützung durch die Goethe-Universität, sowohl finanziell als auch mit einem Raum für die Geschäftsstelle – „das Gehalt für die dort tätige Kraft muss die Wissenschaftliche Gesellschaft allerdings selbst aufbringen“, schränkt Zimmermann ein.
Er beschreibt, wie die Gesellschaft sich nicht nur durch Vorträge und Diskussion ihrer Mitglieder für die Pflege der Wissenschaft einsetzt: „Früher haben wir häufig aufstrebende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützt, indem wir einen Zuschuss zur Veröffentlichung ihrer Habilitationsschriften gegeben haben.“ Heute bestehe die Unterstützung insbesondere in dem Förderpreis, den die Gesellschaft an herausragende junge Forscherinnen und Forscher verleiht, die schon die ersten Sprossen der Karriereleiter emporgeklettert sind.
Aber die Wissenschaftliche Gesellschaft kümmere sich nicht nur um Top-Nachwuchsleute, und sie verkrieche sich nicht im Elfenbeinturm: „Sie tritt an die Frankfurter Öffentlichkeit, wenn ihre Mitglieder an den ,Römerberg- Gesprächen‘ teilnehmen“, sagt Zimmermann, „außerdem lehren sie an der ,Universität des dritten Lebensalters‘ und tragen bei der ,Frankfurter Bürger-Universität‘ vor.“
Und wenn die Gesellschaft so wie zum Beispiel 2019 auf Plakaten in der Stadt bekanntgibt, dass es in einer öffentlichen Veranstaltung um „Evidenz in der Wissenschaft“ geht, ist kein Gedanke an „aus der Zeit gefallen“.
Stefanie Hense
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 6.20 (PDF) des UniReport erschienen.