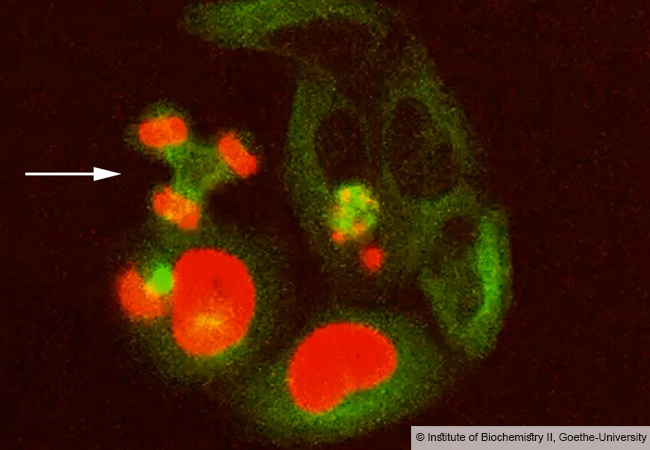Jutta Dalhoff, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften GESIS, über familiengerechte Wissenschaft.
Wie viel Familie verträgt die Wissenschaftslaufbahn? Um dieses daueraktuelle Thema ging es am 19. September bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion, zu der der Familien- Service der Goethe-Universität eingeladen hatte. Anlass war die Jahrestagung des Best-Practice-Clubs »Familie in der Hochschule «. Zu den Podiumsteilnehmerinnen gehörte Jutta Dalhoff, Leiterin des Kompetenzzentrums »Frauen in Wissenschaft und Forschung« am Kölner Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften GESIS. Wir haben sie im Vorfeld befragt, wo es auch heute noch Fallstricke für die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere gibt und wo angesetzt werden müsste, um echte Veränderungen zu erreichen.
GoetheSpektrum: Dass sich Berufseinstieg oder Karriereplanung schlecht mit der Familiengründung vereinbaren lassen, gilt nicht nur für die Wissenschaft. Wo liegen dennoch besondere Herausforderungen in diesem Feld?
Jutta Dalhoff: Das ist in erster Linie die spezifische Vertragssituation, die den Beginn der wissenschaftlichen Laufbahn prägt. Diese Verträge sind von einer noch größeren Planungsunsicherheit gekennzeichnet, als sie auch im »normalen« Arbeitsleben der Wissenschaft vorherrschen. Insofern ist Wissenschaft mit der Familie schwer zu vereinbaren, da ich in der Regel bis zum 40. Lebensjahr nicht wirklich sagen kann, ob ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber meine berufliche Zukunft verankern kann oder ob ich mir noch einmal ein ganz anderes Feld suchen muss. Diese Unsicherheit führt mit dazu, dass die Familiengründung immer weiter hinausgeschoben wird.
Es wird aktuell viel über die neuen Väter gesprochen, deren Bereitschaft zu Teilzeit usw. Inwieweit bleibt das Familienthema in der Wissenschaft dennoch gerade für die Frauen ein zu leistender Spagat?
Die Rollenverteilung und rollenspezifischen Zuschreibungen sind quer durch unsere Gesellschaft – da machen die Wissenschaft als Arbeitgeber und auch die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keine Ausnahme – nach wie vor sehr traditionell. Das kommt insbesondere in dem Moment zum Tragen, wo das erste Kind geboren wird. Auch wenn die Aufgaben zuhause vorher gleichverteilt waren, fallen Männer und Frauen auf einmal in traditionelle Rollenmuster zurück, und die Zuständigkeit für den Nachwuchs landet wieder bei den Frauen. Alle haben die Realität der neuen Väter schon erlebt, aber das hat nach meiner Wahrnehmung bisher nicht zu einer tatsächlichen Gleichverteilung der Aufgaben geführt. Daran kann weniger der individuelle Vater etwas ändern, solange sich die Strukturen und Denkweisen in den wissenschaftlichen Einrichtungen nicht ändern: Die Arbeitgeber schreiben weiterhin Frauen genau diese Zuständigkeit zu und gehen in der Regel davon aus, dass deren Verfügbarkeit für den Beruf Wissenschaftlerin zumindest eingeschränkt ist. Egal, ob schon Kinder da sind oder nicht, das wirkt implizit in den Köpfen bei Entscheidungen über Stellenvergaben und ähnliches mit.
Verschiedene Initiativen versuchen seit einigen Jahren, die familiengerechte Hochschule Wirklichkeit werden zu lassen. Was muss geschehen, damit es nicht bei schönen Worten bleibt?
Bei den auf der Hand liegenden Maßnahmen – sprich, der Kinderbetreuung – hat sich bei einigen wenigen Hochschulen etwas getan, aber diese Hochschulen sind nach wie vor in der Minderheit. Und selbst wenn wir über eine flächendeckende, und auch den besonderen Anforderungen in der Wissenschaft genügende Kinderbetreuung in den Hochschulen verfügen würden, hätten wir an den eben genannten Strukturproblemen noch gar nichts geändert. Diese Maßnahmen erleichtern die Situation zwar, und das ist selbstverständlich zu begrüßen. Aber weil sich die Strukturen und auch die Rollenkonzepte zwischen den Geschlechtern nicht durch Instrumente verändern lassen, kommt es zu keinem grundlegenden Umbruch.
Was würden Sie sich wünschen, damit an den richtigen Stellschrauben gedreht wird?
Wir brauchen zum Beispiel mehr Konsequenz bei den gesetzlichen Grundlagen. Beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz wurde beispielsweise vor einigen Jahren eine sogenannte Familienkomponente eingeführt, die von Anfang an als »Kann-Bestimmung« angelegt war: Die Hochschule kann, wenn sie das für richtig hält, eine Mutter oder einen Vater über die Befristungsgrenzen hinaus vertraglich verlängern, aber sie muss es nicht tun aus Kindererziehungsgründen. Und da sie es nicht muss, hat es in der Vergangenheit eine Verlängerung der in der Regel ja viel zu kurz befristeten Verträge äußerst selten gegeben. Der Gesetzgeber hat mit Sicherheit bewusst keine Soll-Vorschrift daraus gemacht. Genau das ist von vielen Seiten kritisiert worden in der Vergangenheit. Nun haben wir gerade eine Novelle dieses Gesetzes hinter uns, und man reibt sich erstaunt die Augen, dass es bei dieser eigentlich einhelligen Frage keine entsprechende Veränderung bei der Familienkomponente gegeben hat. Irgendwo im politischen Aushandlungsprozess ist dieser Punkt wieder auf der Strecke geblieben, obwohl alle Beteiligten in diesem Feld mit Sicherheit schon schöne Reden zum Thema Vereinbarkeit gehalten haben.
Wo müsste noch angesetzt werden, um eine Veränderung zu erreichen?
Die Diskussion um die Familienfreundlichkeit hat sich ja mittlerweile erweitert, weil wir es nicht nur mit Eltern von Kindern zu tun haben, sondern eben auch mit Beschäftigten, die ihre Eltern betreuen oder pflegen müssen. Zum Thema Pflegeverpflichtungen gibt es deutlich weniger Maßnahmen an den Hochschulen, als dies bei Vereinbarkeit von Elternschaft und Wissenschaft inzwischen der Fall ist. Die Pflege müsste also dazukommen als ein auch für die Arbeitnehmerinnen gut regelbares Lebensereignis, das sie auch oft genau in der Phase betrifft, in der auch Kinder im Haus sind. Da stecken wir noch vollständig in den Anfängen. Übrigens ist auch die Pflege etwas, das in der Regel von Frauen getragen wird. Und da wir schon beim Thema Alter sind: Auch an den Hochschulen gibt es natürlich älter werdende Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich befasse mich zunehmend mit der Frage, wie sich Lebensarbeitszeit besser gestalten lässt an den Hochschulen, um verschiedene Phase des Arbeitslebens besser in eine Balance zu bringen.
Auf den Punkt gebracht: Was ärgert Sie an der Gesamtentwicklung?
Mich ärgert, dass wir bisher viel zu langsam mit den notwendigen politischen Veränderungen vorangekommen sind. Meine Wahrnehmung ist, dass es beim Thema Gleichstellung in der letzten Zeit auch Rückschritte gibt in der Bereitschaft, diese als ein für alle Beteiligten wichtiges Feld anzuerkennen, in dem es noch etliche Veränderungen und Verbesserungen geben muss.
Gibt es eine Botschaft, die Sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Beginn ihrer Karriere mit auf den Weg geben möchten?
Wenn Studierende oder Promovenden feststellen, dass sie ein Forschungsthema gefunden haben, mit dem sie sich beruflich unbedingt weiter auseinandersetzen wollen, sollten sie sich nicht beirren lassen. Es muss einem aber vom Typus her wirklich entsprechen, in diesem Arbeitsfeld weiter voranzugehen. Und man muss wissen, dass ein langfristiger und unbefristeter Verbleib in einer wissenschaftlichen Einrichtung statistisch gesehen für nur ungefähr zehn Prozent der Promovierenden möglich ist. Die anderen 90 Prozent dürfen nicht das Gefühl haben, gescheitert zu sein, wenn sie nicht durch diesen Flaschenhals gekommen sind.
Ich bin ja selbst auch Vorgesetzte in meinem Institut, und wenn wissenschaftliche Mitarbeitende bei uns ihre Promotion beenden, geht es immer wieder darum, wie es beruflich weitergehen kann – im Institut ist das meistens nicht möglich. Wenn jemand dann die Chance hat, eine Position in einem außeruniversitären Bereich anzunehmen – ob in der Wissenschaftsadministration, der Politik, Wirtschaft oder Kultur – empfehle ich, diese Option ernsthaft in Betracht zu ziehen. Mein Rat ist daher: Verliert diese anderen Berufsfelder nicht zu lange aus den Augen, am besten überhaupt nicht – für den Großteil von euch werden sie die Institutionen sein, in denen ihr mit eurer akademischen Bildung vorangehen könnt. Was die Vorgesetzten angeht, kann man sich nur wünschen, dass diese nicht nur den Tunnelblick auf die Professur haben. Denn das kann nur zu Enttäuschungen führen, und auch mit den anderen Berufsfeldern kann man ein gutes Leben führen.
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“plain“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]
Weiterlesen zum Thema: Das deutsche Jugendinstitut hat 2016 eine Ausgabe seiner »DJI Impulse« zum Thema »Neue Väter – Legende oder Realität?« veröffentlicht. Sie kann kostenlos heruntergeladen werden unter http://tinyurl.com/jhdcd2v.
[/dt_call_to_action]
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 3.16 der Mitarbeiterzeitung GoetheSpektrum erschienen.