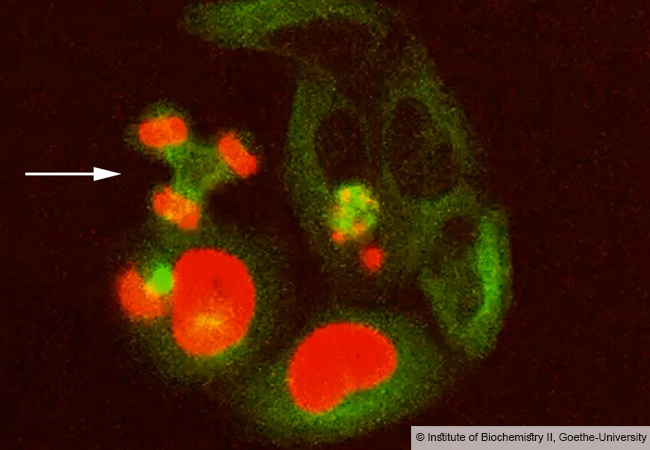Der UniReport sprach im Institut für Soziologie mit Prof. Thomas Lemke, dem Geschäftsführenden Direktor des Instituts, und den Studierenden Luisa Hecker (Master) und Adam Jendrzejewski (Bachelor) über das Selbstverständnis des Faches, über Studienbedingungen und über die gesellschaftliche Rolle der Soziologie.
UniReport: Die erste Frage geht an die beiden Studierenden. Spielt das Jubiläum der Soziologie eine Rolle für diejenigen, die das Fach gerade hier studieren?
Adam Jendrzejewski: Ich würde sagen, das läuft erst mal an. Die Flyer sind ja auch relativ neu rumgegangen und man bekommt es jetzt zunehmend mit, aber das neue Semester hat ja noch gar nicht begonnen und mit dem Semesterbeginn wird das dann präsenter sein.
Luisa Hecker: Ich glaube, es ist in der Studierendenschaft noch nicht so ganz angekommen. Aber es ist ja auch noch etwas Zeit.
UniReport: Warum studieren Sie jetzt beide in Frankfurt, spielte da auch die stolze Tradition des Faches eine Rolle?
Hecker: Also, bei mir war es eher ein Versehen, ich wollte eigentlich woanders etwas anderes studieren (lacht). Aber in Frankfurt sind natürlich die Kritische Theorie und die Frankfurter Schule besonders spannend. Man muss nur leider sagen, dass das Lehrangebot diese Tradition nur in einem geringen Maße widerspiegelt. Es gibt keine feste Professur dafür, es fehlen Mitarbeitende, die dazu Lehrangebote anbieten wollen und können. Das ist auch eine Forderung der Studierenden, diese Tradition wieder vermehrt in der Lehre zu verankern.
Jendrzejewski: Ich konnte mir zu Studienbeginn kaum etwas unter Kritischer Theorie vorstellen. Die Namen Adorno und Horkheimer hatte ich aber sicher schon mal gehört. Mir war es aber wichtig, dass man in der Soziologie eine kritische Weltanschauung vermittelt bekommt. Ausschlaggebend war vor allem, dass die Soziologie in Frankfurt ein breit gefächertes Institut mit vielen Lehrstühlen ist.
UniReport: In den ersten studentischen Antworten fällt direkt der Name Adorno, wird die Kritische Theorie genannt. Ist das manchmal auch eine Bürde, dass dieses Fach heute vielleicht in einem gewissen Schatten Adornos steht – auf seinen Schreibtisch auf dem Campus schauen wir ja direkt.
Thomas Lemke: Also, ich würde es weniger als eine Bürde sehen, sondern eher als einen Anreiz oder einen Ansporn. Denn die Kritische Theorie in der Frankfurter Tradition ist ja immer noch aktuell. Es handelt es sich um ein interdisziplinäres Forschungsprogramm, das zugleich gesellschaftstheoretisch informiert und empirisch orientiert ist. Darüber hinaus zielt dieses Programm auf eine Kritik der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse. Und schließlich zeichnet sich die Frankfurter Schule durch die Verbindung von Erkenntnistheorie und Machtkritik aus. Was natürlich auch die Selbstkritik derjenigen mit einschließt, die Wissenschaft betreiben: Was macht meine wissenschaftliche Tätigkeit, vielleicht auch gegen meine erklärte Absicht?
UniReport: Wo sind vielleicht auch Namen wie Adorno heute keine Hilfe mehr, wo haben sich Anforderungen an eine moderne Gesellschaftswissenschaft verändert?
Lemke: Das ist die Frage, auf welcher Ebene man das betrachtet. Auf einer programmatischen Ebene ist die Verbindung von Gesellschaftstheorie mit empirischer Forschung ebenso aktuell wie die Situierung der eigenen Erkenntnisproduktion in den gesellschaftlichen Verhältnissen. Was hingegen nicht mehr zeitgemäß ist, ist die Vorstellung eines universellen „Verblendungszusammenhangs“, der sich gewissermaßen wie ein einheitlicher Schleier auf die Gesellschaft legt. Die gesellschaftliche Totalität wird heute in der soziologischen Theorie und der empirische Forschung anders zu fassen versucht. Dabei geht es eher um die wechselseitige Verschränkung und Durchdringung oder die praktische Hervorbringung von Strukturkategorien wie etwa Geschlecht, Ethnizität und Klasse.
UniReport: Frau Hecker, Herr Jendrzejewski, es gibt ja die Kritik an der »Verschulung« der heutigen Studiengänge seit Bologna. Ist das für ein Fach wie die Soziologie ein besonderes Problem, dass man im Studium diese kritischen Potenziale aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen gar nicht entdecken und nutzen kann?
Hecker: Das würde ich auf jeden Fall bejahen. Man muss bedenken, dass wir nur wenige Studierende haben, die ihr Studium überhaupt in der Regelstudienzeit abschließen. Ein Bachelorstudium in sechs Semestern durchzupressen ist auch nicht unbedingt das, was ich mir als Soziologiestudium vorstelle. Da fehlt viel Zeit zur Selbstreflexion, zum kritischen Denken und Fehler-machen. Der Bildungsbegriff im Sinne einer Persönlichkeitsreifung fällt meiner Ansicht nach völlig unter den Tisch.
Jendrzejewski: Die Hochschulfinanzierung ist auf die Regelstudienzeit ausgerichtet. Bei Einhaltung gibt’s für die Uni Geld, studiert man länger, gibt es dann vom Land nichts mehr. Das heißt aber, dass das Betreuungsverhältnis darunter leidet. Besonders fällt dies auf den Mittelbau zurück, der unter stark prekären Arbeitsverhältnissen leidet. Zusätzlich ergibt sich aber auch die Frage: Wer kann überhaupt studieren? Das ist immer noch eine Klassenfrage. Manche sind abhängig von Krediten oder BAföG und müssen lohnarbeiten. Und es gibt natürlich Studierende, die können sich auf auf dem Geld ihrer Eltern ausruhen.
UniReport: Herr Lemke, diese Probleme, die nicht nur die Soziologie betreffen, sind ja bekannt. Welche Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten hat man überhaupt vonseiten eines Instituts?
Lemke: Vor dem Hintergrund der konkreten Lebens- und Arbeitssituation von Studierenden haben wir versucht, bei der Ausgestaltung des Studiums eine möglichst große Flexibilität einzubauen. Frankfurt bietet im Vergleich zu anderen Instituten der Soziologie relativ viel Freiräume. Es gibt hier nur wenige Pflichtveranstaltungen und sehr viel mehr Wahlmöglichkeiten als an den meisten anderen Hochschulen. Darüber hinaus ermöglicht die hohe Zahl an Veranstaltungen natürlich auch eine entsprechende zeitliche Flexibilität bei der Erstellung des Stundenplans.
UniReport: Wie stellen Sie sich den idealen Studierenden Ihres Faches vor?
Lemke: Die realen Studierenden entsprechen bereits meinem Ideal wissenschaftlicher Neugier und kritischer Reflexion. Wer selbst hier jahrelang lehrt, kann das vielleicht nicht mehr richtig würdigen. Aber diejenigen, die hier Vertretungsprofessuren oder Gastprofessuren innehaben und an verschiedenen deutschen Universitäten schon Lehrveranstaltungen gegeben haben, melden uns immer wieder zurück, wie engagiert und theoretisch versiert die Studierenden gerade hier sind.
UniReport: Gibt es etwas, was das Fach Soziologie betrifft, das vielleicht zu anspruchsvoll, zu voraussetzungsreich ist, müssten da auch bestimmte Anforderungen stärker kommuniziert werden?
Jendrzejewski: Wenn man in der Soziologie mit dem Propädeutikum beginnt, dann sitzen da 300 Studierende, mit denen man zusammen lernen soll, wie man wissenschaftlich arbeitet. Auch die zugehörigen Übungen sind überfüllt und die Tutor* innen häufig nicht ausreichend vorbereitet – leider müssen diese auch mit prekären Arbeitsverhältnissen kämpfen. Da sind Kompetenzen, die in einem Programm wie dem „Starken Staat“ vermittelt werden, schon sehr wichtig. Das sollte auch von der Universität weiter ausgebaut werden. Vor der Statistik habe ich mich auch gesträubt, aber das kriegt man hier schon hin, da muss man sich keine Sorgen machen.
Hecker: Ich würde gerne anfügen, dass gerade in der Soziologie die Seminare unheimlich wichtig sind. Das ist der Ort, an dem man Kritikfähigkeit gegenüber Theorien und empirischen Zugängen lernen kann und auch der Ort, an dem man akademisch diskutieren lernt. Leider sind die Seminare oft überfüllt oder stark begrenzt, so dass zusätzliche Hürden beim Einstieg ins Fach entstehen.
Jendrzejewsk: Das Problem in großen Seminaren ist auch, sich dort als junge*r Bachelorstudierende*r durchzusetzen. Dann sitzt man da mit Leuten aus dem fünften, sechsten Semester, die bereits tiefer im Fach verortet sind – da geht man leicht unter.
UniReport: Kann man sich heute als Studierender angesichts der knappen Zeitressourcen noch nebenbei engagieren, was sind da Ihre Erfahrungen?
Hecker: Seit der Bologna-Reform unterliegt das Studium natürlich einem Zeit- und Verwertungsdruck. Wenn ich auf ein Studium in Regelstudienzeit (40 Stunden pro Woche) angewiesen bin, ist es fast unmöglich sich nebenher noch zu engagieren. Auf dem alten Campus gab es grundsätzlich aufgrund der Architektur gesellschaftliche Teilhabe an wissenschaftlichen Diskussionen. Der Raum war darauf ausgelegt, von allen genutzt zu werden und Menschen in Kontakt zu bringen. Da war es auch leichter, sich politisch zu engagieren. Auch in der Fachschaft merkt man, dass Engagement fast ein Luxus ist. Aber wir haben in Frankfurt immerhin noch sehr viele autonome Tutorien. Dieser Impuls geht deutlich sichtbar von der Studierendenschaft aus und ist ein Engagement, das nicht abreißt. Das zeigt sich allein schon daran, dass es mehr Vorschläge für autonome Tutorien gibt, als tatsächlich umgesetzt werden können.
UniReport: Herr Lemke, empfindet man als Institutsleitung die autonomen Tutorien manchmal als eine gewisse Konkurrenz? Oder begrüßt man diese als gewünschte Erweiterung der Lernkultur?
Lemke: Eindeutig Letzteres. Die autonomen Tutorien sind ein zentrales Element der Studienkultur an der Goethe-Uni. Sie erlauben es den Studierenden, eigene Akzente zu setzen und selbst Erfahrungen zu sammeln in der Gestaltung und Organisation universitärer Lehre. Die autonomen Tutorien sind eine wichtige Ergänzung zu dem, was wir Lehrenden an Veranstaltungen anbieten – und weisen uns auf Themen hin, die im normalen Lehrbetrieb vielleicht eher randständig sind, aber bei den Studierenden auf großes Interesse stoßen.
Jendrzejewski: Die Frage ist nur, wer sich die autonomen Tutorien zeitlich leisten kann. Es wäre eigentlich schön, wenn man mal eine Prüfungsordnung entwickeln würde, in der es für die Teilnahme an den autonomen Tutorien eine Art von Anerkennung gäbe. Ebenso für die Fachschaftsarbeit. Für die autonomen Tutorien gibt es zwar Mittel, aber die müssen jedes Jahr hart erkämpft werden. Und es gibt natürlich auch Personen am Fachbereich, die diese Gelder lieber anders einsetzen würden.
UniReport: Die FAZ berichtete kürzlich von einem Methodenstreit in der Soziologie, der auf einer Veranstaltung in Köln zu Tage getreten sei.* Gibt es diesen behaupteten Kampf zwischen den empirischen Methoden versus verstehender Soziologie auch in Frankfurt?
Lemke: Zunächst einmal ist es ein Missverständnis, dass Vertreter der empirischen Soziologie den Anhängern der verstehenden Soziologie gegenüberstehen. Es gibt vielmehr unterschiedliche Arten, empirisch zu arbeiten. Die einen tun das eher analytisch mit quantitativen Methoden, und die anderen eher interpretativ mit einem qualitativen Methodenarsenal. Beide Perspektiven sind hier im Institut für Soziologie vertreten und kommen gut miteinander aus. Es ist allerdings selbstverständlich, dass Streit und produktive Kontroverse zur Soziologie gehören. Wichtig scheint es mir, den Reichtum und die Pluralität dieser unterschiedlichen Zugänge herauszustellen, ebenso wie die sich daraus ergebende Möglichkeit, sich reflexiv und kritisch mit dem eigenen Methodenrepertoire auseinanderzusetzen. Daher ist es vollkommen verfehlt, sich wechselseitig eine mangelnde Wissenschaftlichkeit vorzuwerfen, wie dies bei der erwähnten Veranstaltung der Fall war.
Jendrzejewski: Wir haben im letzten Semester eine Veranstaltung über die Grenzen von quantitativer und qualitativer empirischer Sozialforschung organisiert. Es ging um Fragen wie: Wo stoßen wir an Grenzen, wo müssen wir stärker zusammenarbeiten, wo widersprechen wir uns? Diese Kontroverse hatte für alle eine gewisse Attraktivität.
UniReport: In Zeiten einer massiven Relativierung und Infragestellung von Wissen und Wissenschaft mag sich mancher Zeitgenosse nach Großdenkern wie Jürgen Habermas zurücksehnen (der auch auf der zentralen Festveranstaltung von »100 Jahre Soziologie« sprechen wird). Ist dieser Wunsch legitim, ist er noch zeitgemäß?
Lemke: Ich denke, dass der Intellektuelle, wie Sie ihn beschreiben, eine historische Figur ist. Der Großdenker, der gewissermaßen für die Gesellschaft spricht, der eine Ordnungsund Orientierungsfunktion wahrnimmt, ist im Verschwinden begriffen – und zwar aus guten Gründen. Zum einen wird der Anspruch, man habe einen objektiven Einblick in die gesellschaftlichen Prozesse und Strukturen und könne daher sagen, in welche Richtung die Gesellschaft sich bewegen müsse, heute zu Recht deutlich kritischer gesehen. Zum anderen werden die meisten wissenschaftlichen Fragen inzwischen nicht mehr oder zumindest nicht mehr ausschließlich in den klassischen Printmedien wie noch zu Zeiten Sartres öffentlich verhandelt. Internet und soziale Medien spielen eine immer größere Rolle. Diese Verschiebung hat Auswirkungen auf die demokratische Öffentlichkeit, die wir noch gar nicht absehen können. Dies nährt generelle Zweifel an den Wahrheitsansprüchen, die mit Wissenschaft verknüpft sind, und verändert auch die Art der Wissenschaftskommunikation. Im Prinzip können zwar alle an sozialen Medien partizipieren, aber man darf natürlich nicht so naiv sein anzunehmen, dass daraus automatisch egalitäre Effekte erwachsen. Das ist ein hoch vermachteter Bereich, es ist nötig, genau anzuschauen, wem diese Infrastrukturen gehören, wer sie wie gestaltet, und welcher Aufmerksamkeitsökonomie sie folgen.
Hecker: Ich würde da gerne einhaken. Von der Beschreibung her ist das eine männliche Figur – DER Intellektuelle. Es folgt einer rechtspopulistischen, autoritären Logik zu sagen, es müsse jetzt diese eine Person geben, die alles weiß und überhaupt richtig von falsch unterscheiden kann, eindeutige Aussagen treffen kann und sagt, wo es langgeht. Mich erinnert das an eine Art Führerlogik, die wir in Deutschland ja schon erlebt haben. Ich denke, dass große Teile der Gesellschaft sich nach einer solchen Figur sehnen. Doch genau hier muss der Ansatzpunkt auch für eine akademisch basierte gesellschaftliche Intervention liegen, dieser Denkfigur entgegenzutreten.
UniReport: Es ging mir letztendlich um die Frage, ob es heute noch Intellektuelle (männlich und weiblich!) geben kann, die einer Diskussion einen wichtigen Input geben können – was ja auch in Form einer Kritik erfolgen kann.
Hecker: Eine Kritik aber ist ja nicht zwangsläufig eine Orientierung, sondern erst mal eine Kritik an den Zuständen.
Jendrzejewski: Ich glaube, dass es wichtig wäre, in allen wissenschaftlichen Disziplinen eine andere Öffentlichkeitsarbeit zu etablieren. So muss die Soziologie es schaffen, ihre Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen Kontext vor allem verständlich in die Gesellschaft zu tragen.
Hecker: Es bedarf einer neuen Kultur des Ausdiskutierens. Es ist ein Aspekt des Rechtspopulismus, dass seine Vertreter*innen plötzlich irgendeine Wahrheit erkennen, die sonst keiner sieht. Wir brauchen wieder einen Blick für die Komplexität von Gesellschaft, ohne dass man direkt daran verzweifelt.
Lemke: Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wie kann man soziologisches Wissen heute für die breite Öffentlichkeit verfügbar machen? Der Niedergang der Soziologie als Disziplin seit den 1970er-Jahren hat mit dem gleichzeitigen Aufstieg neoliberaler Rationalitäten zu tun, die alles auf Individuen runterrechnen. Hinzu kommt die Konjunktur der Bio- oder Neurowissenschaften. Zur Erklärung von schulischen Erfolgen oder politischen Orientierungen schaut man dann einfach „im Hirn“ nach oder sucht nach bestimmten genetischen Varianten. Gegenüber diesen verkürzten Zugängen ist es wichtig, in der Gesellschaft wieder den Sinn schärfen für die Komplexität der Probleme, mit denen wir es heute zu tun haben und die oft quer liegen zu den disziplinären Grenzen. Dies bedeutet zunächst einmal, die richtigen Fragen zu stellen, statt sich auf die zu einfachen Antworten zu verlassen.
UniReport: Ein Jubiläum ist natürlich nicht nur historisierend, sondern öffnet zugleich auch den Blick für Gegenwart und Zukunft. Was wünschen Sie sich persönlich von diesem Jahr?
Lemke: Unser Fach an der Goethe-Uni besitzt eine Vielfalt und Breite, wie sie sich in Deutschland nur noch in Bielefeld finden. Diesen aktuellen Reichtum, der auch die beeindruckende Geschichte mit einschließt, sollten wir außerhalb der Universität noch stärker sichtbar machen. Darüber hinaus ist das Jubiläum auch eine gute Gelegenheit für diejenigen, die hier lehren und studieren, sich stärker auszutauschen: Was sind die weiteren Perspektiven der Soziologie in Frankfurt? Welche Schwerpunktsetzungen wollen wir weiterverfolgen, welche Kooperationsformen sind interessant und zukunftsweisend?
Jendrzejewski: Ich würde mir wünschen, dass studentische Interessen weiterhin und vermehrt berücksichtigt werden. Dass die Vielfalt, in der wir hier studieren können, immer auch erkämpft werden muss, sollte allen klar werden. Der akademische Diskurs ist generell sehr von Wettkämpfen durchzogen. Daher würde ich mir wünschen, dass wir in der Soziologie nicht die Ellbogen ausfahren, sondern uns gemeinsam in Kontroversen bereichern.
Hecker: Ich würde meine Wünsche an die geldgebenden Institutionen richten: an das Präsidium und an die Hochschulpolitik des Landes. Es muss eine Abkehr von Regelstudienzeit und Credit Points geben. Das wäre eine Anerkennung von geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern und Bildung im Allgemeinen; man sollte damit aufhören, alles einer Verwertungslogik zu unterwerfen. Und das trifft eigentlich auf alle Studiengänge zu, auch Wirtschafts-, Rechts- und Naturwissenschaften können kritisch betrieben werden.
Jendrzejewski: Und vielleicht sollte noch die Gastprofessur für kritische Gesellschaftstheorie erwähnt werden, deren dauerhafte Finanzierung unklar ist. Vor allem sind die Seminare der Gastprofessur jedes Mal völlig überlaufen…
Hecker: … und was man als Aushängeschild nutzt, sollte man dann vielleicht auch finanzieren.
Die Fragen stellte Dirk Frank
Further information:
www.faz.net/aktuell/feuilleton/ hoch-schule/methodenstreit-in-der-deutschen- soziologie-16001226.html
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 2.19 des UniReport erschienen.