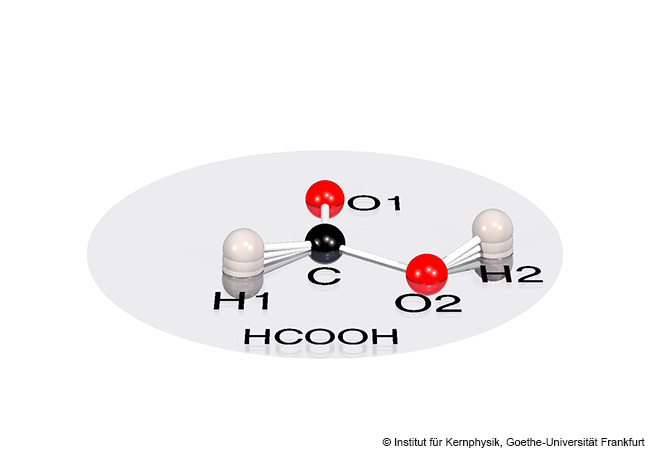Die Zusammenführung von Theorie und Empirie im Zeichen gesellschaftskritischer Zeitdiagnose war von Anfang an Ziel und Markenzeichen der sogenannten Frankfurter Schule. Diese Geschichte begann, als 1930 der Sozialphilosoph Max Horkheimer die Leitung des 1924 eröffneten Frankfurter Instituts für Sozialforschung übernahm. Dass das vor fast einem Jahrhundert begonnene Projekt verschiedene Phasen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und mehrfachen Krisen erlebte, kann nicht verwundern. Umso erstaunlicher ist, wie das Projekt erneut Fahrt aufnahm, als 2001 Axel Honneth, Schüler von Jürgen Habermas und dessen Nachfolger auf dem Lehrstuhl für Sozialphilosophie, Geschäftsführender Direktor des Instituts wurde.
Mündigkeit als normativer Orientierungspunkt
An einstige ruhmreiche Zeiten mit Theodor W. Adorno als Direktor und der Buchreihe „Frankfurter Beiträge zur Soziologie“ als Publikationsorgan für öffentlichkeitsrelevante Forschungen des Instituts anknüpfend, begann 2002 eine neue, das thematische Spektrum erweiternde Reihe „Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie“. Als ersten Band publizierte das Institut unter dem sarkastisch- kritisch klingenden Titel „Befreiung aus der Mündigkeit“ und mit dem programmatischen Untertitel „Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus“ eine Sammlung erster Überlegungen zur Bestimmung eines neuen Forschungsthemas. In der Einleitung des neuen Direktors hieß es damals: „Im Gegensatz zu der wachsenden Tendenz, paradoxale Verläufe sozialer Entwicklungen aus einer neutralen Beobachterperspektive zu analysieren, bleiben die Diagnosen des vorliegenden Bandes zumeist einer performativen Perspektive verhaftet, indem sie im Interesse des durch soziale Gegenläufigkeiten bedrohten Fortschritts erfolgen. […] Insofern darf die Lossagung von veralteten Traditionsbeständen der Kritischen Theorie nicht bis zum Punkt der Preisgabe ihres emanzipatorischen Anspruchs vorangetrieben werden; die ‚Mündigkeit‘, von der im Titel des vorliegenden Bandes behauptet wird, dass sie unter parasitärer Verwendung ihrer eigenen Prinzipien heute bedroht ist, bleibt der normative Orientierungspunkt fast aller hier versammelten Beiträge.“
Mit der Verlagerung der Aufmerksamkeit auf paradoxale Verläufe sozialer Entwicklungen entfiel auch die Konzentration auf die Produktionssphäre als entscheidend für das Schicksal des industriellen Kapitalismus. Stattdessen begann eine neue zeitdiagnostische Orientierung kritischer Theorie als interdisziplinäres Unternehmen – charakterisiert als „Versuch, soziale Paradoxien im gegenwärtigen Kapitalismus zu untersuchen“, allerdings ohne die Hoffnung, je zu einer aktuellen interdisziplinären gesamtgesellschaftlichen Analyse gelangen zu können. Ein Jahrzehnt später war die Konkretisierung und Profilierung des neuen Forschungsschwerpunktes so weit fortgeschritten, dass der Philosoph Axel Honneth und der Soziologe Ferdinand Sutterlüty in „WESTEND“ – der „Neuen Zeitschrift für Sozialforschung“, die nach jahrzehntelanger Unterbrechung an die Stelle der alten „Zeitschrift für Sozialforschung“ des von Horkheimer geleiteten Instituts trat – das neue übergreifende Projekt des Instituts so zu formulieren vermochten, dass es zum Leitfaden einer spezifischen Forschungsrichtung werden konnte. „Normative Paradoxien der Gegenwart – eine Forschungsperspektive“ lautete der Titel des zwei Dutzend Seiten umfassenden Textes.

Dr. Rolf Wiggershaus ist Philosoph und Publizist, er ist als Historiker der Frankfurter Schule bekannt geworden. Seine Studie über ihre Geschichte und Bedeutung sowie seine Einführungen über Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas gelten als Standardwerke. Foto: Renate Wiggershaus
Diese „Forschungsperspektive“ eröffnet nun ein weiteres Jahrzehnt später den Band 32 der „Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie“ – „Normative Paradoxien. Verkehrungen des gesellschaftlichen Fortschritts“ – und bietet einen ausgezeichneten Leitfaden für die Lektüre und Einschätzung der darauffolgenden, jeweils ein halbes Dutzend Beiträge umfassenden „Theoriegeschichtlichen Perspektiven“ und „Materialen Studien“.
Wandel mithilfe der Paradoxie erklären
„Das Verwirrende, ja Perplexe an der gegenwärtigen Situation“, so formulieren Honneth und Sutterlüty prägnant die Forschungsperspektive, „besteht wohl darin, dass die normativen Leitideen der vergangenen Jahrzehnte zwar weiterhin eine performative Aktualität besitzen, untergründig aber ihre emanzipatorische Bedeutung verloren oder gewandelt zu haben scheinen, weil sie vielerorts zu bloß legitimierenden Begriffen einer neuen Stufe der kapitalistischen Expansion geworden sind.“ Es gehe um den Versuch, diese gewandelte, schwer zu durchschauende Form der normativen Entwicklung mittels der Kategorie der Paradoxie zu begreifen. Damit sei die eigentümliche Tatsache gemeint, „dass heute viele der erfolgreich institutionalisierten Prinzipien der vergangenen Jahrzehnte insofern eine nahezu entgegengesetzte Bedeutung annehmen, als sie unter dem Druck sozialer Umstände zu normativen Mitteln der entsolidarisierenden, entmündigenden Integration“ würden, und das oft ohne Verabschiedung und Aufgabe der zunächst richtungsweisenden moralischen Ansprüche.
Die unter dem Titel „Theoriegeschichtliche Perspektiven“ versammelten Beiträge geben sich betont geistes- bzw. ideengeschichtlich. Sie konzentrieren sich jeweils auf einen Autor – auf Alexis de Tocqueville, Friedrich Nietzsche, Max Weber, Georg Simmel, Siegfried Kracauer, Albert O. Hirschman. Das ergibt eine vielfältige Folie für die „Materialen Studien“ im zweiten Teil, in denen es um aktuelle Entwicklungen und Tendenzen geht, die wie eine Verkehrung gesellschaftlicher Fortschritts- und Emanzipationsversprechen wirken.
Das thematische Spektrum der Beiträge reicht von Arbeitswelt und Internet bis zu Paarbeziehungen und Kindeswohl. Von aktualitätsbezogener produktiver Fortsetzung eines von Beginn an für das Institut für Sozialforschung mal mehr, mal weniger charakteristischen Themas zeugt der Beitrag von Stephan Voswinkel über „Paradoxale Widersprüche in der gegenwärtigen Arbeitswelt“. Er setzt ein mit der Feststellung einer übergreifenden „pragmatischen Paradoxie“, deren pointierte Formulierung lautet, dass Beschäftigte gleichermaßen selbstorganisiert arbeiten wollen und arbeiten sollen. Beleuchtet wird das anhand von Kontrollformen indirekter Steuerung, einer Arbeitszeitflexibilisierung ohne symmetrische Reziprozität oder dem Spannungsverhältnis zwischen Selbstverwirklichungs- und Karriere- Orientierung. Dabei wird deutlich, dass es eine relevante Kategorie von Arbeitenden und Arbeiten gibt, bei denen emanzipative normative Intentionen zutage treten, gleichzeitig aber offenbleibt, ob es unter den Bedingungen kapitalistischer Ökonomie je zu mehr als einer „verkehrten Form“ normativer Fortschritte kommen könnte.
Kindeswohl schlägt in sein Gegenteil um
Je verschiedener die Themenfelder, desto faszinierender ist es, die Produktivität des Schlüsselbegriffs „normative Paradoxien“ zu erleben. „Paradoxien des Kindeswohls. Verkehrungen eines rechtsstaatlichen Prinzips“ lautet der Titel des Beitrags von Ferdinand Sutterlüty. Die Rechtsentwicklung zumindest in den Ländern des Westens zeigt, so Sutterlüty, eine deutliche Tendenz: Schon das Kind soll seinem Entwicklungsstand entsprechend in allen es betreffenden Angelegenheiten als selbstbestimmtes Wesen und in diesem Sinn als vollwertig gelten. Die Rekonstruktion der normativen Fundierung des gesetzlichen Kindeswohlkonzepts dient Sutterlüty als Grundlage für die Analyse der paradoxalen Effekte dieses Rechtsgutes und seiner institutionellen Umsetzung. Zu diesen paradoxalen Effekten gehört die von ihm so genannte „Unterminierungsparadoxie“. Gerade die Bemühung, dem Kindeswohl mit den Mitteln des Rechts zur Verwirklichung zu verhelfen, ist zur Verkehrung ins Gegenteil geeignet. Beispiele dafür sind Fälle, in denen die Kindesmutter dem Vater Kindesmisshandlung vorwirft, der Kindesvater der Mutter Vernachlässigung. So wird der elterliche Rekurs auf das Kindeswohl im Rechtsstreit kontraproduktiv für das Kindeswohl.
Eine empirische Studie zu Paar- Arrangements und Geschlechter- Konstruktion bei heterosexuellen Paaren mit Familienernährerin bildet die Grundlage von Sarah Specks Beitrag „Ungleiche Gleichheit in Paarbeziehungen. Paradoxe Umschläge und immanente Kritik“ – wie einige andere Beiträge die überarbeitete Fassung eines bereits früher erschienenen Textes. Die leitende Fragestellung war lapidar formuliert: „Macht er (auch) die Wäsche, wenn sie (auch) die Brötchen verdient? Und bilden sich neue Weiblichkeiten und Männlichkeiten heraus?“ Die Antworten, die vor allem aufschlussreich für das „individualisierte Milieu“ von Akademikerinnen und Akademikern in urbanen Zentren sind, demonstrieren: Trotz eines Leitbildes von Gleichheit herrscht drastische Ungleichheit der Belastungen und der Selbstbilder. Unterschiedliche Gewichtungen und Umwertungen werden zu Arrangements der Entschärfung von Konflikten und erlauben die Aufrechterhaltung einer „Illusion der Gleichheit“.
Ein Glanzstück des Bandes ist der Beitrag von Kai-Olaf Maiwald und Sarah Speck über „Die neue Unsichtbarkeit von Ungleichheit. Normative Paradoxien im Geschlechterverhältnis“. Wieder ist die Persistenz von Ungleichheiten vor dem Hintergrund der allgemeinen Geltung von Gleichheit als Norm das Thema, diesmal untersucht anhand von Einzelinterviews mit den Mitgliedern von einem Dutzend Familien der gebildeten Mittelschicht. Als ein wesentlicher Faktor normativer Verkehrung erweisen sich individualisierende Zurechnungen von geschlechtsspezifischem Verhalten. Die individualisierende Zurechnung, so eins der pointierten Resümes von Maiwald und Speck, „ermöglicht den Eltern eine Entlastung von der Reflexion ihres eigenen Anteils ab der geschlechtlichen Sozialisation der Kinder. Doch sie vermitteln den Kindern auf diese Weise auch keinerlei reflexives Instrumentarium über die bestehende Geschlechterordnung“. Der Beitrag schließt mit einer Warnung, die auch in den übrigen anklingt: Die Geltung der Gleichheitsnorm droht nicht nur dazu zu führen, dass tatsächliche Ungleichheiten nicht mehr wahrgenommen werden, sondern darüber hinaus auch dazu, dass inkorporierte Strukturen der Ungleichheit eine neue Selbstverständlichkeit bekommen.
Autor: Rolf Wiggershaus
Adorno-Vorlesung vom 29. Juni bis 1. Juli 2022
Seit 2002 veranstaltet das Institut für Sozialforschung in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag jährlich Vorlesungen, die an drei Abenden an Theodor W. Adorno erinnern. In diesem Jahr widmet sich die Philosophin Linda Martín Alcoff der historischen und kulturellen Rekonstruktion von Race und damit verbundenen Identitäten: Welche Erfahrungen entstehen aus der konstitutiven Beziehung von Race, History and Culture? Wie sind bestimmte Vorstellungen von Race mit konkreten, regressiven wie progressiven, Praktiken und Lebensweisen verbunden? Und inwieweit braucht es neue Ansätze, um die Narrative des Rassismus und ihr Fortbestehen zu überwinden und gesellschaftliche Verhältnisse zu transformieren?
Nähere Informationen demnächst unter www.ifs.uni-frankfurt.de