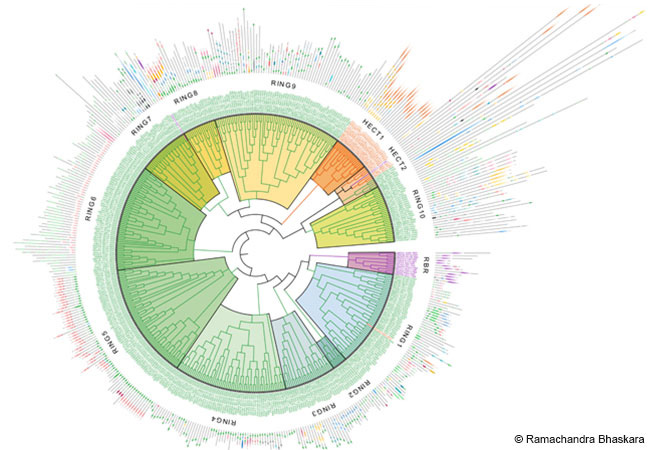Frau Prof. Rübsamen-Schaeff, Sie gehörten zu den ersten Wissenschaftlern, die HIV-Tests entwickelten und Methoden erforschten, welche das Virus hemmen. Später kamen Krebsviren, Hepatitis und andere dazu. Was fasziniert Sie an der Virologie?
Mein Weg war eigentlich umgekehrt: Ich war erst in der Krebsforschung tätig und wollte verstehen, wie eine Zelle zu einer Krebszelle wird. Dafür brauchte ich als (Bio-)Chemikerin ein möglichst zuverlässiges Modellsystem – und das war ein Virus, das Rous Sarkom Virus.
Es machte aus einer Kultur normaler Zellen über Nacht eine Kultur von Krebszellen. Ich dachte mir, dass man so die biochemischen Veränderungen beim Prozess der malignen Transformation gut vergleichen und damit auch verstehen könnte. Ich ging nach Gießen, um zu lernen, mit dem Virus zu arbeiten und wurde so auch zur Virologin. Mit diesen Arbeiten habe ich mich dann in Frankfurt habilitiert. Kurz danach kam HIV nach Frankfurt, die ersten Patienten lagen in der Uniklinik. Als klar war, dass HIV ein Retrovirus ist, wie mein »Hausvirus«, das Rous Sarkom Virus auch, begann ich, Kulturen aus Zellen von HIV-Patienten anzulegen und hatte bald die ersten deutschen HIV-Stämme.
Diese hatten aber – schon unter dem Mikroskop zu sehen – sehr unterschiedliche Wachstumseigenschaften und schädigten die Zellen unterschiedlich stark. Wir hatten es nicht mit einem einzigen Virus zu tun, sondern mit einem ungeheuren Spektrum der diversesten Varianten. Da hat es mich wissenschaftlich gepackt und wir begannen, neben der
Krebsforschung am Georg-Speyer-Haus Tests zu entwickeln, um die HIV-Infektion nachzuweisen und Zellkultur-Systeme anzulegen, um nach Hemmstoffen für HIV zu suchen. Während das Rous Sarkom Virus nur ein Mittel zum Zweck der Krebsforschung war, war ich nun endgültig zur Virologin geworden und habe später auch an einer Vielzahl an- derer Viren gearbeitet.
Die Corona-Krise hat in Deutschland eine neue Art Popstar hervorgebracht: den Virologen, der populärwissenschaftlich erklären kann. Sie selbst waren während der ersten Jahre der HIV-Unsicherheiten auch eine sehr gefragte Interviewpartnerin. Warum muss Wissenschaft verständlich informieren?
Weil nur die Wissenschaft diese Probleme lösen kann. Bleiben wir bei dem Beispiel HIV: Es ist von einem Todesurteil zu einer behandelbaren Krankheit geworden, mit der die Menschen ein fast normales Alter erreichen. Das war nur möglich durch die Entwicklung innovativer Medikamente und ihrer ständigen Verbesserung, und das sollte der breiten Bevölkerung klarmachen, welchen Wert unsere Arbeit hat. Informationen darüber, woran wir arbeiten, warum und mit welchen Methoden, sollten aber so klar wie möglich und ohne komplizierte Fachbegriffe dargestellt werden, damit Menschen, die keine Fachkenntnisse haben, trotzdem verstehen, was wir tun – und das ist immer möglich.
Als Wissenschaftler schafft man stets sich wandelnde Fakten. Das macht das Verhältnis von Wissenschaft und Politik schwierig. Sie selbst haben sich nie von der Politik instrumentalisieren lassen. Wie haben Sie das geschafft?
Ich wurde und werde schon hier und da angesprochen und um Rat gefragt, aber das geschah nicht öffentlich. In meinen Augen ist dabei wichtig, immer auch klar zu sagen, was wir sicher wissen und genauso klar, was wir noch nicht wissen, damit die Politik ihre Entscheidungen nicht auf Basis unsicherer Einschätzungen fällt.
Die Virologie und die Infektiologie gerieten in den vergangenen Jahren zunehmend aus dem Blick. Mit der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie fällt uns das jetzt auf die Füße. Was muss sich ändern?
Die aktuelle Pandemie kam in meinen Augen »mit Ansage«: Die Globalisierung, das heißt die Vernetzung der Welt mit Massen-Tourismus und Massenströmen von Waren, und das immer stärkere Eindringen des Menschen in die Rückzugsräume von Tieren geben allen Krankheitserregern völlig neue Chancen.
Wenn man sich diese Tatsachen ansieht, ist klar, dass die Welt eine Vorbereitung auf Pandemien braucht. Es muss Vorräte an Schutzkleidung geben und Laboratorien, die unter hohen Sicherheitsstandards daran arbeiten können, wenn ein Ausbruch da ist. Da wir nicht wissen, mit welchem Pathogen wir als Nächstes konfrontiert sein werden, macht es keinen Sinn, Medikamente gegen Viren oder Bakterien zu horten. Die Betroffenen dann aber ohne Gefahr für das medizinische Personal (aufgrund ausreichender Schutzkleidung) optimal versorgen zu können und Labors zu haben, die die dann notwendige Forschung mehr oder weniger »nahtlos« beginnen können, ist essenziell.
Mitte der 1980er Jahre übernahmen Sie die Leitung des Chemotherapeutischen Forschungsinstituts Georg-Speyer-Haus in Frankfurt, um an den gerade entdeckten HI-Viren zu forschen. Ein Traumjob?
1987 war das Georg-Speyer-Haus in einem miserablen Zustand. Es war jahrelang nichts in die Bausubstanz investiert worden, Wasserrohrbrüche waren an der Tagesordnung, der Putz bröckelte. Auch hatte das Institut über Jahrzehnte für das Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet, und die dafür benötigten Mitarbeiter zogen in das neue Gebäude in Langen.
Ich hatte also am Beginn drei Stellen: Meine eigene, die eines Assistenten und die einer Verwaltungskraft. Aber wir hatten eigene HIV-Stämme, die wir patentieren konnten und mit denen wir Kooperationen mit Pharma- und Diagnostik-Firmen beginnen konnten. Es war mit Sicherheit kein Traumjob. Es war eine sehr harte Zeit des Wiederaufbaus, aber eine Aufgabe, die ich mit Überzeugung übernahm – ich wollte ja aus dem Georg-Speyer-Haus, das direkt neben der Uniklinik gelegen ist, wieder ein Top-Institut der medizinischen Grundlagenforschung machen. Letztlich machte diese Aufgabe aufgrund der Erfolge aber auch viel Freude.
Innerhalb weniger Jahre schufen Sie aus dem bis dato vernachlässigten Georg- Speyer-Haus ein exzellentes Forschungsinstitut für Virologie und Onkologie mit 90 Mitarbeitern und einigen 100.000 Mark Lizenzeinnahmen im Jahr. Wie haben Sie das gemacht?
Indem ich versuchte, Gelder aus allen Quellen zu bekommen und gut ausgebildete und engagierte Forscher an das Institut zu holen. Einerseits hatten wir eine Diagnostik-Abteilung, die mit den Tests Geld verdiente und dieses dem Institut zur Verfügung stellte. Andererseits stellte ich Anträge an deutsche und EU-Förderstellen und startete auch eine Kooperation mit der WHO. Die dritte Quelle, um Geld zu beschaffen, waren aber auch die Kooperationen mit der Industrie. Ich hatte da keine Berührungsängste.
Wir gingen eine fünfjährige Kooperation mit Hoechst und Bayer ein, um Medikamente gegen HIV zu finden, wir arbeiteten mit der heutigen Qiagen und später Abbott an einem diagnostischen HIV-Test, der zu erheblichen Lizenzeinnahmen führte. Und am Anfang gelang es mir auch, die Stadt zu überzeugen, dass sie uns das Gebäude weiterhin zur Nutzung überlassen würde. Schließlich gelang es auch, Bund und Land zur Zusage der Mittel zu bewegen, um eine grundlegende Renovierung des Gebäudes durchführen zu können.
Die Firma Bayer machte Ihnen 1994 das Angebot, die Leitung der Virus-Forschung zu übernehmen. Sie nahmen an, unter der Bedingung, ihre Professur an der Universität Frankfurt behalten zu können. Haben Sie den Wechsel in die Industrie jemals bereut?
Ich habe zunächst gezögert und »Nein« gesagt, weil das Georg-Speyer-Haus gerade so weit war, wie ich wollte und ich eigentlich die Früchte meiner Aufbauarbeit hätte genießen können. Auch wollte ich die Diplomanden und Doktoranden, die ich damals betreute, nicht im Stich lassen und die akademische Lehre machte mir Freude. Bayer bot aber an, dass ich in der Anfangszeit einen Tag pro Woche in Frankfurt sein dürfte und das stimmte mich um. Ich habe den Wechsel definitiv nicht bereut, weil es etwas völlig anderes ist, im Labor in einem positiven Test zu sehen, dass eine Substanz ein Virus hemmt, als daraus ein Medikament zu machen. Die Substanzen, die zu Medikamenten werden sollen, müssen viele zusätzliche Eigenschaften haben, und das alles in einem einzigen Molekül zu vereinen, ist eine hohe Kunst, sozusagen die Optimierung eines vieldimensionalen Raums – die im Übrigen oft auch nicht möglich ist. Das lernen zu können, hat viel Spaß gemacht und dafür bin ich sehr dankbar.
Mit der Bayer-Ausgründung AiCuris wurden Sie von der Wissenschaftlerin zu einer äußerst erfolgreichen Unternehmerin für Virustatika. Wie ist es, im Chefsessel zu forschen?
Der Chefsessel stand am Anfang nicht im Vordergrund. Als Bayer mir sagte, man wolle die Infektionsforschung stoppen und mir anbot, ich könne eine neue Firma gründen, müsse das Geld dafür aber selbst beschaffen, war mir die Herausforderung klar: Wir würden mindestens 120 Millionen Euro brauchen für mindestens fünf Jahre, um eines unserer Projekte in die Nähe einer Markt-Zulassung zu bringen.
Wir würden die gesamte Infrastruktur neu aufbauen müssen, da wir nichts von Bayer übernehmen konnten und wir, die wir bis dahin »nur« Wirkstoffe erforscht und erfunden hatten, sie aber nie am Menschen getestet hatten (das machten bei Bayer andere Abteilungen), mussten das alles auch erst noch lernen. Insgesamt war diese Zeit aber extrem spannend und das ging auch meinen Mitarbeitern so. Wir alle hatten viel mehr Verantwortung, konnten aber auch viel mehr bewegen und entscheiden als in einem Großkonzern. Es war natürlich aber auch eine Zeit mit sehr viel Arbeit, in der ich sehr viel Verantwortung hatte.
Gerade deswegen habe ich auch als Chefin immer versucht, die Originaldaten anzusehen und ein tiefes Verständnis für unsere Projekte zu haben. Heute bin ich sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein, denn sonst gäbe es unser Medikament Prevymis® gegen das Cytomegalievirus nicht. Ohne die Gründung und den Aufbau der AiCuris hätten wir es nicht ent- wickeln können – da muss ich auch meinen Kollegen sehr dankbar sein, die diesen Weg mit mir gegangen sind.
Prevymis® wurde 2017 zugelassen und schützt schwerstkranke Transplantationspatienten gegen das Virus. Der Bundespräsident hat uns 2018 dafür mit dem Zukunftspreis geehrt.
Für zunehmend mehr Pharmakonzerne lohnt sich die Antibiotikaforschung nicht mehr. Was droht uns hier?
Die Preise für Antibiotika sind verfallen, weil viele von ihnen heute von Generika-Herstellern billig angeboten werden können. Man erwartet dann leider aber auch, dass ein neues Antibiotikum so billig sein muss, aber dafür kann man es nicht erforschen und klinisch am Menschen testen.
Das führte dazu, dass fast alle Großfirmen sich aus diesem Gebiet zurückgezogen haben, so auch die Firma Bayer, bei der ich damals die Infektionsforschung leitete. Aus der Überzeugung, dass man Infektionsforschung in einer globalisierten Welt braucht, gründete ich dann die Firma AiCuris und führte mit der bei Bayer erarbeiteten Pipeline die Forschung an antiviralen Substanzen und an Antibiotika fort.
Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Vermutlich dies: Herausforderungen anzunehmen, eine Vision entwickeln, wo das Ziel ist und warum, daran zu glauben, dass es möglich ist (und damit auch andere zu überzeugen) und dann konsequent dafür zu arbeiten.
Helga Rübsamen-Schaeff
Medizin hat sie früh interessiert: Bereits mit 14 Jahren arbeitete Helga Rübsamen-Schaeff sonntags freiwillig im Krankenhaus, um den Schwestern zu helfen. Als sie dann mit 18 Jahren das Abitur in der Tasche hatte, traute sie sich nicht, diesen Berufsweg einzuschlagen. Die angehende Studentin hatte Sorge, sie könnte als Ärztin Fehler machen, die sie sich nie verzeihen könnte. Helga Rübsamen-Schaeff (so ihr Name in zweiter Ehe) stammt aus dem oberfränkischen Münchberg und studierte zunächst in Münster Chemie. Schon vor ihrer Promotion, mit der sie mit nur 24 Jahren 1973 ihr Studium abschloss, hatte sie eines ihrer Berufsziele definiert: »Ich will wissen, wie aus einer normalen Zelle eine Krebszelle wird.« Ihren Weg fand sie, indem sie ihren Neigungen folgte: Medizinische Forschung war ihr Ziel.
Das Handwerkszeug der Biochemie erlernte sie als Postdoktorandin an der Cornell Universität im US-Bundesstaat New York, das der Molekularbiologie später in Harvard. Angebote für Assistenzprofessuren dort lehnte sie allerdings ab. Die kulturellen Unterschiede waren ihr zu groß, trotz der fantastischen Bedingungen an den herausragenden Universitäten in den USA. Helga Rübsamen-Schaeff zog es zurück nach Deutschland. Das, was sie gelernt hatte, wollte sie hier umsetzen. Über die Biochemie und die Krebsforschung kam die engagierte Wissenschaftlerin in die Virologie und dann in die pharmazeutische Forschung. Für die Pharma-Forschung, sagt Helga Rübsamen-Schaeff, sei ihr Wissen über Chemie ausgesprochen hilfreich, weshalb sie für ihr Chemiestudium als »Grundausbildung« sehr dankbar sei.
Helga Rübsamen-Schaeff gelang es, am Georg-Speyer-Haus erstmals in Deutschland mehrere Varianten der HI-Virustypen zu finden und zu charakterisieren. Es wurden Tests entwickelt und nach Ansätzen für Medikamente gegen das Virus gesucht. 1987 wurde sie Direktorin des Georg-Speyer-Hauses und ein Jahr später Professorin für Biochemie und Virologie mit dem Schwerpunkt Krebsforschung an der Frankfurter Universität. Ihr späterer Wechsel zur Bayer AG und die Grün- dung des eigenen Pharmaunternehmens AiCuris scheint nur folgerichtig: Bis heute wird Helga Rübsamen-Schaeff nicht müde, engere Kooperation zwischen universitärer Forschung und industrieller Nutzung, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zu fordern. Sie sei, sagt Helga Rübsamen-Schaeff, genau da, wo sie hingehöre.
Die Fragen stellte Heike Jüngst.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 45 des Alumni-Magazins Einblick erschienen.