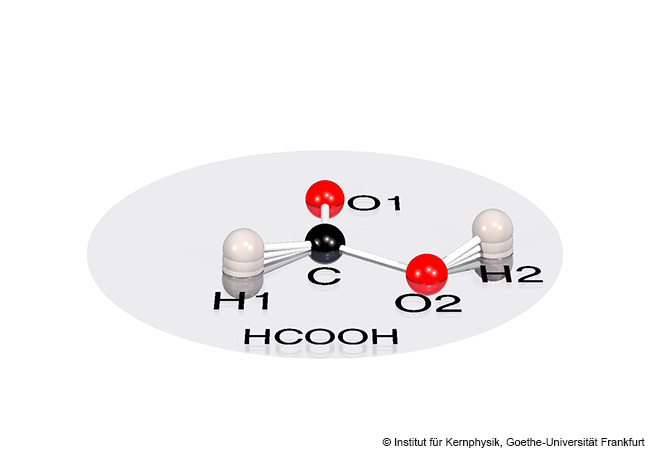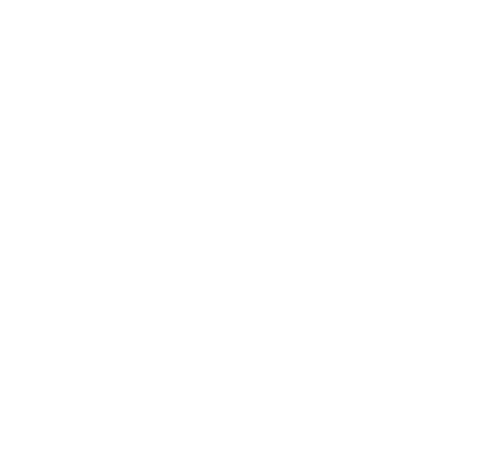Der politische Philosoph Rainer Forst über die Mechanismen der Demokratie

Unser Zusammenleben basiert auf normativen Ordnungen. Auch die Demokratie ist eine solche Ordnung. Ihre Regeln sind nicht statisch, sie können verändert, angepasst werden. Doch was, wenn die Menschen der Demokratie nicht mehr vertrauen? Darüber sprach »Forschung Frankfurt« mit Rainer Forst, Professor für politische Philosophie an der Goethe-Universität.
Forschung Frankfurt: Herr Professor Forst, Sie sind Direktor des Forschungszentrums Normative Ordnungen, dem früheren Exzellenzcluster. Mit Frau Professorin Fuchs-Schündeln sind Sie Sprecher des Profilbereichs »Orders and Transformations«. Sind Sie eigentlich ein ordentlicher Mensch?
Rainer Forst (lacht und deutet auf seinen Schreibtisch): Ich bin eigentlich überhaupt nicht ordentlich, obwohl ich seit Jahren für das Thema Ordnungen zuständig bin. Als jüngst ein Artikel über mich erschien, der mich allzu großzügig den »Messi der Philosophie« nannte, weil ich trotz verlockender Angebote in Frankfurt geblieben bin, sagten meine Familie und Freunde verschmitzt, das könne auch einen anderen Sinn haben.
In unserem Gespräch soll es aber ja um die Ordnung in unserer Gesellschaft gehen. Die Staatsform der liberalen Demokratie ist an vielen Stellen bedroht – zumindest hört man das allenthalben. Ist die Demokratie in einer Krise?
So pauschal lässt sich das nicht beantworten. Wir leben in einer Zeit vieler Krisen in der Demokratie, und es könnte zu einer echten Krise der Demokratie kommen, wenn diese sich nicht lösen oder abmildern lassen. Die Krise ist ja der Moment, an dem es auf der Kippe steht, ob und wie es weitergeht; entsprechend vorsichtig sollte man mit dem Begriff umgehen. Es gibt zweifelsohne reale Prozesse der Entfremdung vom existierenden System der Demokratie, die vielerlei Ursachen haben, insbesondere zwei: kulturelle Vorbehalte gegen die Veränderungen, die insbesondere Migration mit sich bringt, und soziale Benachteiligung und entsprechend mangelnde Perspektiven. Diese werden leider oft zu einem unguten Gemisch des Ressentiments verbunden, aber man muss sie auseinanderhalten. Die erstgenannte Haltung ist fremdenfeindlich und somit antidemokratisch; bei der zweiten Problematik werden zuweilen der Demokratie Missstände zugerechnet, die eigentlich aus Wirtschaftsimperativen einer kapitalistischen Ordnung herrühren. So manche Unzufriedenheit mit der existierenden Demokratie speist sich eigentlich aus demokratischem Geist, andere wieder aus dem Gegenteil.
Wenden sich die Menschen aus wirtschaftlicher Not von der Demokratie ab?
Die tiefer liegende Problematik des Verlusts von Vertrauen in Politik ist, dass ein Teil der Bevölkerung den Eindruck hat, dass, wie auch immer das politische Spiel ausgeht, für sie wenig dabei herauskommt. Und dann geht man nicht mehr wählen oder wählt aus Protest eine rechtsradikale Partei – und zwar nicht nur in Ostdeutschland. Die Entwicklung von Einkommen und Vermögen in unserem Land (und auch anderswo) ist erschreckend. Verantwortliche Politik kann darauf nicht nicht reagieren, sondern muss Menschen mit niedrigen Einkommen das Leben effektiv strukturpolitisch erleichtern.
Oft heißt es, der andauernde Streit in der Ampelregierung trage zur Politikverdrossenheit bei. Sehen Sie das auch so?
Sicher stören sich viele Leute daran, wenn eine Regierung länger braucht, um sich zu Beschlüssen durchzuringen, und wenn sie ihre Differenzen offen austrägt. Für mich ist es aber nicht die Tatsache, dass da gestritten wird, die zu Vertrauenseinbußen und Enttäuschung führt, sondern die Tatsache, worüber gestritten wird.
Darf und soll in einer Demokratie nicht über alles gestritten werden?
Dass eine Kindergrundsicherung in Teilen zur Disposition gestellt wird – das führt zu einem Vertrauensverlust bei Leuten, die auf solche Mittel angewiesen sind. Die verstehen nicht, wieso genau an diesem Punkt gespart werden soll.
Immer mehr Menschen wählen die AfD – obwohl inzwischen jeder wissen müsste, dass sie damit eine antidemokratische Partei wählen.
Natürlich sollte, wer die AfD wählt, wissen, dass das eine rechtsradikale, menschenfeindliche Partei ist. Aber viele nehmen das bestehende System als ihnen gegenüber feindlich eingestellt wahr und wähnen sich im Modus der Selbstverteidigung, wenn sie so abstimmen. Viele fühlen sich »überfremdet«, ja sogar kolonisiert in ihren Lebenswelten. Und dabei spielen autoritäre, rassistische, muslimfeindliche Einstellungen eine große Rolle. Mit Slogans wie »Das Volk muss sich wehren und sich mal wieder Gehör verschaffen!« erzielt die AfD leider rhetorische Punkte. Das ist regressiv, die Verneinung grundlegender Standards des demokratischen Zusammenlebens.
»Viele Menschen sehen sich in einer Situation kultureller, ökonomischer und sozialer Unsicherheit«
Woher rührt der Vertrauensverlust derer, die wirtschaftlich keine Not leiden?
Viele Menschen sehen sich in einer Situation kultureller, ökonomischer und sozialer Unsicherheit, auch wenn sie nicht Not leiden. Sie sind sehr offen für jemanden wie Trump, der sagt: Ich weiß, was euch fehlt; ich habe politische Lösungen, die eure Situation verbessern, sowohl ökonomisch wie auch in Bezug auf euren sozialen Status. Das wirkt besonders bei Leuten, die sehr konservative Ansichten vertreten und denken, sie verkörperten eine »Leitkultur«. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts haben sie den Ton in der Gesellschaft angegeben. Durch kulturelle Veränderungen fühlen sie sich stark herausgefordert; die Debatte über die gendergerechte Sprache ist dafür ein Beispiel, die Migrationsdiskussion ein anderes. Und eine gewisse Radikalität und auch Brutalität der Rhetorik kommt daher, dass diese Gruppen sich jetzt in der Defensive fühlen und fürchten, sie können nicht mehr bestimmen, wie das Spiel gespielt wird.

Sind also die Konflikte, die die Demokratien bedrohen, gar nicht demokratiespezifisch?
Die ökonomischen Umwälzungen seit den 1990ern, verschärft seit der Finanzkrise zu Beginn des 21. Jahrhunderts, haben politische und ökonomische Veränderungen großen Stils mit sich gebracht. Die Gesellschaften haben darauf unterschiedlich reagiert. Wie man bei Thomas Piketty nachlesen kann: Die Einkommens-, aber besonders die Vermögensverhältnisse haben sich nicht nur in westlichen Gesellschaften stark verändert, auch weil wir eingebunden sind in ein globales Wirtschaftssystem, dessen Regeln kaum noch politisch bestimmt werden können – zumindest nicht im gegebenen Rahmen. Viele Konflikte, auch solche, die der Klimawandel oder die digitale Transformation mit sich bringen, sind nicht demokratieimmanent, aber sie werden in demokratischen Gesellschaften besonders stark und offen ausgetragen. Wenn Demokratien die Konflikte nicht produktiv verarbeiten können, wenn sie es nicht schaffen, zu zeigen, dass demokratische politische Macht in diesen zentralen Fragen unseres Lebens noch effektiv sein kann, dann kommen Gruppen und versprechen, dass sie »Take back control« oder »Make America great again« leisten können. Sie gewinnen Abstimmungen und Wahlen und betrachten dies als demokratischen Erfolg.
Sie haben jetzt schon häufiger den Begriff des Vertrauens erwähnt, der ja auch im Clusterprojekt »ConTrust« eine wichtige Rolle spielt. Wie entsteht Vertrauen eigentlich genau?
In der Forschungsinitiative »ConTrust« gehen wir davon aus, dass man lange an der falschen Stelle gesucht hat, um Vertrauensdynamiken in modernen Gesellschaften zu verstehen. In diversen Disziplinen wurde gedacht, Vertrauen beruhe auf Vertrautheit: Je weniger gesellschaftliche Pluralität, Differenz und Auseinandersetzungen, desto mehr Vertrauen ist möglich. Uns scheint hingegen, dass die Dynamiken moderner Gesellschaften wie auch die in internationalen Beziehungen anders funktionieren. Heterogenität und Konflikte sind nicht mit Vertrauen unvereinbar – es kommt vielmehr darauf an, wie sie strukturiert und ausgetragen werden.
»Demokratien hängen davon ab, dass wir verstehen, dass tiefgreifende Konflikte nicht einfach verschwinden«
Schwindet das Vertrauen in die Politik, weil Konflikte nicht ausgetragen werden?
Demokratien, aber auch andere politische Systeme jenseits des Staates hängen davon ab, dass wir verstehen, dass tiefgreifende Konflikte nicht einfach verschwinden. Konflikte können aber so verlaufen und erlebt werden, dass dies vertrauensgenerierend wirkt. Wenn das nicht gelänge, könnte es moderne demokratische Systeme und Rechtsstaaten gar nicht geben. Das untersuchen wir nicht nur in der Politik und in Medien, sondern auch in der Ökonomie. Die moderne Ökonomie ist ja ein Konkurrenzsystem, und dennoch muss es Möglichkeiten der Vertrauensbildung geben, sonst würde es nicht funktionieren.
Daraus folgt ja, dass der öffentliche Streit gar nicht demokratieschädlich ist.
Genau. Wir gehen davon aus, dass komplexe politische Systeme überhaupt nur als Konfliktsysteme denkbar sind. Und wir untersuchen, unter welchen Voraussetzungen Vertrauen erzeugende Dynamiken in konflikthaften Gesellschaften entstehen. Unser Vertrauensverständnis bezieht sich also auf gelingende Konfliktprozesse: Wichtige Interessen werden verneint, andere hingegen werden respektiert, und vielleicht haben die Beteiligten diese zweite Kategorie von Interessen bisher nicht gesehen. Sie werden im Konflikt erst sichtbar. Das heißt nicht, dass es keine Vertrauensformen gibt, die jenseits von Konflikt entstehen. Es heißt auch nicht, dass jeder Konflikt Vertrauen erzeugt.
»Vertrauen ist auch nicht per se wünschenswert«
Zudem gilt es zu bedenken (wir sind ja in Frankfurt, dem Ort der Kritischen Theorie): Vertrauen ist auch nicht per se wünschenswert. Wenn es schlecht begründet ist, dann ist es nichts Wertvolles. Insbesondere dann nicht, wenn es auf eingespielte Formen, was gut und richtig ist, rekurriert und diese sozial eingewöhnte konventionelle Kraft etwa ins Rechtssystem einwandert. So wird etwa dagegen argumentiert, dass Muslimas mit Kopftuch Richterinnen sein können. Denn es sei denkbar, dass Menschen bei einer Richterin mit muslimischem Kopftuch weniger Vertrauen in das System des Rechts haben, das ja »neutral« sein muss. Das aber ist ein falsches Verständnis von Neutralität, denn es benachteiligt eine Gruppe, deren Religion nach den herkömmlichen Maßstäben »sichtbar« ist, während die anderer unsichtbar bleibt, aber dabei doch gegenwärtig ist. In einem Rechtsstaat aber kann nicht ein generelles Vorurteil, sondern können nur konkrete, begründete Einwände gegen bestimmte Personen diese in den Verdacht rücken, keine guten Richter*innen oder Staatsanwält*innen sein zu können. Solches Vertrauen ist Ergebnis eines Lernprozesses, auf dessen Möglichkeit wir in einer Demokratie hinarbeiten sollten. Mit Adorno zu sprechen, geht es darum, dass alle »ohne Angst verschieden sein« können.

Aber wie unterscheidet man wünschenswertes und nicht wünschenswertes Vertrauen?
Uns interessiert, wo in Konflikten immer noch eine Kultur der Kommunikation, der Rechtfertigung, des Eye-to-Eye besteht, die diese Konflikte nicht auflöst, aber dennoch so beschaffen ist, dass Vertrauen generiert werden kann. Die Maßstäbe für begründetes Vertrauen müssen kontextspezifisch analysiert werden, aber eine gewisse Form der Anerkennung spielt in jedem Kontext eine Rolle, die signalisiert, dass man einander nicht nur als Instrument betrachtet, sondern als Interaktionspartner in einem Kooperationszusammenhang. In diesem wird über Auseinandersetzungen ermittelt, worauf man sich verlassen kann und worauf nicht.
Wir sprachen vorhin ja schon über mögliche Ursachen des Vertrauensverlusts. Kann man sagen: Bestimmte Gruppen können gar kein Vertrauen mehr haben?
Die Demokratie ist ein anspruchsvolles Modell der Organisation des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Es geht nicht nur einfach darum, dass wechselnde Mehrheiten bestimmen, wo’s langgeht. Diejenigen, die auf Zeit zum Herrschen legitimiert sind, sind daran gebunden, dass sie alle anderen als Gleiche ansehen, vor denen sie rechtfertigen müssen, was sie im Sinne aller für richtig halten. Die Regierungsverantwortung schließt ein, dass man sich besonders vor den Schlechtestgestellten rechtfertigen muss, wieso ihre Situation durch politische Maßnahmen nicht verbessert werden kann. Deshalb ist der Demokratie ein Anspruch der Gerechtigkeit eingeschrieben. Wenn Teile der Gesellschaft mit geringen Ressourcen und schlechtem Status nur marginal berücksichtigt werden, dann kann von diesen Gruppen gar kein begründetes Vertrauen erwartet werden.
Guter Streit setzt also einiges voraus.
Richtig. Ein demokratischer Streit kann nur produktiv sein, wenn er auf Voraussetzungen beruht, nämlich, dass es ein Streit unter Gleichen ist. Das heißt nicht, dass alle gleich viel gewinnen. Aber sie müssen den Eindruck haben, dass sie in ihrem Grundstatus, ebenbürtiges demokratisches Subjekt zu sein, nicht verletzt werden.
Worauf beruht denn das Vertrauen der Gruppen, die zur Wahl gehen und das System nicht infrage stellen?
Hier zeigt sich wieder die Notwendigkeit, zwischen allseitig, einseitig oder gar nicht begründetem Vertrauen zu unterscheiden. Das Vertrauen einer tonangebenden Gruppe kann darauf beruhen, dass sie wissen, sie werden gut abschneiden – zulasten anderer. Dann ist ihr Vertrauen aus ihrer Perspektive gut begründet, aber nicht aus einer allgemein demokratischen Perspektive, denn es könnte sein, dass sie anderen Grundrechte entziehen wollen. Demokratien sind jedoch keine Selbstbehauptungs- und Bereicherungsinstrumente für Mehrheiten, sondern Demokratien sind (idealerweise) Organisationsformen, in denen um das, was für alle gelten soll, auf einer Ebene gerungen wird, auf der die besten Rechtfertigungen, die allen gegenüber gegeben werden können, in die Gesetze einfließen. Demokratisches Vertrauen, recht verstanden, setzt zumindest ernsthaftes Bemühen darum voraus.
Aber ich muss mich auch mit Menschen auseinandersetzen, die das anders sehen?
Ja. Deutlich zu machen, dass eine Haltung rassistisch ist, ist aber keine Form der Missachtung, sondern eine Form der Achtung. Die wirkliche Krise der Demokratie droht dort, wo die Menschen nicht mehr wissen oder wissen wollen, dass Demokratie eine gelebte Form des Respekts und der Teilung von Macht ist.
Wo sind die Rechtfertigungen verankert? Im Grundgesetz?
Auch das Grundgesetz beruht auf bestimmten grundlegenden Normen. Was heißt eigentlich Menschenwürde? Die Menschenwürde ist eigentlich (und jetzt spricht der Kantianer) die Idee, dass im Raum der Normen, die für uns alle gelten sollen, wir Gleiche sind in dem Maße, dass, wenn ich glaube, unser gemeinsames Leben sollte so und so eingerichtet werden, ich das nicht nur vor dir so rechtfertigen können muss, dass ich dir ein paar Gründe hinwerfe, und die kannst du annehmen oder nicht. Sondern ich muss dir Gründe liefern als gleichberechtigter Person mit einem Recht auf Rechtfertigung, die mir ebenbürtig ist.
»Wenn Demokratie schiefgeht, verfestigen sich Privilegiensysteme«
Und das gilt für alle Themen, die in der Demokratie verhandelt werden?
Wenn es gut geht, wird in der Demokratie die Rechtfertigung dessen, was für alle gilt, immer weiter ausgeweitet, und die Gemeinschaft der Gleichen, und zwar der sozial und politisch Gleichen, aber dabei kulturell unterschiedlich bleiben Dürfenden, wird in einem egalitären Sinne definiert. Wenn Demokratie schiefgeht, dann verfestigen sich Privilegiensysteme – ob kultureller, religiöser, sozialer oder ökonomischer Art. Die Demokratie bleibt prekär, wenn man sie nicht in Bezug auf die Grundlagen der Gerechtigkeit und des gleichen Respekts durchbuchstabiert.
Das bedeutet, dass in einer demokratischen Gesellschaft ständig alle mit allen in einem Dialog bleiben müssen, vor allem natürlich in einer multikulturell geprägten Gesellschaft.
Wir müssen davon ausgehen, dass Kollektive über sich selbst nachdenkende, lernende Entitäten sein können, die eine bestimmte Form von gleicher Achtung an den Tag legen können. Wenn es das nicht gäbe, wäre der Versuch der Überwindung von Schranken etwa zwischen Schwarzen und Weißen in den USA hoffnungslos. Ein Kampf, wie wir sehen, der nicht gewonnen ist. Auch nicht hierzulande, was rassistische Diskriminierung angeht.

Aber auch nicht verloren.
Er ist weder verloren noch sinnlos. Genauso wie der Kampf von Frauen für Emanzipation, der Kampf von gleichgeschlechtlichen Lebensformen für Gleichberechtigung, der Kampf für soziale Besserstellung – nichts ist endgültig gewonnen. Und es gibt Rückschläge – bis hin zur Regression, der Bekämpfung von Gleichberechtigung. Wir haben ja gerade 175 Jahre Paulskirche begangen und müssen uns in diesem Zusammenhang die komplexe Geschichte der Kämpfe für wie auch gegen Demokratie in Deutschland vergegenwärtigen. Auch heute müssen wir fragen: Ab wann untergräbt eigentlich eine ökonomische Ordnung, die auf Ungleichheit beruht, eine demokratische Ordnung? Diese Frage der »alten« Frankfurter ist nach wie vor virulent. Und auch eine weitere, mit der sich die Frankfurter Schule befasst hat: Wie schleifen sich kulturelle Stereotype bis hin zu gravierenden Rassismen in Gesellschaften ein? Bisweilen, denke ich, auch über ideologische Verwendungen des Begriffs »Vertrauen«.
Hat sich die Gesellschaft seit den 1960er Jahren nicht verändert?
Natürlich. Die Art, wie heute über Gleichberechtigung in manchen Bereichen, auch über politische Mitbestimmung, gedacht wird, hat sich sehr verändert; betrachten wir nur die verstärkte soziale Akzeptanz von Homosexualität (trotz vieler weiter bestehender Vorbehalte). Aber es wäre zu optimistisch zu glauben, dass wir auf einem stetigen Weg der Vervollkommnung demokratischer Ordnungen wären. Das waren wir nie. Es sind immer Kämpfe nötig gewesen. Und es gibt immer Rückschläge. Dass auf den ersten schwarzen Präsidenten in den USA ein rassistischer Populist wie Trump folgt, muss einen empören, kann aber leider, soziologisch betrachtet, kritisch erklärt werden.
Wenn es so viele Rückschläge gibt, woher kommt doch immer wieder ein Vertrauensvorschuss für die Demokratie?
Vertrauen ist immer ein Vorschuss. Ob es um eine Person geht oder eine Institution: Man weiß nie, was das Gegenüber tun wird, wie eine Institution sich entwickelt. Vertrauen ist immer mit Unsicherheit verbunden, einem Risiko, einer Vorleistung in Bezug auf die Motivation und Kompetenz anderer, wie auch Luhmann sagt. Aber es gibt natürlich Voraussetzungen: Ich nenne das, in Anlehnung an Habermas, eine Kultur der Kommunikation auf Augenhöhe. Beim Vertrauen geht es im Kern um ein Ernstgenommenwerden, ein Respektiertwerden trotz und gerade im Konflikt. Die Zeiten homogener Gesellschaften sind vorbei, und recht besehen gab es sie auch nie.
Die Fragen stellten Pia Barth und Anke Sauter.
Zur Person
Rainer Forst ist Professor für Politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität, Direktor des Forschungszentrums »Normative Ordnungen« sowie Co-Sprecher der Forschungsinitiative »ConTrust – Vertrauen im Konflikt«. Er leitet außerdem weitere wichtige Drittmittelprojekte. Im Zentrum seiner Forschung stehen Fragen von Gerechtigkeit, Demokratie und Toleranz. Er befasst sich zudem mit der Fortentwicklung Kritischer Theorie und der Philosophie Kants. 2012 hat ihn die Deutsche Forschungsgemeinschaft als wichtigsten politischen Philosophen seiner Generation mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Er ist Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der British Academy. Forst hatte renommierte Gastprofessuren in den USA inne (unter anderem an der New School for Social Research in New York und der University of Michigan) und lehnte mehrere Rufe aus den USA und von deutschen Universitäten ab. 2021 war er Fellow am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles.
Forsts wichtigste Publikationen (alle bei Suhrkamp und in viele Sprachen übersetzt): »Kontexte der Gerechtigkeit« (1994), »Toleranz im Konflikt« (2003), »Das Recht auf Rechtfertigung« (2007), »Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse« (2011), »Normativität und Macht« (2015), »Die noumenale Republik« (2021). Sein Werk wird international breit rezipiert, sowohl auf Symposien als auch in Zeitschriften wie »Political Theory« und »Philosophy and Social Criticism«.