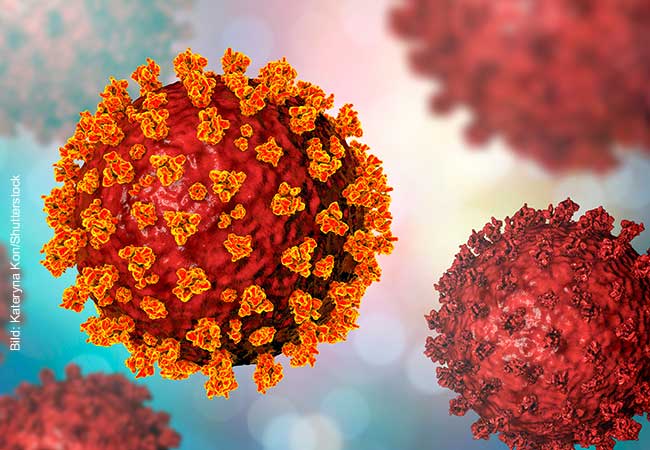Expertinnen und Experten der Goethe-Universität mit Einschätzungen und Prognosen.
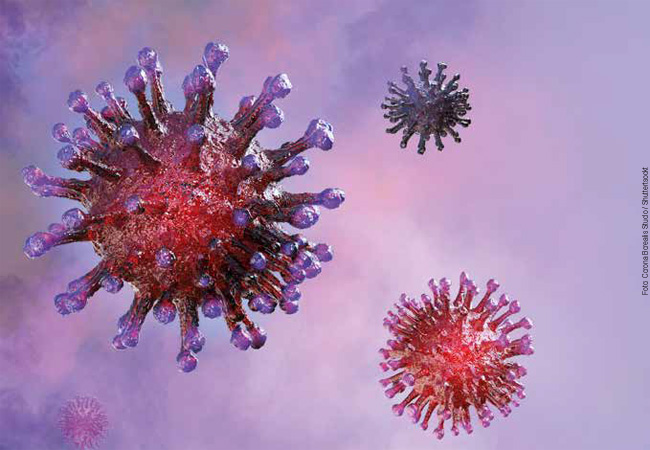
Nicht nur medizinische Einschätzungen der COVID-19-Pandemie sind im Augenblick stark gefragt. Wie sieht es aber mit einer rechtlichen Einschätzung der Kontaktsperre aus? Was sagt die Ökonomie zu den erwartenden wirtschaftlichen Folgen? Wie reagieren Menschen auf die fehlenden Sozialkontakte, wie hat man in der Geistesgeschichte über solche Ausnahmesituationen nachgedacht? Wir haben einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Goethe-Universität aus verschiedenen Disziplinen dazu befragt.

Prof. Dr. Rolf van Dick,
Sozialpsychologe und Vizepräsident der Goethe-Universität
Für die jetzige Situation gibt es im Nachkriegsdeutschland keine Erfahrungswerte. Man sollte aber nicht unterschätzen, wie rasch sich Menschen an neue Situationen anpassen. Wenn wir uns außerhalb der Arbeit nur noch zu zweit draußen aufhalten dürfen, werden wir nach zwei Wochen nicht mehr stündlich darüber nachdenken, dass wir eigentlich lieber zu viert unterwegs wären. Derzeit ist ja viel von „Social Distancing“ die Rede – davon, physisch Distanz zu halten. Soziale Nähe dagegen ist in Krisenzeiten wichtiger denn je. Meine Forschungen und die von Kollegen haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass es uns hilft, Krisen zu bewältigen und gesund zu bleiben, wenn wir uns in Gruppen zusammenschließen. Wir nennen das „social cure“ – Menschen haben im Lauf der Evolution gelernt, dass sie nur so überleben können. Das steckt tief in unseren Genen. Jeder von uns hat ein starkes Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören – das zeigt sich in Krisen noch deutlicher. Wir führen auch aktuell – unterstützt von den Freunden und Förderern der Goethe-Universität – eine international angelegte Studie durch, um dies in der momentanen Situation genauer zu erforschen. Auf der anderen Seite richtet sich in einer solchen Situation der Fokus auch stärker auf die persönlichen Bedürfnisse, und dann tritt Egoismus zutage. Beide Tendenzen schließen einander nicht aus: Ich kann durchaus solidarisch handeln und mich fünf Minuten später als Egoist erweisen und einen Hamsterkauf tätigen. Die solidarische Stimmung könnte sich ändern, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt oder zu vielen Toten infolge der Infektionen. Dann könnte entscheidend sein, wie in den Medien berichtet wird – sowohl in Zeitungen und Fernsehen als auch in den Sozialen Netzwerken. Seriös kann man über die gesellschaftlichen Verwerfungen der Corona-Krise erst sprechen, wenn wir wissen, wie groß die ökonomischen Folgen tatsächlich sind. Wir können vielleicht aus der Krise lernen. Vielleicht wird es nochmals einen Schub in der Digitalisierung geben, was zum Beispiel die Lehre und Zusammenarbeit an Universitäten auch dauerhaft modernisieren kann. Und auch für die deutsche Wirtschaft könnte die Krise in einigen Monaten Chancen eröffnen.

Prof. Dr. Volker Wieland,
Ökonom, Mitglied des Sachverständigenrats
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Aus wirtschaftlicher Sicht bringt die Corona-Krise in jedem Fall eine schwere Rezession. Welche Auswirkungen diese Rezession hat und welche Maßnahmen helfen können, haben wir mit dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einem Sondergutachten dargestellt. Bisher gibt es noch kaum aktuelle Daten und die Unsicherheit ist sehr groß. Deshalb haben wir unterschiedliche Szenarien analysiert. Zunächst geht es darum, das Gesundheitssystem in die Lage zu versetzen, kranke Menschen angemessen zu versorgen und die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Wenn dazu ein Stillstand von fünf Wochen nötig ist, gefolgt von zwei Wochen Erholung, verursacht dies einen Einbruch der Wirtschaft im zweiten Quartal, vergleichbar mit der Finanzkrise 2009. Für das ganze Jahr gerechnet würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um etwa 2,8 Prozent schrumpfen. Dies ist das Basisszenario, dem wir im Sachverständigenrat die höchste Wahrscheinlichkeit zumessen. Je länger der Stillstand andauert, um so grundsätzlicher sind auch die Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur. Bei unserem ersten Risikoszenario mit sieben Wochen Stillstand und drei bis vier Wochen Erholung – einem Kurvenverlauf vergleichbar mit einem ausgeprägtem V – bricht die Wirtschaftsleistung stärker ein. Folge wäre ein Einbruch des BIP von 4,5 Prozent im Jahresdurchschnitt. Aufholeffekte würden jedoch im kommenden Jahr für ein deutliches Wachstum sorgen. Sollten die Maßnahmen über den Sommer hinaus andauern, was einem Verlauf in Form eines langen U entspräche, könnte dies zu größeren Insolvenzen und Entlassungen führen. Die große Unsicherheit würde auch weitere Investitionen von Unternehmen ausbremsen und Verbraucher vor Käufen zurückschrecken lassen. Auch in diesem Fall würde das Wachstum 2020 deutlich einbrechen, aber auch im kommenden Jahr würde die Wirtschaft nur sehr verhalten wachsen. Es ist deshalb wichtig für die Regierung, in solch einer Extremsituation die Kontrolle zu behalten und in Absprache mit Epidemiologen und Virologen eine Ausstiegstrategie zu planen. Die jetzt anlaufenden Überbrückungsmaßnahmen wie Kurzarbeit, Bürgschaften, Kredite, direkte Zahlungen und Steuerstundungen sind sinnvoll.

Prof. Dr. Sandra Eckert,
Politikwissenschaftlerin
Wir sind in Europa mit einer nie dagewesenen Ausnahmesituation konfrontiert. Ihre Konsequenzen werden weit über jene der Wirtschafts- und Finanzkrise, die Europa in diesem Jahrtausend bereits erschüttert hat, hinausgehen. Entscheidungsträger stehen vor der Herausforderung, drastische Maßnahmen zu ergreifen und zu rechtfertigen. Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben fast vollständig auszusetzen, kann, ja darf in einer Demokratie keine leichte Entscheidung sein. Ebenso wenig darf es in einem vereinten Europa eine leichte Entscheidung sein, Grenzen zu schließen und damit Grundfesten des Einigungsprozesses, nämlich die Personenfreizügigkeit oder den freien Warenverkehr, auszusetzen. Es war die Rede davon, dass der Virus keinen Reisepass besitze – und dennoch wurde unilateral in den Mitgliedstaaten gehandelt, ohne eine gemeinsame Abstimmung abzuwarten. Handlungsfähigkeit zu beweisen, ist in diesen Tagen die politische Währung, denn Abwarten kostet Menschenleben. Vielerorts wird dabei eine Kriegsrhetorik bemüht, um außergewöhnliche Maßnahmen zu legitimieren. Als Rechtfertigungsdiskurs geeigneter erscheint mir hingegen das Einfordern von Empathie – Empathie für diejenigen, die dem Virus und seinen Folgen schutzloser ausgesetzt sind, und zwar auf individueller, gesamtgesellschaftlicher und europäischer Ebene. Allerdings ist Empathie voraussetzungsvoll. Sie erfordert das Vertrauen in das verantwortungsvolle Handeln anderer, in das verantwortungsvolle Handeln der eigenen Regierung, und das gegenseitige Einstehen in Europa. Die ersten beiden Voraussetzungen sind in den europäischen Staaten nicht gleichermaßen ausgeprägt, was zumindest teilweise die nationalen Unterschiede im Krisenmanagement erklärt. Ob und in welchem Ausmaß die dritte Voraussetzung, das Vertrauen in den Zusammenhalt in Europa, bestärkt werden kann, wird entscheidend von den weiteren gemeinsamen Maßnahmen auf europäischer Ebene abhängen. Die Ansteckungsgefahr in Europa ist ernst zu nehmen: im direkten Wortsinn wie im übertragenen, ökonomischen Sinne.

Prof. Dr. Uwe Volkmann,
Rechtswissenschaftler
Die Corona-Krise oder besser die Art und Weise ihrer politischen Bewältigung fordert unsere bisherigen Vorstellungen vom Staats-und Verfassungsrecht in einer Weise heraus, die in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist. Weite Teile der Grundrechtsordnung der Bundesrepublik sind um der Erreichung eines als alternativlos ausgegebenen Ziels bis auf weiteres außer Kraft gesetzt, und dies, wie bereits die bisherige Diskussion herausgearbeitet hat, auf ausgesprochenen dünner und möglicherweise auch gar nicht ausreichender rechtlicher Grundlage. Dazu kommen institutionelle Machtverschiebungen zwischen Parlament und Exekutive, die ebenfalls intensiver Diskussion bedürften. Eine solche Diskussion findet allerdings bislang nicht oder nur in begrenztem Maße statt, weil die gegenwärtige Politik von weiten Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird und insgesamt eine Auffassung vorherrscht, nach der der Zweck die Mittel am Ende schon heiligen wird und angesichts der ungeheuren Dimension der Gefahr insbesondere juristische Bedenken leicht als kleinlich erscheinen. Gerade in Krisenzeiten erweist sich allerdings die Einhaltung verfassungsrechtlicher Verfahren und Formen in dem unter den Bedingungen der Krise möglichen Maß als unabdingbar. In demokratischer Hinsicht bedeutet dies vor allem, dass die Parlamente als die vom Volk unmittelbar legitimierten Organe so weit wie möglich in die grundlegenden Entscheidungen eingebunden werden müssen; entgegen der geläufigen Rhetorik des Not- oder Ausnahmezustands kann dieser eben nicht dauerhaft die Stunde der Exekutive sein. In rechtsstaatlicher Hinsicht bedarf es hinreichend klarer und bestimmt gefasster Ermächtigungsgrundlagen, die auch die Grenzen des jeweiligen Regierungshandelns erkennen lassen. Zuletzt ist es unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit eine durchaus offene Frage, wie lange auch unter den Bedingungen einer schweren Gefahr für höchste Rechtsgüter das gegenwärtige Notstandsregime aufrechterhalten werden kann.

PD Dr. Martin Stürmer,
Lehrbeauftragter für Virologie
und Leiter eines Medizinlabors
Die aktuelle SARS-CoV-2-Pandemie hat weltweit und entsprechend auch in Deutschland zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt. Neben der Erforschung des für uns alle neuen Erregers mit Hinblick auf tieferes Verständnis der Vermehrung und Verbreitung sowie Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen und Medikamenten spielt die flächendeckende Durchführung von Testungen eine entscheidende Rolle für die Frage, in welcher Form bestehende Maßnahmen fortgeführt bzw. modifiziert werden können. Bezüglich Medikamente werden aktuell Substanzen in klinischen Studien getestet, die für andere Indikationen zugelassen bzw. erprobt wurden. Erste Ergebnisse werden für Ende April erwartet, so dass gegebenenfalls schon ab Sommer schwer erkrankte Patienten therapiert werden können. Die Zulassung eines Impfstoffes ist vermutlich nicht mehr in diesem Jahr, sondern eher Anfang/Mitte 2021 zu realisieren. Aktuell werden in Deutschland mehr als 350 000 PCR-Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt, diese Zahl ist jedoch im Rahmen einer flächendeckenden Testung weiterhin zu niedrig. Allerdings befinden sich die meisten Laboratorien an der Obergrenze ihrer Kapazitäten, so dass entweder Modifikationen der bestehenden Teste oder alternative Testansätze wie z. B. Antigen-Schnellteste benötigt werden. Eine solche Modifikation in Form der Pooltestung ist kürzlich vom Blutspendedienst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Virologie veröffentlich worden, dadurch kann bei der zurzeit relativ niedrigen Positivrate ein deutlich höherer Probendurchsatz ermöglicht werden. Antigen-Schnellteste haben den Vorteil, dass sie ohne großen Laboraufwand sehr schnell Ergebnisse liefern, haben aber oft das Problem der zu geringen Sensitivität, daher ist aktuell auch kein solcher Test verfügbar. Die Testung auf Antikörper wird in den nächsten Wochen eine zunehmende Rolle in der Diagnostik einnehmen, um die tatsächliche Anzahl der Infizierten besser einschätzen zu können. Letztendlich ist es noch zu früh für eine Abschätzung, wann und in welcher Form die aktuellen Maßnahmen angepasst bzw. beendet werden, aber die oben genannten Entwicklungen werden das definitiv beeinflussen.

Prof. Dr. Martin Seel,
Philosoph
Auf dem Zimmer bleiben: Wenn die Zeiten sich ändern, ändert sich auch die Bedeutung mancher überlieferten Sätze. Sie können dann als Kommentare zu Situationen gelesen werden, die ihre Verfasser nicht im Blick haben konnten. So steht es in diesem Tagen mit einem berühmten, in der Mitte des 17. Jahrhunderts notierten Gedanken von Blaise Pascal: „Wenn ich mich zuweilen daran gemacht habe, die verschiedenen rastlosen Bewegungen der Menschen zu betrachten, und die Gefahren und Mühen, denen sie sich bei Hof, im Krieg aussetzen, wo so viele Leidenschaften, kühne und oft unrechte Unternehmungen usw. entstehen, habe ich oft gesagt, dass das ganze Unglück des Menschen einzig davon kommt, nicht ruhig in einem Zimmer bleiben zu können.“ Das liest sich fast wie eine amtliche Warnung in Zeiten der grassierenden Corona-Epidemie – aber doch nur fast. Denn Pascal empfiehlt die existenzielle Quarantäne nicht als vorübergehende Notmaßnahme, sondern wie ein Allheilmittel gegen das „Unglück“ der Menschen. Wir müssten uns daher glücklich schätzen, endlich auf dem Zimmer bleiben zu dürfen. Nur den wenigsten aber geht es so. Viele haben kein Zimmer, das ihnen Raum zur inneren Einkehr bietet, und jemand muss schließlich die Besorgungen erledigen. In Ruhe auf dem Zimmer zu bleiben, ist außerdem in Zeiten des multimedialen Vernetztseins auch nicht mehr das, was es einmal war. Für Ablenkung ist gesorgt. Für Pascal hingegen war der Hang des Menschen zu Spaß und Spiel ein Zeichen des Elends einer gottvergessenen Lebensführung. „Die Menschen beschäftigen sich damit, hinter einem Ball oder einem Hasen herzujagen; das ist sogar das Vergnügen der Könige.“ Sollen wir also in unseren Rückzugsgebieten auf derlei Vergnügungen verzichten? Können wir das überhaupt wollen? Können wir auf das Widerspiel von Bewegtsein und Bewegung verzichten? Es ist Pascal selbst, der seine Diagnose auf eine beunruhigende Weise einschränkt. „Unsere Natur liegt in der Bewegung, die vollständige Ruhe ist der Tod.“

Prof. Dr. Sabine Andresen,
Kindheitsforscherin und Vorsitzende der Unabhängigen Kommission
zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs
Sie habe ihren Kindern gesagt, dies sei wie Krieg ohne Bomben. Diese drastische Charakterisierung der Situation, die eine Mutter gegenüber ihren drei Kindern wählt, gibt beispielhaft wieder, wie groß der Druck von Eltern ist, ihren Kindern die Gefahr durch das Corona-Virus zu vermitteln. Zu Narrativen des Krieges greift auch die Politik, um der Bevölkerung die Einschnitte und Maßnahmen nahezubringen. Mütter und Väter sind besonders herausgefordert, denn sie müssen dafür sorgen, dass der mit der Pandemie neu aufgerufene Generationenvertrag „vor Ort“ verstanden und umgesetzt wird. Doch auch Erwachsenen fehlt meist der Überblick und so stellt sich die Frage, wie Kinder und Jugendliche die angebotenen Erklärungen hören, was sie empfinden, wenn sie die Großeltern nicht mehr sehen oder besuchen dürfen. Welche Gedanken gehen ihnen durch ihren Kopf, welche Gefühle entstehen, welche Bilder machen sie sich von ihrer Welt? Manche Kinder werden explizit um Erklärungen bitten, andere hingegen bleiben schweigsam. Kinder haben ein gutes Gespür, was sie gegenüber Eltern und anderen Erwachsenen thematisieren können und was sie besser nicht ansprechen. Wie so oft in der Erziehung geht es auch derzeit im Alltag zwischen Kindern und Erwachsenen um eine gute Balance. Die letzten Wochen haben also das Familienleben auf den Kopf gestellt und der Druck, unterschiedliche Bedürfnisse und widersprüchliche Interessen auszubalancieren, lastet auf vielen Familienmitgliedern. So wird die Betreuung von Kindern durch die Großeltern, die zuvor oft selbstverständlich und zur Aufrechterhaltung des Familienlebens notwendig war, plötzlich zum Risiko. Und so kommen vielleicht auch Kinder in die Situation, der im Pflegeheim isolierten Großmutter am Telefon erklären zu müssen, warum ein Treffen, gar eine Umarmung nicht möglich sind. Diesen vielfältigen Beiträgen, die Krise zu bewältigen, gilt es in der Forschung nun nachzugehen. In der Kooperation zwischen Kindheits- und Alternsforschung sprechen wir von „linking ages“, in der Übergangsforschung von „linked lives“. Aus dieser Perspektive wird deutlich, wie systemrelevant (Groß-)Mütter und (Groß-)Väter derzeit sind.

Prof. Dr. Frank Oswald, Alternswissenschaftler

Dr. Anna Wanka, Soziologin
Aus Sicht älterer Menschen stellt sich die Krise ebenfalls als problematisch dar. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass in der öffentlichen Berichterstattung völlig unhinterfragt ein Rückfall stattfindet in eine negative, einseitige und diskriminierende Verallgemeinerung aller „Alten“ als Risikogruppe. So haben wir alte Menschen zuletzt in den 80 er Jahren des letzten Jahrhunderts gesehen, so verwandelt sich ein Schutzmotiv in „Ageism“, also Diskriminierung aufgrund des kalendarischen Alters. Ebenso unverantwortlich ist es, seitens älterer Menschen das Risiko mit Verweis auf biographisch durchlebte Krisen (z. B. im Krieg) zu unterschätzen und sich selbst Gefahren auszusetzen. Zudem ergeben sich Herausforderungen im Austausch mit anderen Generationen. Dazu gehört neben der Organisation nachbarschaftlicher Hilfe die Aufgabe, soziale Nähe durch Technik auf Distanz herzustellen. Für hochbetagte alleinlebende ältere Menschen erhöhen sich das Risiko von Einsamkeit, Depressivität und die Suizidgefahr, besonders bei psychischen Vorbelastungen. Die vermehrte Isolation älterer Menschen hat nicht nur Folgen für sie selbst, sie macht auch die Leistungen sichtbar, die sie ansonsten für die Gesellschaft erbringen – von Enkelbetreuung bis ehrenamtlichem Engagement. Bereits ein Drittel der hessischen Tafeln wurde geschlossen, weil der Großteil der ehrenamtlichen Helfer*innen als „ältere Menschen“ zur Risikogruppe gehört. Ein weiteres Thema, schon vor Corona, ist die möglichst frühe Vermeidung von Gewalt in der häuslichen Pflege. Dazu liegen aus einem Projekt der Goethe-Universität konkrete Empfehlungen für Praxis und Gesetzgebung vor. Kritische Pflegesituationen verschärfen sich aber nochmals mutmaßlich durch die Begrenztheit auf das Private, ohne dass angemessen geholfen werden kann. Im Bereich der Heimversorgung spitzt sich die Lage zu durch Aufnahmestopps, Segregation und mangelhafte Ausrüstung. Zwar ist das näherrückende Lebensende im Heim ohnehin ein Thema, aber die Lage verschärft sich durch Hilflosigkeit im Umgang mit Isolation und Einsamkeit am Lebensende. Erschwerend ist zudem, dass sich Menschen mit Demenz die Notwendigkeit einer körperlichen Distanzierung nicht erschließt und sie Zuwendung brauchen. Ganz zu schweigen von fehlenden (ethischen) Regelungen zu Nähe und Distanz am Lebensende (nicht nur bei an COVID-19 Sterbenden).

Prof. Dr. Jürgen Müller,
Historiker
Derzeit wird häufig an die sogenannte Spanische Grippe erinnert, die am Ende des Ersten Weltkriegs auftrat, sich in mehreren Wellen über alle Kontinente verbreitete und nach Schätzungen zwischen 20 und 50 Millionen Todesopfer forderte. Diese Pandemie ist wie die Pest im Spätmittelalter noch im kollektiven historischen Gedächtnis präsent, während etwa die schweren Choleraepidemien des 19. Jahrhunderts weitgehend vergessen sind. Die Spanische Grippe unterscheidet sich von der aktuellen Pandemie dadurch, dass ihr vor allem Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren zum Opfer fielen. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass die Spanische Grippe auf eine vom langen Krieg erschöpfte Bevölkerung traf, was möglicherweise eine Erklärung für ihre besonders hohe Letalität ist. Das Coronavirus breitet sich demgegenüber mit enormer Geschwindigkeit auch in Gesellschaften aus, die weder unter Mangelernährung noch in besonderem Maße unter anderen physischen Defiziten leiden. Diese Gesellschaften haben keine Erfahrungen mit hochinfektiösen Krankheiten, gegen die es bislang keine medikamentöse Therapie und keinen Impfstoff gibt. Dies ist gewiss ein Grund für die große Verunsicherung einer Bevölkerung, die in den letzten Jahrzehnten davon ausgehen konnte, jenseits von individuellen Krankheiten keinem unkontrollierbaren, umfassenden Lebensrisiko ausgesetzt zu sein. Auch schien es unvorstellbar, dass das gewohnte soziale Leben und die Wirtschaft in kürzester Zeit zum Erliegen kommen könnten. Das ist eine historisch gesehen sehr seltene Situation gewesen, die nun offenbar der Vergangenheit angehört. Man muss befürchten, dass in unserer globalisierten und hochmobilen Welt ähnliche Pandemien öfter auftreten können. Dies sollte den Anstoß dazu geben, Fehlentwicklungen im Bereich des Gesundheitswesens (Privatisierungen, Unterfinanzierung, Personalnotstand) zu korrigieren, denn ohne eine leistungsfähige medizinische Infrastruktur wären wir den Pandemien genauso hilflos ausgeliefert wie die Gesellschaften in früheren Epochen.

Prof. Dr. Robert Gugutzer,
Sportwissenschaftler
Der Sport in der Corona-Krise: Im Umgang mit der Corona-Krise offenbart der Spitzensport im Moment zwei Gesichter: Ein zögerlich-ignorantes auf der einen, ein solidarisch-zivilgesellschaftliches auf der anderen Seite. Ersteres zeigt vor allem das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit seinem Präsidenten Dr. Thomas Bach, das zweite eine Vielzahl an Athletinnen und Athleten. Während das IOC eher widerwillig und erst am 24. März die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio bekanntgab, haben sich zahlreiche Sportlerinnen und Sportler deutlich früher als „mündige Athleten“ erwiesen und ihr Veto gegen die Spiele eingelegt. Darüber hinaus unterstützen viele Sportlerinnen und Sportler die Bevölkerung durch praktische Hilfen (Einkäufe für alte Menschen in Supermärkten, Mitarbeit bei Tafeln, Blutspenden etc.) und auf finanzielle Weise (Spendeninitiativen wie #WeKickCorona). Die Diskrepanz zwischen dem Anspruch einer moralischen Vorbildfunktion und dem Vorantreiben seiner Kommerzialisierung, die für den Spitzensport kennzeichnend ist, diese Janusköpfigkeit wird in einer Krisenzeit wie der aktuellen ganz besonders deutlich. Tatsache ist aber auch, dass der Spitzensport unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu leiden haben wird. Selbst finanzkräftige Sportarten wie der Profifußball werden diese Krise nicht unbeschadet überstehen. Das wird vor allem jene nationalen Ligen treffen, die besonders stark von TV-Geldern abhängig sind. So deutet sich bereits jetzt an, dass die exorbitanten Ablösesummen und Jahresgehälter für Fußballspieler der Vergangenheit angehören werden. Aber auch Sportarten, die nicht im Rampenlicht der Fernsehsender stehen und daher stärker von staatlichen Fördergeldern abhängig sind, werden mit finanziellen Einschränkungen zu rechnen haben. All dies wird auch soziale Folgen haben, etwa für den Nachwuchssport, wenn Vereine Übungsleiterstellen streichen müssen und Trainingsmöglichkeiten nicht mehr gegeben sind. Für den Sport heißt es derzeit eben auch: „Corona kicks us.“
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 2.20 des UniReport erschienen.