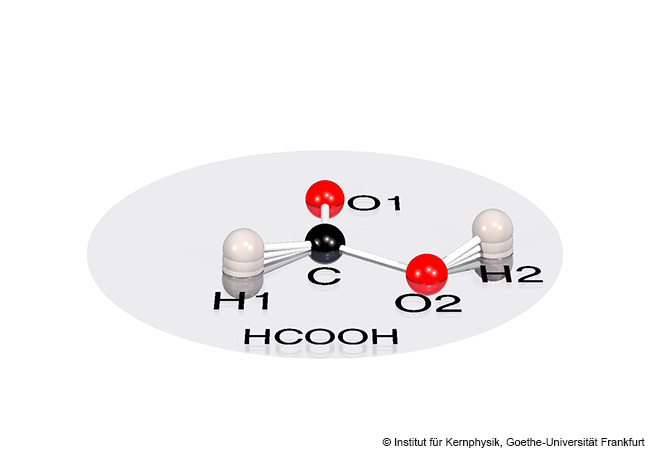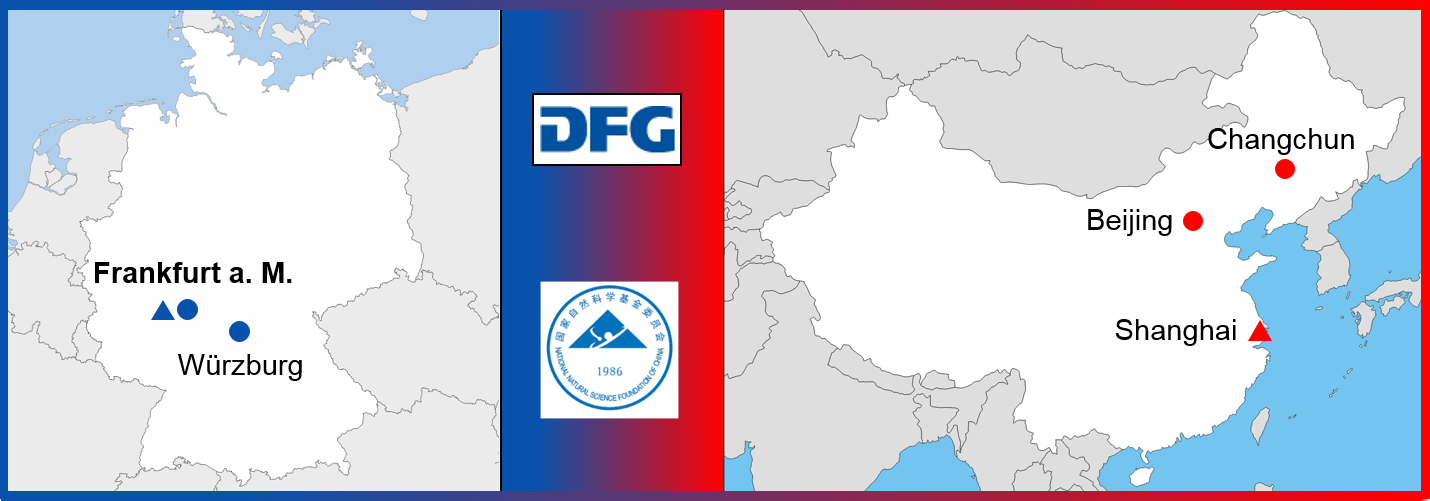 Bei einem „sino-german call“ der DFG haben sich zwei Anträge der Goethe-Universität gegen große Konkurrenz durchgesetzt. Von 567 eingereichten Anträgen wurden 131 ausgewählt. Darunter sind die Projekte von Prof. Matthias Wagner, Institut für Anorganische und Analytische Chemie, und Prof. Clemens Glaubitz, Institut für Biophysikalische Chemie. Beide Arbeitsgruppen werden in den nächsten 3 Jahren Forschungsprojekte gemeinsam mit chinesischen Universitäten durchführen.
Bei einem „sino-german call“ der DFG haben sich zwei Anträge der Goethe-Universität gegen große Konkurrenz durchgesetzt. Von 567 eingereichten Anträgen wurden 131 ausgewählt. Darunter sind die Projekte von Prof. Matthias Wagner, Institut für Anorganische und Analytische Chemie, und Prof. Clemens Glaubitz, Institut für Biophysikalische Chemie. Beide Arbeitsgruppen werden in den nächsten 3 Jahren Forschungsprojekte gemeinsam mit chinesischen Universitäten durchführen.
Worum geht es in Ihrem Projekt?
Clemens Glaubitz: Wir untersuchen lichtabsorbierende Membranproteine. Diese Proteine konvertieren Licht direkt in ein elektrochemisches Potential. Kleinste Variationen führen zu deutlich veränderten Farbanpassungen. Die genauen Details dieses „color tunings“ sind noch unverstanden, aber von großem Interesse für das Protein Engineering: Weil man die optischen Eigenschaften dieser Proteine an die Umgebung anpassen kann, sind ganz neue biomedizinische oder biotechnologische Anwendungen möglich.
Matthias Wagner: Unser Projekt dient der Entwicklung leistungsfähiger organischer Materialien für die Anwendung in Organischen Leuchtdioden (OLEDs) und in der Organischen Photovoltaik (OPV). Im ersten Fall soll aus Strom möglichst effizient Licht erzeugt werden, im zweiten Fall ist es genau umgekehrt. Der große Vorteil organischer Verbindungen liegt in ihrem günstigen Preis, ihrem geringen Gewicht, und in der Tatsache, dass sich ihre optischen und elektronischen Eigenschaften auf vielfältige Weise und sehr gezielt einstellen lassen.
Der besondere Clou ergibt sich allerdings erst daraus, dass unsere Moleküle nicht nur aus den üblichen Elementen – an erster Stelle Kohlenstoff – bestehen, sondern dass auch Boratome eingebaut werden. Diese Boratome verleihen den Materialien erst ihre besonders günstigen Eigenschaften – sie sind sozusagen das Salz in der Suppe. Die Synthese organischer Borverbindungen ist sehr anspruchsvoll und es müssen immer wieder neue Wege gefunden und beschritten werden.
Und da hilft es, wenn Experten auf diesem Gebiet international zusammenarbeiten…
Wagner: Ja, um die Erfolgsaussichten zu steigern, werden wir mit drei Kollegen kooperieren, die das „chinesisch-deutsche Forschungsprojekt“ mittragen: Suning Wang, die Professuren an der Queen’s University in Kingston, Kanada, und am Beijing Institute of Technology innehat, ist ebenfalls eine Spezialistin auf dem Gebiet der Darstellung neuer Borverbindungen. Professor Todd Marder von der Universität Würzburg wird die Materialien u.a. hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften untersuchen, und Professor Jun Liu von der Chinese Academy of Science baut am Ende die eigentlichen OLEDs zusammen.
Was sollte am Ende des Projekts herauskommen? Was ist Ihr Traum?
Wagner: Das ist ganz klar die Entwicklung dünner, hoch biegsamer Displays, die es endlich gestatten würden, z.B. Smartphones noch viel kleiner werden zu lassen, weil sich der Bildschirm bei Bedarf auf die nötige Größe entrollen und hinterher wieder auf kleinem Raum verstauen ließe. Für derartige Anwendungen sind mechanisch flexible organische Materialien prädestiniert.
Wie wird Ihr Projekt mit China organisatorisch ablaufen?
Glaubitz: Wir kooperieren mit Xiao He von der East China Normal University in Shanghai. In Frankfurt wird das Projekt mittels biochemischer Ansätze und vor allem mit Festkörper-NMR bearbeitet. Diese Daten werden in Shanghai mittels rechnergestützter Ansätze – hauptsächlich quantenchemischen Rechnungen und MD-Simulationen – in ein Modell „übersetzt“. Die optischen Eigenschaften, die sich aus diesem Modell vorhersagen lassen, überprüfen wir hier in Frankfurt wiederum experimentell. Das Projekt ist also zwischen Frankfurt und Shanghai nach Fachexpertisen aufgeteilt. Wir werden uns auch gegenseitig besuchen und Trainingskurse an beiden Universitäten abhalten.
Wagner: Wir haben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der National Natural Science Foundation of China (NSFC) Fördermittel für zunächst drei Jahre erhalten, um insgesamt 10 Doktorarbeiten zu finanzieren. Das Besondere an speziell diesem Verbundprojekt ist, dass jeder der jungen Doktoranden mindestens einmal während der drei Jahre für drei bis vier Monate an einer der anderen Universitäten arbeiten soll. Zusätzlich sind jährliche Treffen aller vier Gruppen geplant, bei denen die Ergebnisse diskutiert und die künftigen Ziele festgelegt werden. Hierzu laden wir auch auswärtige Kollegen ein. Insgesamt erwarten wir nicht nur eine fachlich fruchtbare Zeit, sondern das Projekt wird auch die interkulturellen Kompetenzen steigern.
Worin liegen für Sie die Vorteile einer Kooperation mit China?
Glaubitz: Unser Projekt ist primär wissenschaftlich getrieben, da der chinesische Projektpartner über für uns sehr interessante Fähigkeiten verfügt, die unsere Forschung sehr gut ergänzen. Generell stellen wir fest, dass es in China ein großes Potential sehr guter Arbeitsgruppen sowie große Investitionen gibt. Ein solches Projekt bietet daher, neben der offensichtlichen fachlichen Ergänzungen, die Möglichkeit, diesen politisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich sehr schnell aufstrebenden Teil der Erde besser zu verstehen um damit für zukünftige Entwicklungen sehr gut gerüstet zu sein.
Wagner: Das sehe ich auch so: China ist ein riesiger Absatzmarkt. Zudem haben etliche chinesische Universitäten in den letzten Jahren absolutes Weltniveau erreicht. Wenn ich in chemische Fachzeitschriften schaue, bin ich von Jahr zu Jahr mehr beeindruckt, wie schnell der prozentuale Anteil erstrangiger Publikationen aus China steigt. Darüber hinaus sind die größten Hersteller von Solarzellen, Computern und Smartphones mittlerweile in Fernost zu finden: Denken Sie an LG und Samsung aus Südkorea oder Huawei bzw. Xiaomi Tech aus China. Die beiden letztgenannten wurden erst 1987 bzw. 2010 gegründet und wechseln sich seither bei der Marktführerschaft für Handys in China ab. Das zeigt wie unglaublich dynamisch die Entwicklung dort verläuft und dementsprechend entscheidend ist es für uns, ein entsprechendes Netzwerk zu knüpfen.
Wie haben Sie Ihre Zusammenarbeit mit chinesischen Universitäten angebahnt?
Wagner: Das war einfach: Mit Suning Wang und Todd Marder verbindet mich seit langem eine persönliche Freundschaft. Als ich von der DFG-Initiative las, war daher sofort klar, wen ich ansprechen würde.
Glaubitz: Bei uns entstand die Kooperation ebenfalls direkt aus wissenschaftlichen Kontakten, die sich aus Publikationen und Konferenzpräsentationen ergeben hatten. Katalysiert wurde dies auch durch die Tatsache, dass ich in meiner Arbeitsgruppe chinesische Mitarbeiter, beispielsweise als Humboldt Fellow, habe und hatte.
Gibt es für Sie auffällige Unterschiede zwischen der deutschen und der chinesischen Art, Wissenschaft zu betreiben?
Wagner: Chinesische Studenten durchlaufen ein hartes Auswahlverfahren, bevor sie an einer der herausragenden Universitäten des Landes zugelassen werden. Sie sind extrem leistungsorientiert und belastbar. Während der Doktorarbeit sind Samstage in der Regel normale Arbeitstage. Für jüngere Professoren in China kann durchaus auch das persönliche Gehalt erheblich davon abhängen, wieviel sie veröffentlichen und wie angesehen die Zeitschrift ist, in der sie publizieren. Der wissenschaftliche Erfolg steht im Vordergrund, während die „work-life balance“ eher kein Thema ist. Gelegentlich höre ich bei uns in Deutschland die Meinung, das chinesische System beruhe überwiegend auf Drill und fördere nicht die Entwicklung kreativer Ideen. Möglicherweise war das früher einmal so. Die Fülle bedeutender neuer Erkenntnisse, die aus Fernost stammen, belegt jedenfalls deutlich, dass derartige Vorurteile heute keinesfalls mehr angebracht sind.
[Das Interview führte Dr. Anne Hardy]