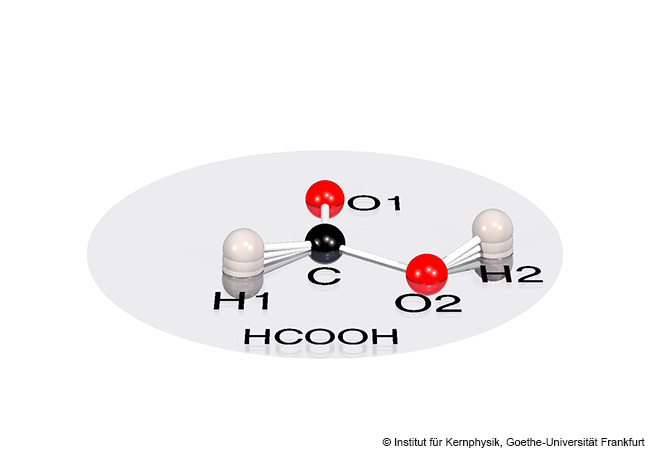Professor Markus Scholz, Archäologe an der Goethe-Universität, war maßgeblich an der Entzifferung der „Frankfurter Silberinschrift“ beteiligt. Eingerollt in einem silbernen Amulett wurde die Inschrift in einem Grab aus dem 3. Jahrhundert nach Christus gefunden. Der vielbeachtete Fund stellt den bislang ältesten materiellen Beleg für das Vorhandensein von Christen nördlich der Alpen dar. Die Frankfurter Silberinschrift wird die bisherige Forschung über die Ausbreitung des Christentums und die Spätzeit der römischen Herrschaft rechts des Rheins enorm bereichern. Goethe-Uni online sprach mit Markus Scholz, wie der 18-zeilige Text entziffert werden konnte.

Wie fühlt es sich an, an einer solch entscheidenden Neuerkenntnis als Wissenschaftler maßgeblich beteiligt gewesen zu sein?
Einen solchen Fund bearbeiten zu dürfen, das ist ein großes Geschenk. Wobei das Ganze natürlich Teamarbeit war von der minutiösen Bergung durch die Denkmalpflege bis jetzt zur vorläufigen Lesung. Dabei mitwirken zu können, ist ein Glücksereignis. Es macht mich aber auch demütig. Dieser Text hat ja eine ganz eigene Würde.
Das Medienecho war extrem hoch, die Kunde von der „Frankfurter Silberinschrift“ lief auf allen Kanälen. Wie war das für Sie, als Wissenschaftler so sehr im Rampenlicht zu stehen?
Das muss ich wohl erst noch verarbeiten. Meine Person war etwas exponiert, weil ich die Ehre hatte, den wissenschaftlichen Part bei der Pressekonferenz vorzutragen. Die Entzifferung wäre ohne Teamarbeit aber so nicht möglich gewesen.
Die Grabung fand ja schon 2018 statt. Wann genau sind Sie in das Projekt einbezogen worden?
Das Denkmalamt hat die Grabung mit hoher Präzision durchgeführt. Das macht sich jetzt bezahlt unter anderem an diesem Grab. Ich durfte den „Tatort“ hin und wieder besuchen, wobei ich mich an das Grab 134 nicht konkret erinnere. Das Amulettröllchen durfte ich dann zum ersten Mal im Laufe des Jahres 2018 im Archäologischen Museum in der Restaurierungswerkstatt anschauen. Da ging es um die Frage, ob und wie man es entrollen kann.
Wie war damals Ihre Einschätzung?
Ich konnte sagen, ja da erwarten wir tatsächlich einen eingerollten Text. Aber es wurde rasch klar, dass man das physisch nicht erfolgreich entrollen kann. Es wäre einfach zerbröselt. Da gibt es leidige Beispiele, wo nur einzelne Fetzen auf Glasplatten kleben und blöderweise immer die interessantesten Passagen weg sind. Das wollten wir nicht riskieren. Ich habe größten Respekt vor den Beteiligten, die erstmal Geduld gezeigt und sich über Alternativen informiert haben. Der erste Versuch, an die Schrift zu kommen, war eine Röntgenanalyse im Jahr 2020. Ergebnis war eine segmentweise Aufrollung. Es zeigte sich Text, aber unscharf und unlesbar.
Das änderte sich mit dem Umzug des Leibniz-Zentrums für Archäologie (LEIZA) Mainz an den neuen Standort.
Mit der Etablierung dieses faszinierenden neuen Tomographen und seiner wissenschaftlichen Crew war es möglich, das Mitte 2024 so zu entschlüsseln. Die Computertomografie ist so scharf, dass sich ein deutliches Schriftbild ergibt. Damit lag das Problem der Entzifferung nicht mehr an der Sichtbarkeit von Schrift, sondern in der Interpretation der Zeichen.
Und das ist Ihr Spezialgebiet.
Ja. So eine Entzifferung muss man sich erringen, und das geht im Alleingang nur beschränkt. Einige Passagen konnte ich auf Anhieb erkennen, andere sind bis heute Gegenstand von Diskussionen. Dabei arbeite ich mit Kollegen zusammen, hier zum Beispiel mit dem Historiker Hartmut Leppin. Ich habe sehr von seinem Netzwerk profitiert, denn viele Fragen im Zusammenhang mit diesem Text gehen weit über die Archäologie der Region hinaus und berühren Disziplinen wie die Theologie, die Liturgiegeschichte und das Alter der lateinischen Übersetzungen der Paulusbriefe.
Sie sind ja als Archäologe zuständig für die römischen Provinzen. War der Fund, der auf die Mitte des 3. Jahrhunderts datiert, für Sie eher ungewöhnlich?
„Kleininschriften“ und Graffiti kommen auf allen möglichen Gegenständen im Fundmaterial vor. Die Schriftlichkeit war in den römischen Provinzen weit verbreitet. Dieser Fund ragt aber wegen seines Textes wie seines Kontextes heraus.
War der Limes zu dieser Zeit noch in Betrieb?
Das dritte Jahrhundert war sehr turbulent. Tatsächlich ist der Limes in der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts aufgegeben worden. Als dieses Gräberfeld vor den Toren von Nida bestand, dieses späte Körpergräberfeld, existierte er wohl noch.
Gehen Sie also davon aus, dass der Mensch ein Römer war? Kann man dazu bereits etwas sagen?
Prinzipiell ist vieles möglich. Es könnte ein einzelner Reisender gewesen sein. Die römischen Außengrenzen gerade im Vorfeld von so wichtigen Militärbasen wie Mainz, waren Grenzzonen mit extrem hoher Mobilität. Da sind „Fremdlinge“ nicht ungewöhnlich. Von der Bestattungsart her ist der Mensch unauffällig, er ist nicht anders bestattet worden als die anderen im Gräberfeld. Das deutet nicht auf einen Fremdling hin. Das Amulett ist außerdem in Latein geschrieben und nicht wie sonst üblich auf Griechisch.
Wie findet man heraus, woher der Mann kam?
Die archäometrischen Untersuchungen, z.B. Strontiumisotopie, laufen noch. Letztere könnte Aufschluss über Ortskonstanz oder Mobilität geben.
Untersucht man dafür die Zähne oder die Knochen?
Beides. Die Ablagerungen in den Zähnen betreffen vor allem die Kindheit, wenn die Zähne gebildet werden. Einlagerungen in die Langknochen, die ja ständig umgebaut werden, tragen die Signatur der letzten Aufenthaltsorte. Der Anthropologe Dustin Welper hat das Skelett analysiert: Danach haben wir es mit einem Mann zu tun, der um 35 bis 40 Jahre alt war, als er starb. Das Skelett zeigt keine besonderen Auffälligkeiten, keine Verletzungen oder Verschleißerscheinungen durch schwere Arbeit. Was vorsichtig den Schluss zulässt, dass es dem Mann relativ gut ging. Man kann auch nicht behaupten, dass er als Märtyrer gestorben sein muss.
Kann man wegen der Erdbestattung davon ausgehen, dass auch die anderen Toten Christen waren?
Auf keinen Fall. Die Körperbestattung gab es bereits im republikanischen Rom. Noch in der frühen Kaiserzeit gab es senatorische Patrizierfamilien, die in uralter Tradition körperbestattet haben, obwohl die Mehrheit im 1. Jahrhundert nach Christus die Brandbestattung pflegte. Das sind Trends, die sich immer wieder verändert haben, auch regional sehr unterschiedlich. Das hat aber nicht unmittelbar und vor allem nicht ausschließlich mit religiösen Strömungen zu tun. Wenn dann kämen auch noch andere Religionen in Frage – Stichwort Judentum – oder philosophische Strömungen. Muss ein frühchristliches Grab automatisch ein Körpergrab sein? Der Kirchenvater Augustinus meinte ja, dass es nicht auf die leibliche Bestattung ankommt, sondern auf das transzendentale, es bleibt ein Hintertürchen für alle möglichen Arten von Bestattungen.
Gab es bisher keine Anhaltspunkte für die Anwesenheit von Christen in dieser Zeit?
Es gab textliche Hinweise, die aber umstritten sind. Irenäus von Lyon, ein gallischer Bischof, der um 185 nach Christus geschrieben hat, bezeugt wie andere frühchristliche Autoren auch, ein Pogrom im Jahre 177 nach Christus im Rhônetal und in Lyon. Der Bericht schließt mit einer Darstellung dessen, wo Christus überall schon in der bekannten Welt verehrt wird. Er erwähnt, dass auch in Germanien Christus nach demselben Ritus verehrt werde wie in Libyen. Aber ähnlich formulieren auch andere antike Autoren, z. B. Tertullian. Es handelt sich um einen Topos, dessen konkreter Quellenwert diskutabel ist.
Und weitere Belege gibt es nicht?
Die nächsten konkreten Zeugnisse sind Konzillisten, die 313 einen Bischof von Köln und 314 einen in Trier überliefern. Und der Bischof in Trier erwähnt drei Vorgänger, ohne deren Amtszeiten zu nennen. Man kommt damit nur in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts zurück. Archäologische Strukturen (Kirchen) und Ikonographie lassen sich sicher erst in das 4. Jahrhundert datieren.
Wenn es Bischöfe gab, muss es ja auch einfache Christen gegeben haben.
Es wäre nicht überraschend, wenn um 200 nach Christus hier schon christliche Gemeinden gewesen wären, die Leute hatten ja sozusagen 200 Jahre Zeit, sich zu informieren. Die hohe Mobilität über Grenzen hinweg ist bekannt, da haben sich Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen getroffen, aber bislang fehlte der Beweis. Und den haben wir jetzt, zumindest für einen Christen.
Wurde Silberfolie als Schreibgrund nur für rituelle Texte verwendet?
Edelmetallbleche waren kein normaler Beschreibstoff, sondern spezifisch für magische Schutzamulette. Diese Praxis kam Mitte des 3. Jahrhunderts überhaupt erst auf. Rechts des Rheins, im ehemaligen Limesgebiet, gibt es ganze zwei Stück: das Frankfurter Silberröllchen und das Silberröllchen von Badenweiler bei Freiburg im Breisgau, das man schon länger kennt. Es gab auch die negative Magie, den Schadenszauber. Den hat man auf Blei geschrieben. Das ist schon aus dem Alten Griechenland belegt.

Womit hat man auf die Folie geschrieben?
Das ist schwer nachzuvollziehen. Das übliche Schreibgerät für Wachstafeln waren Schreibgriffel aus Metall oder Knochen. In unserem Fall ist der Schreibgrund winzig klein und die Schrift hauchdünn. Das kann kaum mit einer Metallspitze geschehen sein, man hätte unweigerlich das Silber durchstoßen. Ich stelle mir eher so etwas wie einen Zahnstocher vor, vielleicht aus Knochen. Das Blech ist so groß wie ein halber Bierdeckel.
Ob der Mensch, der das Amulett getragen hat, auch den Text geschrieben hat?
Die Person, die den Text geschrieben hat, hatte Informationsquellen und offensichtlich Zugang zu Schrifttum, wie das Pauluszitat ja zeigt. Das war auf jeden Fall ein Christ. Sehr wahrscheinlich wusste der Träger, was da inhaltlich drinstand. Wir wissen aber noch zu wenig über ihn. Anders beim Amulett aus Badenweiler: Das war für ein Kind, den kleinen Lucius, geschrieben worden. Der hat es dann in den Thermen von Badenweiler verloren, vielleicht beim Schwimmunterricht, kennt man ja von den eigenen Kindern. Hätte es auch unser Mann schon als Kind bekommen, dann wäre das Amulett evtl. ins frühe dritte Jahrhundert zu datieren – aber das ist Spekulation.
Als das Bild des Computertomografen kam, haben Sie gleich erkannt, welche Bedeutung der Fund hat?
Eigentlich schon. Als ich die Bilddatei zum ersten Mal geöffnet habe, bin ich umgefallen angesichts der Klarheit dieses 3-D-Modells. Das war schon aufregend.
Vorher hatten Sie keinen Text erkennen können?
Man hat gesehen, dass Text enthalten ist, aber man hat nichts entziffern können. Was der Computertomograph hervorbrachte, war regelrecht Klartext.
Was konnten Sie als erstes entziffern?
„Qui se dedit voluntati domini“. Und dann dieses XP (Chi Rho), und nicht genug damit, ihm voran geht IH (Jota Eta), das ist die Abkürzung für Jesus Christus. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern dreimal in dem Text und in aller Deutlichkeit. Mit einem geschnörkelten Abkürzungszeichen darüber, was die Nomina Sacra auch markiert. Da war klar: Da gibt es kein Vertuen. Dann war nur die Frage: Steht Christus alleine da? Oder wie häufig im Kontext heidnischer Dämonen oder auch jüdischer Elemente?
Für alle Fälle kann man ja nie wissen.
Je mehr Götter, desto besser. Die großen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten im 3. Jahrhundert brachten viel Dynamik mit sich, man hat sich gedanklich neu sortiert und alles Mögliche aufgeschnappt und verarbeitet. Die Schutzmagie ist sozusagen eine Sekundärverwertung der regulären kultischen Vorstellungen. Aber für diesen Text können wir sicher sein: Der ist rein christlich, und das macht ihn so außerordentlich.
Was haben Sie als Erstes gemacht, als Sie das gemerkt haben?
Den Rechner aus und erstmal was Anderes gemacht. Und am nächsten Tag wieder reingeguckt.
Aber der Befund war gleichgeblieben.
Ich habe eine Weile meinen eigenen Augen nicht getraut. Dann habe ich die Kollegen hinzugezogen, Carsten Wenzel vom Archäologischen Museum zum Beispiel, und eben Hartmut Leppin und Benjamin Fourlas vom LEIZA, Byzantinist, der sich mit so frühen christlichen Ritualen befasst. Sie haben bestätigt: Das sind tatsächlich christliche Signets. Formulierungen wie „qui sededit voluntati domini“ findet man in heidnischen Texten nicht. Und auch „hagios, hagios, hagios“ – „heilig, heilig, heilig“ – auf Griechisch in Latein geschrieben, gibt es in heidnischen Kontexten so nicht. Aber der Schlüssel zum Glück war das Pauluszitat in den letzten Zeilen. Da hatte ich einzelne Elemente gelesen, caelestes, die Himmlischen, und „omnis lingua confiteatur“ jede Zunge bekenne, aber der Rest ergab keinen Sinn. Bis Wolfram Kinzig, Kirchenhistoriker aus Bonn, sagte, diese Wortfolge erinnere an den Paulusbrief an die Philipper. Ich las ihn nach – und ecce! – wenn man es weiß, sieht man: das steht da.
Das Wiedererkennen einer bestimmten Wortfolge bringt einen dann weiter.
Man nähert sich so einem Text von mehreren Seiten. Einen Teil, ca. 50 bis 70 Prozent, kann man mit Übung relativ schnell lesen. Der Rest ist hartnäckiges Ringen. Welcher Strich gehört zu einem Buchstaben? Das Röllchen ist ja mehrfach geknickt und gestaucht mit Rissen, die aussehen können wie Striche von Buchstaben. Und im Kopf muss immer das lateinische Vokabular mitrattern oder man schlägt es nach. Da geht man auch mal in die Irre und legt es wieder weg und sagt, heute lieber nicht mehr. Oder man hat eine Idee und geht zu den Kollegen, und die sagen, naja, darüber müssen wir diskutieren. Die Computertomografie bietet ja auch noch die Möglichkeit, in die tiefen Schichten einzudringen, das Röllchen ist ja keine symmetrische Spirale, sondern ziemlich schief. Manche Buchstaben sehen in der zweidimensionalen Darstellung bei schrägem Anschnitt wie ein Punkt aus. Mit der CT-Technik kann man nochmal nachschärfen, kippen, regelrecht rauspräparieren. Was jetzt so einfach klingt, bedeutet eine sehr aufwendige Arbeit für die Kollegen in Mainz, dahinter stehen umfangreiche Rechenmodelle.
Wie lange haben Sie letztendlich getüftelt, bis die jetzige Lesart stand?
Ich habe die Stunden nicht mitgezählt, kann also nicht beziffern, was es den Steuerzahler gekostet hat. Insgesamt war das aber vielleicht ein halbes Jahr mit großen Pausen. Das ist auch hilfreich, denn bei solchen Texten – wie überhaupt in der Wissenschaft – muss man sich gelegentlich mal von liebgewonnen goldenen Worten und Gedanken distanzieren. Wenn man nach einiger Zeit mit kühlem Kopf nochmal kritisch prüft, kann es schon sein, dass eine alternative Sicht darauf frei wird. Was auch sehr geholfen hat: Das händische Umzeichnen des CT-Bildes, da muss man sich über jeden Strich Rechenschaft ablegen.
Wie werden Ihre Erkenntnisse publiziert?
Die Publikationsstrategie wird bald festgelegt. Wahrscheinlich werden wir mit verschiedenen Aufsätzen starten. Von der technisch-naturwissenschaftlichen Seite besteht ein großes Interesse, auch die angewandte CT-Methode zu publizieren, die ihrerseits völlig neu ist. Wir denken natürlich auch an einen größeren Aufsatz, der die archäologischen, althistorischen und theologischen Belange abdeckt.
Wie ist es für Sie zu wissen, dass auf dem Gräberfeld jetzt ein Mehrfamilienhaus steht?
Ja, das ist immer ein weinendes und ein lachendes Auge. In dem Fall ist alles planmäßig gelaufen. Das Gräberfeld ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Die Ausgrabung war wie ein Sichtfenster. Das Gräberfeld ist dort nicht zu Ende, an allen Baugrubengrenzen geht es weiter, da steckt noch viel im Boden. Manches ist durch Leitungsschächte, Tiefgaragen, ältere Keller zerstört. Noch Vorhandenes kann hoffentlich im Boden bewahrt oder wie hier künftig systematisch ausgegraben werden.
Meinen Sie, dieser Fund wird das größte Highlight Ihrer wissenschaftlichen Karriere gewesen sein?
Hoffentlich nicht ;-). Wir haben viele andere interessante Projekte, die diese Sichtbarkeit nicht erzielen. Es ist auch unwahrscheinlich, das sowas nochmal kommt. Immer gern, aber das ist schon ein absoluter Glücksfall.