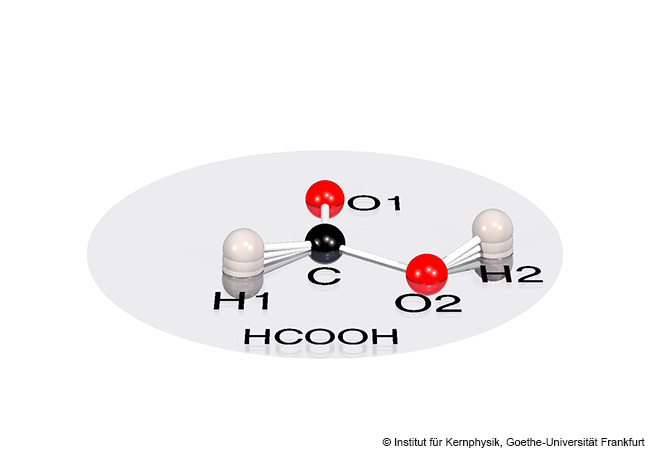Der Philosoph Prof. Martin Seel hat über das »Nichtrechthabenwollen« ein gleichermaßen unmögliches wie lehrreich-unterhaltendes Buch geschrieben.
UniReport: Herr Seel, man kann von vielen verschiedenen Seiten auf Ihr Buch zugehen, ich muss mich bei meiner ersten Frage also auf gar keine bestimmte Stelle beziehen …
Prof. Martin Seel: … das ist die Idee dahinter!
Gut! Ich fange dann einfach mit der naheliegenden Frage an: Das Nichtrechthabenwollen in den Fokus eines philosophischen Buches zu stellen ist doch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das erinnert an den Kreter, der behauptet, dass alle Kreter lügen. Ein paradoxer Ansatz, den man in der akademischen Welt so nicht erwarten würde.
In der akademischen Welt mag es ungewöhnlich und paradox klingen, wenn ein Autor sagt, er wolle mit dem, was er schreibt, nicht recht haben oder jedenfalls nicht recht haben müssen. Wenn man aber an die Literatur denkt, löst der Anschein einer Paradoxie sich auf. Wer einen Roman oder ein Gedicht schreibt, muss überhaupt nicht recht haben wollen. Literarische Texte bieten etwas dar, zeigen etwas auf oder führen etwas vor, worauf sich Leserinnen und Leser einlassen können. Es wäre seltsam, ihre Verfasser zu fragen, wie sie ihren Roman oder ihr Gedicht begründen können. Mein Buch ist gewissermaßen eine Erinnerung an diese literarische Dimension des Schreibens, die auch in der Philosophie seit Platons Zeiten lebendig ist. „Gedankenspiele“, wie der Untertitel meines Buchs lautet, sind eine Form des Denkens, die ich für eine unverzichtbare Produktivkraft des Philosophierens halte: Man muss im Denken und Schreiben nicht immer nur die eigene These durchfechten, sondern kann, darf und sollte sich auch in einem nicht-zielgerichteten Denken üben.
Wäre auch ein Buch über das Rechthabenwollen aus Ihrer Feder denkbar?
Dieses andere Buch ist in diesem einen schon enthalten, denn, wie ich im ersten Teil vorführe, kann man dem Rechthabenwollen gar nicht durchweg entgehen. Allein indem man bestimmte Worte wählt, glaubt man ja – und glaubt, recht damit zu haben –, dass sie die Bedeutungen haben, die ihnen an ihrer Stelle zukommen. Rechthabenwollen und Nichtrechthabenwollen sind siamesische Zwillinge, die nur zusammen gedeihen können.
Haben Sie das Buch eher spontan-improvisierend verfasst, oder wäre das ein Trugschluss, wenn man von der Form auf die Produktion schließen wollte?
Nun, ein wenig Handwerk gehört schon dazu. Schon für mein Buch „Theorien“ (2009) hatte ich einen ähnlichen, unkonventionellen Schreibstil gewählt. Aber auch eine offene Form ist eine Form, die einem gewissen Kalkül entspringt, selbst wenn man den Zufall dabei mitspielen lässt. Zu meinen Lieblingsbüchern gehören Wittgensteins „Vermischte Bemerkungen“, die von Anfang bis Ende zu Gedankenspielen einladen, aber dieses Buch hat ihr Autor nie geschrieben, da es aus einer Zusammenstellung von Notizen aus seinem Nachlass entstanden ist. Ich wollte aber meinerseits mit so einer Art Buch nicht bis zu meinem Ableben warten.
Das Buch wendet sich ja durchaus auch an ein nicht-akademisches Publikum. Ist es zutreffend, dass Sie sich nicht nur von der systematischen Philosophie, sondern auch von einer ‚Ratgeberphilosophie‘ à la Richard David Precht abgrenzen wollten?
Diese unterschiedlichen Formen der Philosophie haben alle ihre Berechtigung, weswegen übertriebene Abgrenzungen fehl am Platz sind. Schon gar nicht möchte ich mich von einem systematischen Philosophieren abgrenzen, das ich ja die meiste Zeit meiner Lehre und Forschung betrieben habe und weiterhin betreibe. Ich habe aber nun einmal zwei Seelen in meiner Brust: den vermeintlich seriösen Dr. Jekyll und den vermeintlich unseriösen Mr. Hyde, die beide zu Wort kommen wollen und in diesem Buch beide zu Wort kommen sollten.
Sie schreiben, dass auch in der Kunstrezeption das Präsentierte, also der Inhalt, oftmals im Vordergrund steht, dabei das Präsentieren, also die Form, in den Hintergrund gerückt wird. Ist das ein grundsätzliches Dilemma?
Ein Dilemma sehe ich darin nicht, denn darin liegt die Grundverfassung künstlerischer Werke: Sie präsentieren etwas, indem sie sich präsentieren. Das aber ist auf eine abgeschwächte Weise auch bei philosophischen Texten der Fall. Auch sie verfahren nie rein argumentativ, sondern folgen unvermeidlicherweise einer bestimmten Rhetorik und Dramaturgie, auf die man achten muss, wenn man das Argument verstehen will.
Viele Beispiele in Ihrem Buch stammen aus dem Jazz, aus einer Musikrichtung, die von der Überraschung und Unerwartbarkeit lebt.
Ja, diese improvisatorische Musik ist eine wichtige Inspirationsquelle für meine Gedankenspiele. Nicht fixiert zu sein auf eine endgültige Form, ein ultimatives Verfahren oder ein unerschütterliches System – darin besteht doch, wenn Sie mich fragen, der Geist der Philosophie.
Aber bringt die akademische Lehre die Offenheit dafür mit? Immerhin müssen Sie in Ihren Seminaren verbindliches Wissen vermitteln.
Philosophie ist ja ohnehin ein Fach, in dem es zwar Fortschritte, aber nicht den geraden Gang eines kumulativen Fortschritts gibt. Alles kann immer wieder in Frage gestellt werden, im Rückgriff auf Positionen, die eine Zeitlang für überholt gegolten haben. Das zu können ist ein elementarer Bestandteil des philosophischen Wissens. Deswegen sind die Dissidenten in unserem Fach so wichtig, ob sie nun Montaigne, Nietzsche, Adorno oder Derrida heißen mögen.
Aus dem Denken ehemaliger Dissidenten wurden schließlich aber auch oft philosophische Schulen.
Orthodoxie ist ein Virus, gegen den keine Denkrichtung gefeit ist. Die Lust auf und das Vergnügen an Gedankenspielen ist das wirksamste Gegenmittel gegen jede Art des „ dogmatischen Schlummers“ der Philosophie, wie Kant so schön sagt.
Sie sprechen in Ihrem Buch etwas spöttisch über das Adorno-Denkmal auf dem Campus Westend.
Ich finde, der Kunsttheoretiker Adorno hätte etwas Besseres verdient. Am meisten ärgert mich das Metronom auf dem fast leeren Schreibtisch, das wohl für den Musiker und Komponisten Adorno stehen soll. Aber so ein Gerät gibt einen festen Takt vor, was dem konstellativen Denken Adornos völlig widerspricht, das sich einem gleichbleibenden Takt stets verweigert hat.
[Fragen: Dr. Dirk Frank]
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 5.18 des UniReport erschienen. PDF-Download »