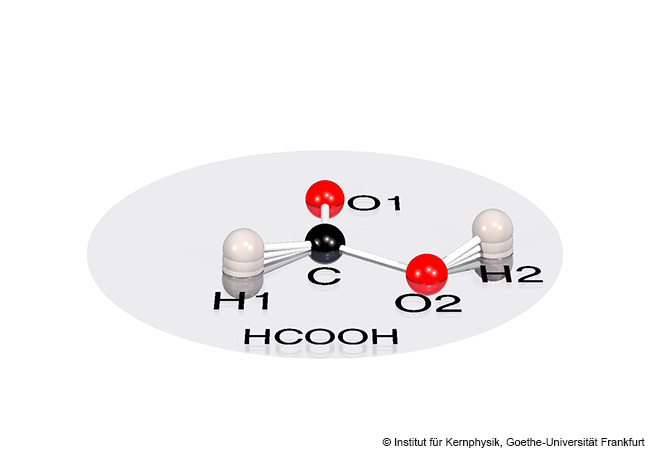Eine Studie, die der Politikwissenschaftler Prof. Richard Traunmüller (Universität Mannheim) zusammen mit seinem Kollegen Dr. Matthias Revers (University of Leeds) kürzlich veröffentlicht hat, hat bundesweit für Aufsehen und auch für zahlreiche Gegenstimmen gesorgt. Im Fokus der Studie stehen Soziologie-Studierende der Goethe-Universität, weshalb die Befunde zur Rede- und Meinungsfreiheit in Frankfurt besonders die Gemüter bewegt haben. Der UniReport konnte Prof. Traunmüller, der einige Jahre an der Goethe-Universität geforscht und gelehrt hat, und seinen früheren Kollegen, den Soziologen Prof. Thomas Scheffer, zu einem Streitgespräch zusammenbringen.
UniReport: Herr Prof. Traunmüller, haben Sie die vielen Reaktionen auf Ihre Studie überrascht oder war Ihnen das vor der Veröffentlichung klar? Bestätigt die Art der Kritik gewissermaßen Ihre Kernthesen?
Richard Traunmüller: Wir wollten mit der Studie durchaus eine Debatte in den Sozialwissenschaften anstoßen. Wir haben diese ja im Open Access publiziert, es gab über 11.000 Zugriffe [Stand: 23.11.2020]. Das ist für eine solche Studie ein immenses Echo. Sehr überrascht waren wir über das Medienecho, das haben wir nicht so kommen sehen. Wir haben neben Kritik auch sehr viel Zuspruch erfahren. Uns wurde gesagt, wir seien mutig, was uns wiederum stutzig gemacht hat – ist es inzwischen wirklich mutig, eine solche Diskussion anzustoßen? Gerade auf Twitter gab es wiederum sehr vehemente Gegenstimmen. Schade finde ich, dass Kollegen, die einen persönlich kennen, dort auf eine unschöne Art und Weise diskutiert haben, anstatt sich auf die Sachebene zu konzentrieren. Dass sie versucht haben, uns methodisch auseinanderzunehmen, ist gut. Aber der eigentliche Grund dafür war, dass Ihnen die Ergebnisse der Studie gegen den Strich gingen. Das hat uns wieder gezeigt, warum wir Meinungsvielfalt an der Uni brauchen: es ist menschlich, den Splitter im Auge des anderen, aber nicht den Balken im eigenen Auge zu sehen. Wir würden uns wünschen, dass diese Kritiker bei sich selbst oder bei Ergebnissen, die ihnen passen genauso kritisch hinschauen oder zumindest ebenso Kritik zulassen.
UniReport: Also war das Ergebnis Ihrer Studie eine Art von self-fulfilling prophecy?
Es gab Stimmen, die haben uns sogar in eine Reihe des bekannten Hoax von Alain Sokal gestellt, aber das wäre wohl zu viel der Ehre. Nein, es war weit weniger strategisch angelegt. Aber es ist natürlich eine schöne Pointe, dass sich unsere Diagnosen dann auch performativ bestätigen.
UniReport: Herr Prof. Scheffer, überzeugt Sie das Design der Studie, halten Sie die Studie für repräsentativ?
Thomas Scheffer: Bevor ich antworte, möchte ich erst noch feststellen, dass ich nicht nur als interpretativer Sozialforscher dazu etwas sagen möchte, sondern auch als Prodekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften. Richard Traunmüller ist übrigens dadurch, dass er in Frankfurt geforscht und gelehrt hat, durchaus persönlich involviert. Mir hätte es gefallen, wenn die eigene Positionalität auch in der Studie zum Ausdruck gekommen wäre. Zuerst erstmal zur Methodik: Die Studie, und das wird von den Autoren ja auch eingeräumt, ist nicht im klassischen Sinn repräsentativ. Ich würde mich freuen, wenn sie es wäre, denn manche Ergebnisse halte ich, im Sinne nötiger Grenzen der Toleranz, durchaus für ermutigend. Wenn man sich das experimentelle Setting anschaut, dann ist es natürlich nicht anders zu erwarten, als dass rechts gesinnte Studierende die Statements „Es soll keine Immigration geben“, „Geschlechter haben qua Natur unterschiedliche Befähigungen“, „Homosexualität ist moralisch fragwürdig“ oder „Der Islam passt nicht in die westliche Lebenswelt“ gern hören. In der Studie wird das ja auch so gesagt: Für rechte Studierende ist das aus inhaltlichen Gründen keine Frage von Toleranz. Linke Studierende halten hingegen diese Aussagen an vielen Stellen für problematisch, und ich darf sagen, zurecht. In diesem Sinne stellt die Studie eine Falle, weil sie die Toleranz gegenüber homophoben oder islamophoben Meinungen testet, die ja im Prinzip den Boden des Grundgesetzes verlassen.
Traunmüller: Zur Repräsentativität möchte ich sagen: Unsere Studie trägt im Titel „most likely case“. Es ist also eine Fallstudie zu den Studierenden der Gesellschaftswissenschaften an der Goethe-Universität, wir haben nie etwas anderes behauptet. Die Frage ist natürlich auch: Sind unsere Ergebnisse repräsentativ für diese Population? Da muss man sicherlich einräumen: Die Rücklaufquote ist nicht gut. Das wissen wir auch, das haben wir auch transparent gemacht. Wir haben uns aber auch angeschaut, ob unser Sample zur Studierendenstatistik passt. Das tut es! Es freut mich, dass sich Thomas Scheffer auf eine repräsentative Replikation freut, die haben wir ja auch geplant. Ich möchte aber auch noch etwas zur Kritik an den Statements sagen: Um Toleranz zu messen, bedarf es kontroverser Aussagen. Es ist ein Kurzschluss, wenn man bei den Aussagen gleich die Vokabeln islamophob, homophob, rassistisch oder sexistisch bemüht. Definitiv stimmt es nicht, dass diese Aussagen, die teilweise Tatsachenaussagen, teilweise Meinungen darstellen, nicht verfassungskonform seien. Denn das sind sie sicherlich, gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Niemand würde doch zum Beispiel die biologischen Unterschiede und Neigungen von Mann und Frau bestreiten wollen. Es ist auch völlig legitim, den Islam zu kritisieren, ebenfalls darf man beim Thema Immigration eine Gegenposition einnehmen.
Revers, M., Traunmüller, R. Is Free Speech in Danger on University Campus? Some Preliminary Evidence from a Most Likely Case. [Ist die Meinungsfreiheit an der Universität in Gefahr? Einige vorläufige Befunde anhand eines „Most likely case“] KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 72, 471–497 (2020). https://doi.org/10.1007/s11577-020-00713-z
„Obwohl Universitäten eine Schlüsselrolle in Fragen der Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt zukommt, werden sie in der Öffentlichkeit oftmals mit dem genauen Gegenteil assoziiert: einer Häufung restriktiver Sprachregelungen, gewalttätigen Protesten gegen umstrittene Redner und Suspendierung unbequemer Professoren. Manche Beobachter sehen darin beunruhigende Anzeichen für eine dunkle Zukunft der Meinungsfreiheit. Andere betrachten diese Vorfälle dagegen als skandalisierte Einzelereignisse und halten studentische Intoleranz für einen Mythos. Wir widmen uns diesen Behauptungen empirisch und stellen erste Befunde eines ‚Most likely case‘ vor: der linken Studentenschaft der Sozialwissenschaften in Frankfurt. Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass sich Studierende häufig sprachlich angegriffen fühlen und dass sich ein beträchtlicher Anteil für die Einschränkung der Meinungsfreiheit ausspricht. Auch finden wir Hinweise für Konformitätsdruck. Sowohl hinsichtlich des Wunsches, die Redefreiheit einzuschränken als auch hinsichtlich der Hemmung, seine Meinung offen zu äußern, bestehen politisch-ideologische Unterschiede. Linksgerichtete Studierende sind weniger bereit, umstrittene Standpunkte zu Themen wie Gender, Einwanderung oder sexuelle und ethnische Minderheiten zu tolerieren. Studierende rechts der Mitte neigen eher dazu, sich selbst zu zensieren. Obwohl diese Befunde vorläufiger Natur sind, weisen sie möglicherweise auf Probleme innerhalb der Sozialwissenschaften und dem universitären Kontext hin.“ [Abstract der Studie]
UniReport: In einigen Kritiken wurde ja auch moniert, dass die Aussagen sehr zugespitzt sind. Dass beispielsweise „Homosexualität gefährlich ist“, sorgt doch sicherlich nicht nur bei linken Studierenden für eine schnelle Abwehrreaktion – hätte man die Aussagen nicht etwas subtiler gestalten können?
Traunmüller: Methodenkritik, was die Fragenformulierung angeht – sehr gerne! Das ist legitim und selbstverständlich. Aber um es nochmal zu erklären: Es geht darum, Toleranz zu messen, und das tut man, indem man die Person mit Aussagen konfrontiert, die an die Wertesubstanz der Befragten gehen, die einen salopp gesagt triggern. Erst daran beweist sich Toleranz. Nun kann man natürlich auch, was legitim ist, sagen, dass es Grenzen der Toleranz gibt. Diese Debatte kann man führen. Uns ging es aber darum, Toleranz zu messen, und dafür brauchten wir Aussagen, die sie herausfordern.
Scheffer: Keinerlei Immigration zuzulassen widerspricht aber dem Grundgesetz, denn wir haben in Deutschland ein Grundrecht auf Asyl. Es gibt ein Diskriminierungsverbot, Männer und Frauen sind gleichgestellt. Aber ich will hier keine juristische Debatte führen. Es geht an der Universität ohnehin nicht zentral um Meinungsfreiheit. Da verfehlt die Studie ihren Gegenstand. Denn Toleranz ist an der Universität kein Wert an sich – und auch gar nicht vordringlich. In diesem Sinne schätze ich die Intuition der Studierenden, in der Mehrzahl ja offenbar Erstsemester, die sagen, dass es Grenzen der Toleranz geben muss, um die Wissenschaftsfreiheit an den Universitäten zu schützen. Wir stehen als Dozierende in genau dieser Fürsorgepflicht, denn wir haben eine diverse Studierendenschaft, die einen Anspruch darauf hat, vor diskriminierenden Äußerungen im Seminar geschützt zu werden. Wenn wir die Studierenden dazu befähigen wollen, Forschung zu betreiben, wo es primär auf Sach- und Methodenkenntnis ankommt, auf Argumente, Kreativität und Verfahren, die vom Gegenstand her angeleitet werden, dann müssen wir ihnen auch beibringen, dass Meinungen eben nicht die Leitwährung in unseren Seminaren, Vorlesungen, Kolloquien oder Forschungspraktika sind. Gefordert ist das, was man in den Science & Technology Studies (S&TS) ein „modest witness“ nennt: eine Subjektivität, die die eigene Meinung quasi einklammert, um sich den Gegenständen zu öffnen, sich mit ihnen sachgerecht zu befassen. Diese Haltung pflegen wir nur, wenn wir uns im wechselseitigen Respekt begegnen und uns den schwierigen Fragen ohne schnelle Antworten zuwenden. Wir sind also kein Meinungsbasar, keine Talkshow! Wie der Soziologe Niklas Luhmann sagen würde: Unser generalisiertes Kommunikationsmedium ist die Wahrheit, die Unterscheidung von wahr/unwahr. Die Universitäten zu vermessen, ob sie tolerant sind gegenüber allen möglichen Meinungen, geht also an der Sache vorbei. Maßgeblich ist: Wie schaffen wir es, Wissenschaftsfreiheit zu befördern und zu bewahren – und dies in Zeiten, wo sie gerade von autoritären, faschistischen Regimen zunehmend in Frage gestellt und angegriffen wird.
Traunmüller: Ich muss Thomas Scheffer im Gros seiner Aussagen wirklich zustimmen. Aber: Was impliziert es, dass wir eine diverse Studierendenschaft haben? Ich möchte mal ein provokantes Szenario in den Raum stellen: Eine tiefgläubige Muslima, die mit Kopftuch studiert, findet Homosexualität aufgrund ihres Glaubens unmoralisch. Der homosexuelle Flüchtling aus dem Irak, der an die Uni als Wissenschaftler kommt, ist der Meinung, dass sich der Islam nicht mit der westlichen Lebensweise verträgt. Der ersten Person zu sagen, sie sei homophob, der zweiten, sie sei islamophob, woraus sich ableitet, dass beide sich nicht äußern dürfen, fände ich hochproblematisch, das kann doch nicht die Lösung sein.
Scheffer: Es geht doch nicht darum, sich zum lustigen Meinungsstreit zu treffen. Wir kriegen doch unsere Aufgabe, das Ringen um einen tragfähigen demokratischen Common Sense aufzuklären und zu fundieren, nur dann bewältigt, wenn wir nicht selbst Meinungen ins Zentrum stellen, sondern die Erkenntnisproduktion. Deswegen fragt man die Studierenden im Seminar auch nicht nach ihren politischen Meinungen! Stattdessen geht es uns doch, etwa in der Soziologie, darum gemeinsam herauszufinden, wie Vergesellschaftungen funktionieren, was sie trägt und antreibt, wozu sie in der Lage sind? Und hier wird ja die Wissenschaftsfreiheit zum konkreten, reflexiven Gegenstand: Schauen wir nach Polen, nach Ungarn, schauen wir uns den Trumpismus an. Wir haben an der Goethe Universität Programme für verfolgte türkische Wissenschaftler*innen, die etwa an den Gezi-Protesten beteiligt waren. Ich kenne diese Fälle persönlich, etwa das akademische Schicksal einer Freundin, die sich ‚von oben‘ Anklagen und Mutmaßungen ausgesetzt sah, in ihrer Wissenschaftsfreiheit nicht universitär geschützt wurde und die so in ihrer Heimat ihrer Integrität als akademisch Forschende und Lehrende beraubt wurde. In Zeiten existenzieller Krisen, in denen wir leben, in denen wir mit Klimawandel, Pandemie und auch wachsenden sozialen Ungleichheiten konfrontiert werden, werden die Universitäten und ihr Personal zunehmend solchen Angriffen ausgesetzt, weil sie gegenüber den politisch motivierten Problemleugnungen eine konkurrierende, eine kritische Autorität darstellen. Unsere Problemdiagnosen werden da nicht mehr vor dem Hintergrund bewertet: Was ist der Stand der Erkenntnis? Sondern: Passt diese Erkenntnis in die eigene Ideologie? Ist sie links oder rechts? Die Klimawandel-Diagnose wird heute genauso angegriffen: als Meinung, als Aktivismus. Das ist falsch, denn sie basiert auf aufwendigen Erkenntnisprozessen. Damit sind ganz andere Geltungsansprüche verbunden.
Traunmüller: Was die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit angeht, wird Thomas Scheffer in mir den größten Mitstreiter finden. Wo ich ihm aber nicht zustimmen kann ist, wo die Grenzen zwischen vermeintlich bloßer Meinung und Wissenschaft verlaufen. Wir müssen als Wissenschaftler auch darüber sprechen können, ob es zum Beispiel kulturelle Unterschiede zwischen den Religionen gibt. Ein Max Weber hat bekanntlich verschiedene Religionen mit Wirtschaftssystemen in Verbindung gebracht – das ist kein Meinungsbasar, das ist keine Talkshow, das ist Wissenschaft! Und genauso muss man sich darüber unterhalten und erforschen können, was die Folgen von Einwanderung sind. Das sind sozialwissenschaftliche Fragen. Das als rassistisch oder islamophob zu bezeichnen, halte ich wiederum für eine ausgesprochen wissenschaftsfeindliche Haltung.
Scheffer: Dann müsst Ihr Eure Studie anders anlegen! Wenn Du fragen würdest „Gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Religionen?“, hätte doch niemand Probleme damit. Oder mit der Frage: „Welche Positionen gibt es zur Immigration: offene Grenzen ja/nein?“ ebenso. Wenn Du sagst, dass wir bei Fragen der Wissenschaftsfreiheit d’accord sind, dann verstehe ich nicht die Tendenz der Studie, unterschiedslos jede Form der Intoleranz zu skandalisieren. Es ist doch so: Wir wissen doch aus unserer eigenen Geschichte, wie Wissenschaftsfreiheit zerstört werden kann. Wir brauchen doch nur auf die Frankfurter Schule zu schauen, deren Mitglieder in der Zeit des Faschismus ins Exil flüchten mussten – oder ums Leben kamen. Es braucht Grenzen der Toleranz, um unsere Wissenschaftsfreiheit zu schützen. Wir brauchen eine Basis, hinter der wir nicht immer wieder zurückfallen können. Wenn wir es nicht schaffen, in unseren arbeitsteiligen demokratischen Institutionen über das bloße Spiel von Meinungen hinaus zu gehen, dann scheitert die Demokratie. Die Universitäten spielen hier eine wichtige Rolle.

UniReport: Herr Scheffer, es gab in den letzten Jahren an der Goethe-Universität einige Veranstaltungen, die von einer kritischen Hochschulöffentlichkeit scharf verurteilt wurden, es gab sogar Forderungen nach einer Absage. Das waren beispielsweise Veranstaltungen von Prof. Susanne Schröter; wie sehen Sie da die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit?
Scheffer: Auf solche aufgeheizten Debatten muss man sich durchaus einlassen, denn sie sind lehrreich. Sie lehren uns, dass und wie bestimmte Ansätze der Erkenntnisproduktion auch Teile der Studierendenschaft treffen, stigmatisieren, ausschließen. Da melden sie zurecht auf. Vor diesen Debatten müssen wir keine Angst haben, ja wir benötigen sie sogar. Außerdem sehe ich nicht, dass es uns als Universität darum gehen kann, Politiker*innen (wie etwa Rainer Wendt) eine Bühne zu bieten, die ja eh überall sprechen können und gehört werden. Das sind doch für uns in der Sache keine maßgeblichen Figuren. In den Debatten zu Kopftuch und Islam, wiederum, wurden durchaus von übereifrigen Studierenden Grenzen verletzt, wo wir auch aufpassen müssen, Aspekte der Wissenschaftsfreiheit zu schützen. Aber, nochmal, auch von Studierenden gab es hier durchaus wichtige Hinweise, wo Forschung Grenzen verletzt und akademische Debatten instrumentalisiert werden. Wir verfügen ja mit unserer Erkenntnisproduktion über ein großes symbolisches Kapital, gerade weil es nicht die Geltung bloßer Meinung beansprucht, und daher müssen wir uns in dieser Position auch kritische Nachfragen gefallen lassen.
Traunmüller: Ganz so einfach ist die Sache nun doch nicht. Du sagst, Thomas, dass wir keine Angst vor solchen Debatten haben müssten. Das Entscheidende ist doch nicht, ob man schon Angst haben muss. Die Wissenschaftsfreiheit ist doch bereits eingeschränkt, wenn man als Wissenschaftlerin wie Susanne Schröter überlegen muss: Kann ich meine Veranstaltung stattfinden lassen, ohne dass es da ständig Stress und Radau gibt? Das ist inakzeptabel! Und das hat mich damals in der Causa Wendt gestört: Dass man sich nicht geschlossen und kollegial hinter Susanne Schröter stellt. Studierende entscheiden nämlich nicht, wen Susanne Schröter einlädt. Es geht nicht um eine beliebige Meinungsfreiheit oder die Redefreiheit von Rainer Wendt, sondern darum, dass Susanne Schröter jemanden einladen kann, von dessen Teilnahme sie sich einen gewissen Erkenntnisgewinn verspricht und darum, dass sich ein universitäres Publikum anhören kann, was es interessant findet.
Scheffer: Wir sind uns an dieser Stelle einig, dass wir eine Fürsorgepflicht auch unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenüber haben. Es werden an einer Universität auch Erkenntnisse generiert, die manchen nicht passen, aber gleichwohl zuzulassen sind. Ich möchte nur nochmal an einen Punkt erinnern: Wir haben in der Demokratie eine große Verantwortung, denn wir stellen für den Meinungsstreit wesentliche Erkenntnisse, Reflexionen wie Problemaufklärungen zur Verfügung, ohne selber den Meinungsstreit zu führen oder zu entscheiden. Wir bringen Fakten, Maßstäbe und Orientierung ins Spiel der Debatten ein. Wenn wir aber in unserer Erkenntnisproduktion dazu kommen, gesellschaftliche Probleme zentral in Problemgruppen zu übersetzen, die Probleme also nur konstruierten Kollektiven zuzuschreiben, dann wird’s normativ schwierig, ja inakzeptabel. Denn damit bereiten wir der Diskriminierung den Boden. In der Studie wird ja gesagt, dass rechte Studierende es sich zweimal überlegen müssten, wenn sie bestimmte Sachen an der Uni sagen wollen. Ich finde es vor diesem Hintergrund gut, wenn unsere Seminare dazu führen, dass die Studierenden zweimal nachdenken, bevor sie etwas sagen, weil sie merken, dass hier anders gesprochen und gestritten wird, als im Freundeskreis oder in der Kneipe. Dass es hier auf ein respektvolles, sachkundiges Argumentieren ankommt und man nicht einfach irgendwelche Meinungen ‚gegen andere‘ raushaut, nur weil es sich etwa um kontroverse oder provozierende Positionen handelt.
Traunmüller: Ein Drittel der Studierenden traut sich nicht, die eigenen Ansichten wahrheitsgemäß vorzutragen. Jetzt sagst Du, das ist Dir recht, wenn es die rechten Studierenden betrifft. In unserem Sample gibt es aber keine Neonazis. „Rechte“ Studierende sind bei uns solche, die CDU oder FDP wählen. Wenn die sich nicht trauen, etwas zu sagen oder etwas beizutragen, weil sie sonst von anderen Studierenden sofort mit Labels wie sexistisch oder islamophob belegt werden, dann ist das nicht respektvolles Argumentieren, sondern ein diskreditierender Umgang. Und es ist auch nicht erkenntnisfördernd.
Scheffer: Unsere Aufgabe an der Universität ist es, die Dinge zu verkomplizieren, nicht zu vereinfachen. Wenn wir sozusagen Hemmungen entwickeln zugunsten des schwierigen wissenschaftlichen Gegenstandes, wenn wir dazu tendieren, liebgewonnene ad hoc-Meinungen zurückzustellen, dann ist das doch gut. Dieses Diskussionsklima des Ringens mit dem Gegenstand brauchen wir. Zum Verhältnis von Toleranz und Wissenschaftsfreiheit würde ich mir hier qualitative Feld- und Diskursforschungen wünschen, die rekonstruieren, was/warum schwer sagbar wird im Rahmen von Seminaren. Was tut diese Hemmung? Was macht sie möglich? Narrative oder problemzentrierte Interviews könnten hier ebenso Aufschlüsse geben, wie Interaktionsanalysen.
Traunmüller: Auch da rennst Du bei mir offene Türen ein. Wir haben in der Studie auch offene Fragen mit mehr interpretativem ‚Fleisch‘ gestellt. Im Prinzip gibst Du uns ja dann doch Recht, dass es sich lohnt, sich wissenschaftlich dieser Frage zu widmen.
UniReport: Herr Traunmüller, fühlen Sie sich motiviert, die Untersuchung fortzusetzen? Wie würden Sie da vorgehen, wer würde da wie befragt werden, würden Sie die Kritik dabei berücksichtigen?
Traunmüller: Wir planen eine deutschlandweite Befragung an verschiedenen Hochschulen und Fachbereichen, die auch die Kritik an der Repräsentativität ausräumen soll. Wir haben ferner unseren Kritikern angeboten, eine präregistrierte Replikationsstudie zu machen: Wir setzen uns gemeinsam mit ihnen zusammen, gehen die Kritikpunkte durch, entwerfen ein Design, entwickeln Kriterien und führen die Studie dann entsprechend durch. Wenn die Replikationsstudie dann zeigen sollte, dass alles doch nicht so schlimm ist wie gedacht, dann wären wir selber die glücklichsten Menschen.
Das Streitgespräch ist eine Vorabveröffentlichung aus dem UniReport 6/2020, der am 17. Dezember erscheint.