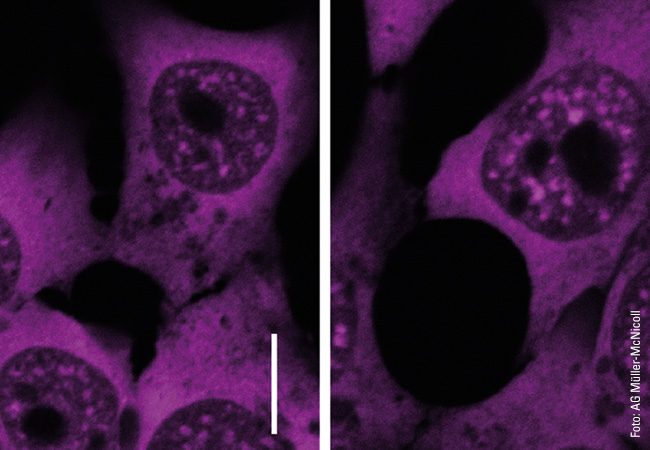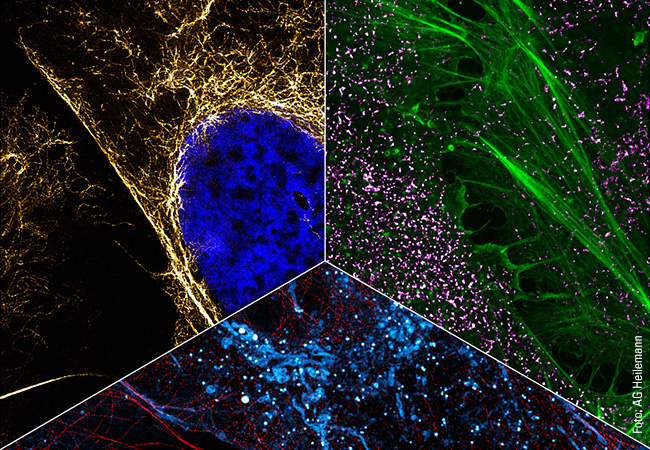Das Fremde, das uns als etwas Unheimliches, nicht dingfest zu Machendes begegnet, zwingt uns dazu, die Grenze zwischen dem Fremden und dem Eigenen neu zu verhandeln. Erfahren lässt sich dies, wenn wir uns einlassen auf zwei aktuelle Arbeiten von libanesischen Künstlern.
Das Fremde ist im Eigenen zu suchen. So könnte man zusammenfassen, was – aufbauend auf einer langen Tradition der Literatur, des Denkens und der Psychoanalyse – der Philosoph Bernhard Waldenfels in seiner über Jahre hinweg entwickelten Phänomenologie des Fremden ebenso zu denken gibt wie jene vornehmlich französischen Philosophen, deren Arbeit sein Denken verpflichtet ist (siehe auch Beitrag von Olaf Kaltenborn »Das Fremde zeigt sich, indem es sich uns entzieht«, siehe Seite 29) Das Fremde, so verstanden, ist mithin mehr und anderes als ein bloßes »Spezialthema «, ein Ausnahmefall von der Regel oder das alter ego unserer Selbst.

Als Verhandlung des Fremden im Eigenen lässt sich das Projekt einer Reihe libanesischer Künstler begreifen, die in Installationen, Lecture Performances und Theaterarbeiten uns zwar auch mit Fremdem und Fremden in Kontakt bringen, vor allem aber die Kategorien des Eigenen und des Fremden selbst beständig unterlaufen, ausstellen und neu verorten. Was die Arbeiten des in New York lebenden gebürtigen Libanesen Walid Ra’ad sowie der in Berlin lebenden Libanesen Rabih Mroué und Lina Majdalanie auszeichnet, ist dabei, dass sie in einer buchstäblich grunderschütternden Art und Weise die Mechanismen offenlegen, die der Bildung des Eigenen wie des Fremden zugrunde liegen.
Ihr großes Thema ist die Frage der Repräsentation: Wie kann jemand für andere stehen und sie auf einer Bühne oder im öffentlichen Leben vertreten? Wie überhaupt etwas zur Darstellung kommt und was dabei verschwindet. Dies lässt sich an zwei konkreten Beispielen aus der jüngsten Zeit darstellen, an Walid Ra’ads performativer Installation Those that are near. Those that are far sowie an der Lecture Performance So little time von Rabih Mroué und Lina Majdalanie.
Ferne in der Nähe – Walid Ra’ad: »Those that are near. Those that are far«
Ein Schacht. Wirkungsvoll ist er in der Mitte des verdunkelten Altarraums der Synagoge Stommeln platziert, deren Fenster mit grobem Holz von außen verbarrikadiert sind. Er ist mit hellem Holz ausgekleidet. Eine unsichtbare Lichtquelle erleuchtet ihn von innen her goldgelb. Sein Grund ist nicht erkennbar. Über ihm erhebt sich ein Dreibein, von dem ein Seil nach unten hängt. Um ihn herum ist Erde aufgehäuft. Hat sich das Auge ans Halbdunkel gewöhnt, so sind darin verschiedene Muster auszumachen, Abdrücke von Kisten oder Einkerbungen.
Dazwischen sind Trampelpfade erkennbar. Da der Eingang des Altarraums mit einer Holzplatte verbaut ist, sehen die Besucher ihn nur aus der Distanz – von der Frauenempore aus. Vergeblich suchen sie dabei nach einer Perspektive, die es ihnen erlauben würde, auf den Grund des erleuchteten Schachts zu sehen. Die denkmalgeschützte Synagoge Stommeln in Pulheim bei Köln, in der Walid Ra’ad diese Installation eingebaut hat, ist ein Backsteinbau aus dem Jahr 1882.

Er liegt versteckt hinter einigen zeitlos wirkenden Klinkerbauten an einer verkehrsberuhigten Hauptstraße. Neben der »Süßen Ecke«, einem Kiosk, der »Lotto und vieles mehr« anbietet, weisen eher unscheinbar ein ins schmiedeeiserne Gartentor eingelassener Davidsstern und eine Tafel in der Größe jener, die neben dem Kiosk »Jede Woche Sonderauslosungen « verspricht, auf die temporäre Installation an diesem historischen Ort hin.
Das Gebäude überstand die Pogrome der Nazizeit, weil es bereits im Jahr 1937 an einen Bauern verkauft worden war, der es als Abstellkammer nutzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel es und wurde erst Ende der 1970er Jahre wiederentdeckt, restauriert und dann im Jahr 1983 als Kulturhaus wiedereröffnet. Seither werden jedes Jahr Künstler eingeladen, an diesem Ort eine plastische Arbeit zu schaffen, »die mit dem Raum – seiner Architektur, seiner Geschichte – eine enge Wechselbeziehung eingehen« sollte.
Jannis Kounellis, Daniel Buren, Rebecca Horn und viele andere kamen. Jeder der Künstler schuf auf seine Weise ein site-spezifisches Kunstwerk, das zeitlich limitiert einen Kommentar zum Gebäude, seiner Geschichte, der mit ihm verbundenen Assoziationen, politischen Implikationen und räumlichen Vorstellungen sichtbar werden ließ. Unausgesprochen oder explizit stand dabei immer auch der Umgang mit der Shoah im Raum, ihre Darstellbarkeit und Undarstellbarkeit, ihr Vergessen und ihre Spuren in der Nachkriegszeit.
Das ist die eine Geschichte. Sie bleibt auch in Walid Ra’ads Installation im Gedächtnis. Doch mit ihr vermittelt Ra’ad wie in allen seinen Lecture Performances, Foto-Arbeiten, Videos, Webseiten und Ausstellungen eine zweite Geschichte, die sich in den vielfältigen Spuren und Abdrücken und vor allem eben in dem der Synagoge hinzugefügten buchstäblich wie im übertragenen Sinne grundlosen Schacht mitteilt. Er lässt Assoziationen mit den Tunnelsystemen unter dem Gazastreifen und der Berliner Mauer aufsteigen, erinnert an Verfolgung und Vertreibung, Flucht, Widerstand und Subversion, animiert zu Spekulation und Fragen.

Dagegen gibt der Titel Those that are near. Those that are far einen Hinweis darauf, dass diese Arbeit in der Verbindung der nahen mit der fernen Geschichte letztlich weder bei der einen noch bei der anderen verharren will, vielmehr auf das hindeutet, was die eine wie die andere hervorbringt und beide miteinander verknüpft, auf den Schacht als Ort des Erscheinens und Verschwindens, als Auftrittsort: Er verknüpft, einem Vexierbild oder einer Kippfigur gleichend, eine entfernte Geschichte mit einer naheliegenden, wobei, was nah, was fern ist, von der Perspektive abhängt.
Mag ein in Deutschland arbeitender Künstler aus dem Nahen Osten mit der Judenverfolgung heute die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser aus dem späteren Israel, assoziieren, so könnte sich umgekehrt dem deutschen Betrachter vielleicht – vermittelt über den Ort der Installation – die Geschichte ferner Konflikte als Wiederkehr derjenigen darstellen, die ihm nahe ist. Doch ob Ra’ads Interesse diesen Assoziationen gilt?
Vermutlich geht es dem Künstler eher um das Medium, in dem sie auftauchen: einem künstlich hinzugefügten Raum im Raum, einer Krypta als der Eröffnung des andernorts Festgefügten. Je länger der Betrachter zwischen den möglichen Perspektiven und Geschichten hin und her pendelt, desto deutlicher tritt letztlich hervor, was Ra’ad hier vor allem vor Augen führt: die nicht schließbare Lücke, die sich dort auftut, wo die Grenze zum Anderen, Fremden, erscheint, ein Loch, ein Abgrund, der die Voraussetzung dafür ist, dass dieser Andere zu erscheinen vermag.
Nähe in der Ferne – Rabih Mroué / Lina Majdalanie: »So Little Time«
Auf andere Weise setzt sich auch die Lecture Performance So Little Time mit den Gesetzen, wie das Fremde erscheint, auseinander: Auf der schmalen Studio-Bühne des Wiesbadener Staatstheaters sitzt an einem selbstgebaut wirkenden Sperrholzpult eine Frau und erzählt eine Geschichte. Von Zeit zu Zeit legt sie ein Foto in das rechteckige Becken, das neben ihrer Tischfläche in ihr Pult eingelassen ist. Was in diesem Becken liegt, wird von einer Videokamera auf eine Projektionsfläche links neben der Performerin übertragen.
Wir erkennen auf den Fotos die Performerin zusammen mit ihrem Lebenspartner, aber auch unbekannte Leute vor irgendwelchen Bauwerken. Einmal ins Becken gelegt, verbleichen die Bilder und verschwinden. Übrig bleiben weiße Blätter, welche die Performerin später an eine Wäscheleine am vorderen Bühnenrand hängen wird. Als sie diese mit einem Spray besprüht, erscheint auf den weißen Bildern das Bild einer Menschenmenge, vor der wiederum der Kopf der Performerin auftaucht, die nun hinter die Projektionsfläche getreten ist und von dort weiterspricht.

Das ist der ebenso einfach wie präzise wirkende Ablauf, den Rabih Mroué für die Performerin Lina Majdalanie ersonnen hat, die auf der minimalistisch gestalteten Bühne von Sama Maakaroun die Geschichte des Deeb Al-Asmar erzählt. Der Libanese wurde Anfang der 1970er Jahre als »erster libanesischer Märtyrer« im Kampf der Palästinenser gegen die israelische Besatzung des Westjordanlands in Beirut gefeiert, öffentlich beerdigt und an zentraler Stelle in der Stadt mit einer Statue geehrt.
Er hatte sich im Verlauf seines Studiums radikalisiert, schmuggelte Waffen und verschwand. Im Zuge eines Austauschs wurde seine Leiche – oder genauer: der Körper, den man dafür hielt – den Libanesen von den Israelis übergeben. Wenige Jahre später stellte sich aber heraus, dass der vermeintliche Märtyrer tatsächlich noch lebte. Sein Name tauchte auf einer Liste entlassener Gefangener auf. So wurde die Statue, die bereits zum festen Bestandteil der Stadt und ihres öffentlichen Lebens geworden war, umbenannt in die »Statue des entlassenen Gefangenen«.
Der tote Körper wiederum, den man bis dato für den eines Märtyrers gehalten hatte und den nun keine Seite mehr haben wollte, wurde als unbekannte Leiche eines angeblich arabischen Juden begraben, der »für die Befreiung Palästinas« gestorben sei. Was als Novelle in der Tradition des 19. Jahrhunderts beginnt, die unerhörte und recht komische Begebenheit eines Märtyrers, der seinen Tod und seine Heroisierung überlebt, wird im Verlauf der Performance zur exemplarischen Geschichte der Wandlungen eines Mannes und eines Denkmals in der von Kriegen, Bürgerkriegen und verwirrenden Wendungen gezeichneten Geschichte des Libanons:
Der überlebende »Märtyrer« und die Statue erleben unzählige Metamorphosen, die uns nach und nach, zum Teil von arabischer Musik begleitet, erzählt werden: Die Statue wird gesprengt und wieder errichtet, sie wird in eine Kunst-Universität verbracht und dort als Modell für Kopien benutzt. Die Kopien werden ihrerseits in der Stadt aufgestellt, der überlebende vermeintliche Märtyrer selbst kopiert seine Statue, indem er sie nach Art der entsprechenden Künstler in großen Städten lebendig nachahmt.
 Er verheiratet sich mit einer Muslimin und konvertiert, er läuft zur erstarkenden Hisbollah über und verschwindet erneut. Was im Lauf der Lecture Performance untersucht wird, ist die Frage der Repräsentation im Allgemeinen: Wie verschwindet der Einzelne, das Individuum bzw. der vermeintlich souveräne Held, den man zum Märtyrer erheben und exemplarisch ausstellen kann – wenn er erst einmal zum Modell geworden ist? Und was passiert mit dem, der für das Modell den eigenen Körper opfern musste?
Er verheiratet sich mit einer Muslimin und konvertiert, er läuft zur erstarkenden Hisbollah über und verschwindet erneut. Was im Lauf der Lecture Performance untersucht wird, ist die Frage der Repräsentation im Allgemeinen: Wie verschwindet der Einzelne, das Individuum bzw. der vermeintlich souveräne Held, den man zum Märtyrer erheben und exemplarisch ausstellen kann – wenn er erst einmal zum Modell geworden ist? Und was passiert mit dem, der für das Modell den eigenen Körper opfern musste?
Diese Fragen, die an jede Errichtung von Denkmälern für gefallene »Helden « bzw. – im Sprachgebrauch des Libanons der Kriegsjahre – »Märtyrer« gestellt werden könnten, kehren sich im konkreten Fall gewissermaßen um: Was passiert mit dem Einzelnen, wenn er aus der Erhebung zum Exempel wieder auftaucht? Und was passiert mit dem geopferten Körper, wenn er nicht länger seine symbolische Bedeutung für jenen Einzelnen behalten kann, weil der als lebender Körper wieder aufgetaucht ist?
Zwischen dem Märtyrer und dem ihn überlebenden Rückkehrer tut sich eine Kluft auf, in der zum Vorschein kommt, was im Moment der Erhebung zum Märtyrer verschwinden musste: Das Singuläre des ganz spezifischen Menschen. Es zeigt sich darin, dass diesem spezifischen Menschen über das hinaus, was ihn zum Märtyrer zu machen erlaubte, eine Überlebensfähigkeit eigen war, dass er ein viele Möglichkeiten bergendes und verbergendes Wesen ist, dessen man nicht länger in Gestalt eines Bildes oder eines Denkmals gedenken kann, sondern – das ist die Pointe und Quintessenz der Performance – nur in Form einer Erzählung.
Diese Erzählung – man könnte sie in die Tradition volkstümlichen Erzählens im arabischen Raum stellen – erweist sich dabei eben darin als adäquates Medium der Darstellung des verschollenen, seine Erhebung zum Märtyrer überlebenden Gefangenen, dass sie die Illusion, diese oder irgendeine Fiktion könne adäquat zum in ihr dargestellten Objekt sein, aufkündigt: Die Verwirrung, in die wir nach dem effektvollen Coup, mit dem die Performance beginnt, in ihrem weiteren Verlauf gestürzt werden, ist jene, die sich einstellt, wenn die Bilder verblassen, die Statuen bröckeln und an ihrer Stelle Unübersichtlichkeit zum Vorschein kommt:
In dem Maße, in dem wir nicht länger in der Logik von Besonderem und Allgemeinem umfangen bleiben, können wir nicht mehr genau sagen, was es mit dem Einzelnen auf sich hat. An die Stelle eines Märtyrer-Subjekts und -Individuums tritt ein nicht zu vereinheitlichendes Bündel von Verhaltensweisen. Doch eben, wenn dies am deutlichsten wird, wenn sich die Geschichte Deeb Al-Asmars in den Wirren der libanesischen und syrischen Geschichte verliert, wechselt die Performerin Lina Majdalanie von der Erzählung in der dritten Person in eine in der ersten Person.
Das Ich, das sie bemüht, so merken wir nun, ist nichts anderes als eine sprachliche Fiktion. Mroués Performance stellt sich in letzter Instanz als Auseinandersetzung mit der Identitätspolitik dar, die ihre Züge in allen Einzelheiten des politischen Lebens der von Kriegen gezeichneten vergangenen Jahrzehnte hinterlassen hat: Sie zeigt sich in der Errichtung von Statuen im öffentlichen Leben wie in der Suche nach adäquaten Bildern im privaten Leben, in Zuschreibungen und Bildwerdungen, die in jedem Fall mit dem Verlust dessen einhergehen, was sich unstet, wandelbar und ungreifbar körperlich, und dabei als Körper mit Überlebensfähigkeiten unvorhersehbarer Art ausgestattet, bemerkbar macht.
Die Distanz zum Eigenen
Die Entdeckung des Fremden bei Ra’ad und Mroué ist nicht zu verwechseln mit dem, was Brecht als »Verfremdung« bezeichnet hat: Brecht folgerte aus Hegels Satz, wonach das Bekannte eben deshalb, weil es bekannt sei, nicht erkannt werde, dass die Erkenntnis der Dinge voraussetze, dass sie uns erst fremd würden, um uns dann umso bekannter werden zu können.
Dagegen verweisen uns die libanesischen Performer auf eine anfängliche Fremdheit, die sich in allem bemerkbar macht, was nicht aufgeht in der Repräsentation – auf den körperlichen Rest, auf die nur sprachliche Setzung, auf das Medium, dessen das Erscheinen und die Repräsentation des Eigenen wie des Fremden bedarf, ohne doch jemals restlos in ihr aufzugehen.
 Auch wenn sich Ra’ad wie Mroué beständig mit den Fragen beschäftigen, die ihnen durch ihre Herkunft und ihr Umfeld gleichsam aufgedrängt wurden – mit den Kriegen im Libanon, mit dem Krieg gegen den Terror und seinen Folgen für die pauschal zu »Arabern« erklärten Menschen im Nahen Osten und anderswo, mit den Verschwörungstheorien der arabischen Welt und den religiösen Fundamentalismen – ziehen sie sich dabei doch niemals darauf zurück, einen privilegierten Zugang zu diesen Themen zu haben, Geschichte authentisch zu schreiben, mit der Stimme der Opfer und Unterprivilegierten zu sprechen.
Auch wenn sich Ra’ad wie Mroué beständig mit den Fragen beschäftigen, die ihnen durch ihre Herkunft und ihr Umfeld gleichsam aufgedrängt wurden – mit den Kriegen im Libanon, mit dem Krieg gegen den Terror und seinen Folgen für die pauschal zu »Arabern« erklärten Menschen im Nahen Osten und anderswo, mit den Verschwörungstheorien der arabischen Welt und den religiösen Fundamentalismen – ziehen sie sich dabei doch niemals darauf zurück, einen privilegierten Zugang zu diesen Themen zu haben, Geschichte authentisch zu schreiben, mit der Stimme der Opfer und Unterprivilegierten zu sprechen.
Der Schacht in der Synagoge wie auch der singuläre Körper in der Lecture Performance verweisen vielmehr gleichermaßen auf eine Komplikation im Verhältnis von Eigenem und Fremdem: eben darauf, dass schon das vermeintlich Eigene unendlich fremd bleibt und das Fremde nur vermittelt über Eigenes erfahrbar wird, jedoch niemals als solches, sondern nur in einer Fiktion, welche die Grenze zwischen dem Fremden und dem Eigenen selbst neu zu verhandeln erlaubt. Die Arbeiten Walid Ra’ads und Rabih Mroués stellen solche Verhandlungen dar.