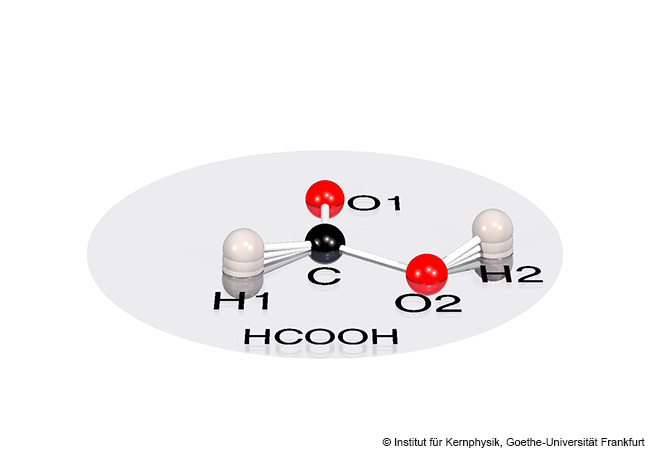Soeben ist das Buch „Geschichte Europas im 20. Jahrhundert“ des Historikers Christoph Cornelißen erschienen. Goethe-Uni online sprach mit dem Professor für Neueste Geschichte an der Goethe-Universität über Erinnerungskultur beim Schreiben, über Trennendes und Verbindendes unter Europäern und wie das Buch seinen Blick auf Europa beeinflusst hat.
„Europageschichte schreiben“ war lange Zeit gleichbedeutend mit „Weltgeschichte schreiben“. In der gegenwärtigen Situation eine Geschichte Europas im 20. Jahrhundert zu verfassen – was war die größte Herausforderung?
Prof. Dr. Christoph Cornelißen: Da gibt es eine ganze Anzahl von Herausforderungen – eine davon ist aber immer noch, sich vom klassischen eurozentristischen Bild zu lösen. Der Tatsache eben, dass Europa bis ins 20. Jahrhundert eine dominante Weltmacht gewesen ist und damit auch den Anspruch verbunden hat, universale Werte zu setzen. Einer meiner Leitpunkte war nun, dieses moderne Europa in seiner komplexen Zusammenstellung nationaler, regionaler, sozialer, aber auch geschlechterbedingte Unterschiede in den Mittelpunkt zu rücken und ernst zu nehmen. Andererseits wollte ich die verbindenden Elemente betonen.
Ihr Buch macht deutlich: Was Europa ist, ist gar nicht klar. Wann und wo es beginnt – zeitlich und räumlich – ist offen.
Historiker bemühen sich nicht zuletzt auch darum, historische Wahrnehmungen zu rekonstruieren. Also habe ich an den Anfang meines Buches ein Zitat aus der Enciclopedia Britannica von 1910 gesetzt: Die Frage der Grenzen sei eine offene, heißt es dort. Alle Definitionen sind abhängig von den Kriterien, die in sie einfließen. Es gab schon vorher Auffassungen von Europa weit über die herkömmlichen Grenzen hinaus – im Süden bis zur Sahara, im Osten entweder Russland einschließend oder bewusst ausschließend, im Westen bis nach Südamerika und Nordamerika.
Noch einmal, Ihr Buch soll keine Universalgeschichte liefern. Und doch verlangt die Geschichte Europas über ein Jahrhundert eine enorme Syntheseleistung.
Es ist schon ein bisschen vermessen und braucht auch großen Mut zur Lücke. Dass aber heute gleich mehrere Historiker den Versuch einer Synthese unternehmen, also die sehr intensive Detailforschung der vergangenen Jahre in einer Gesamtdarstellung zusammenführen wollen, ist kein Zufall. Es hat damit zu tun, dass wir uns 30 Jahre nach einer ganz entscheidenden Wende in der Globalgeschichte befinden, der Revolution von 1989/90.
Ich gehöre einer Generation an, die diese Entwicklung als Zeitzeuge erlebt hat und nun versucht, mit dem Instrumentarium des professionellen Historikers diese Entwicklung neu einzuordnen. Allerdings sind dies Syntheseversuche, die immer nur auf Zeit wirken können.
In Ihrem Buch nennen Sie drei Kraftzentren, über die Sie quasi Schneisen in die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts schlagen.
Historiker versuchen immer, Schneisen durch ein Dickicht der Geschichte zu legen. Ich habe drei Teilfelder genannt: erstens der flächendeckende Durchbruch nationalstaatlicher Ordnungen, zweitens die wirtschaftlichen und sozialen Strukturveränderungen, die sich auf das gesellschaftliche Selbstverständnis der europäischen Länder auswirken, drittens die europäischen Ideen und Utopien. Mein Versuch ist, entlang dieser Teilfelder die europäische Geschichte zu betrachten – aber nicht nur der Reihe nach, sondern wie sie sich verflechten. Das heißt: Wie sind spezifische Ideologien vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse zu erklären, und welche Rückwirkungen gibt es auf die nationalstaatlichen Ordnungen? Das Ineinander-verflochten-Sein dieser drei Dimensionen würde ich als einen besonderen Anspruch formulieren.
Eines Ihrer Spezialgebiete ist die Erinnerungskultur. Inwiefern hat Sie es beim Schreiben des Buches beeinflusst?
Ich habe versucht, entscheidende Schlüsselmarken des 20. Jahrhunderts zu befragen: Wie haben sie Erinnerungshaushalte von Individuen und Gesellschaften mitgeprägt? Ein herausragendes Ereignis sind die Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Sie werden ja nicht zufällig in Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Italien bis heute als großer Krieg erinnert. Die Niederlage gibt hingegen in Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich einen ganz anderen Erinnerungshaushalt zu erkennen, der viel mit der Schuld am Weltkrieg zu tun hatte. Und im Osten ist die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg gegenüber der Erinnerung an die Neugründung der Staaten und den Aufbau des Sowjetischen Systems lange eher untergegangen.
Sie haben an dem Buch mehrere Jahre gearbeitet. Gibt es etwas, was Ihnen über die Jahre immer klarer geworden ist?
Ja, das erhebliche Gewicht imperialer Verflechtungen in vielen europäischen Ländern. Das ist aus der deutschen Perspektive nicht zufällig in Vergessenheit geraten, weil mit dem Wegfallen der Kolonien nach dem ersten Weltkrieg das imperiale Gedächtnis in Deutschland – vorsichtig gesprochen – gelitten hat. Die Restitutions- und auch Restaurationsforderungen erinnern uns gerade daran. In anderen Ländern ist das sehr viel präsenter. Etwa in den ehemaligen großen westeuropäischen Imperien wie Großbritannien und Frankreich, aber auch in Belgien, den Niederlanden, in Spanien und Portugal; aber auch in den Ländern mit dem Erbe des Habsburger und des Osmanischen Reiches. Das zeigt dort eine langfristige Wirkung bis in die Gegenwart.
Aber hat der Zweite Weltkrieg, der dieses Europa ja buchstäblich zerrissen hat und traumatische Erfahrungen in allen Ländern ausgelöst hat, nicht Europa viel stärker geprägt?
Ohne jeden Zweifel blieben die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg für alle Gesellschaften in Europa, auch diejenigen, die nicht direkt davon betroffen waren, über viele Jahrzehnte höchst präsent. Wir dürfen jedoch über diese Feststellung nicht übersehen, wie sehr die Ungeheuerlichkeit der massenhaften Kriegsverbrechen und vor allem der Holocaust lange Zeit mit einem beredten Schweigen belegt worden sind. Außerdem sorgten erst die geopolitischen Konstellationen im Kalten Krieg dafür, dass in diesen Jahrzehnten Europa in einen Ost- und Westblock getrennt worden ist.
Mit dem geänderten Verhältnis zu den USA steht auch das Selbstbild Europas in Frage. Gibt die Geschichte eine Richtung für eine Neuorientierung vor?
Die EU möchte nun schon länger das Bild einer zivilen Macht verbreiten, die sich mit dem Anspruch universaler Menschenrechte gegenüber anderen größeren Mächten behauptet. Dass dieser Anspruch mittlerweile in anderen Weltregionen mit großer Skepsis, ja auch mit Widerstand gesehen wird, liegt auf der Hand. Es hat deswegen dazu geführt, dass sich in Europa die Kräfte scharen, die vielleicht nicht eine vollständige Abkehr von einer reinen Zivilmacht einläuten möchten, aber doch die Möglichkeit der Selbstverteidigung oder zumindest der Selbstbehauptung mit anderen Mitteln befürworten.
Kann der Blick zurück auf Europas Anfänge Orientierung für die Zukunft geben?
Historiker sind rückwärtsgewandte Propheten und keine vorwärtsgewandten. Aber in Hinblick auf die Erfahrungen historischer Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts könnte man die These aufstellen, dass die Europäer entlang des eingeschlagenen Pfades weitergehen müssen: Sie müssen die Bemühungen erhöhen, die politische Integration und den ökonomischen Austausch zu intensivieren, um ein friedliches Zusammensein zu ermöglichen. Das heißt auch: Man wird erhebliche Bildungsanstrengungen unternehmen müssen. Bei vielen Reisen als Historiker ist mir ein gravierendes Problem aufgefallen: Unsere Abtrennung ist nicht nur institutionell erheblich, sondern auch intellektuell. Wir haben etwa auch – anders als in anderen Weltregionen – eine starke Vorherrschaft von Einsprachigkeit. Mit der Folge, dass wir uns wechselseitig innerhalb Europas kaum verstehen.
Was wir weiterhin erkennen können: Das Jahrhundert der Gewalt ist nicht an ein Ende gekommen. Die Kriege sind uns an unseren Grenzen förmlich näher gerückt. Ich erinnere an die Konflikte in Jugoslawien, der Ukraine, der Krim, in der Ägäis, auch an die Bedrohung durch den Terrorismus. Auch hier lässt sich vom Anarchismus und den terroristischen Attacken um die Wende zum 20. Jahrhundert eine direkte Linie ziehen zu den gegenwärtigen Erfahrungen eines kulturell-religiös aufgeladenen Terrorismus mit politischen Begleiterscheinungen.
Welche Schlüsse würden Sie daraus ziehen?
Gerade in Bezug auf West- und Osteuropa scheint mir zwingend notwendig, mehr historisches Verständnis zu entwickeln. Vor allem in Westeuropa liegt eine unterentwickelte Kompetenz vor, sich mit den historischen Hintergründen für anders geartete Entwicklungen in Osteuropa vertraut zu machen. Wobei man hinzufügen muss: Auch in der Gegenrichtung gibt es Nachholbedarf. Das „Über-den-nationalen-Tellerrand-Blicken“ stellt eines der großen Defizite dar.
Sie schreiben ja auch als Zeitgenosse. Hat sich Ihr Bild von Europa beim Schreiben verändert?
Ich habe schon versucht, mir meine eigene Geschichte mit Hilfe dieses Buches zu verdeutlichen. Und dabei sind mir sehr positive, selbstverständlich erscheinende Kapitel der europäischen Geschichte in einem trüberen Licht erschienen. Das betrifft nicht zuletzt auch die Versuche der Politik, in rein zivilgesellschaftlicher Absicht zu agieren. Wir müssen uns aber alle fragen, wie wir die wirtschaftliche und auch die kulturelle Selbstbehauptung Europas vor dem Hintergrund der globalen Verhältnisse verteidigen und dies auch durchsetzen können. Das ist eine der Erkenntnisse: Da bedarf es doch erheblich gesteigerter Anstrengungen, um uns in genau diese Lage versetzen zu können.
Eine weitere Erkenntnis?
Ich finde interessant zu sehen, dass wir uns im Moment in einer Phase bewegen, in der auch die Unterschiede innerhalb Europas wieder stark akzentuiert werden. Grenzen werden in der Covid-19-Krise teilweise geschlossen, das jeweilige Gesundheitssystem hat Priorität. Wir erleben nationales Aufbegehren und Proteste gegen Solidarisierung. Gleichzeitig ist aber das europäische Bewusstsein, auch durch die europäische Integrationspolitik gefördert, bei Millionen Menschen unverkennbar größer geworden: Ich denke an alltagskulturelle Praktiken wie Speisen, Sport, Kultur, an bi-nationale Ehen.
Aber wenn man sich klarmacht, dass genau das Teil des europäischen Daseins seit mindestens einem Jahrhundert ist, dann gewinnt man mehr Gelassenheit, was die Zukunft angeht. Wir denken, wir sind in einer besonderen, besonders kritischen Lage: Dabei können wir sehen, dass vorhergehende Generationen gegenüber ähnlich großen Herausforderungen Lösungen angestrebt und teilweise auch gefunden haben.
Interview: Pia Barth; Foto: privat
Christoph Cornelißen: „Europa im 20 Jahrhundert“, Frankfurt 2020 (Reihe Neue Fischer Weltgeschichte), ISBN 978-3-10-010827-2, 704 Seiten