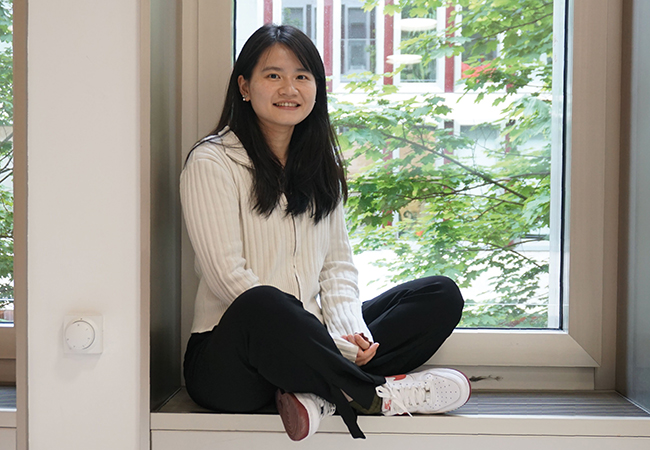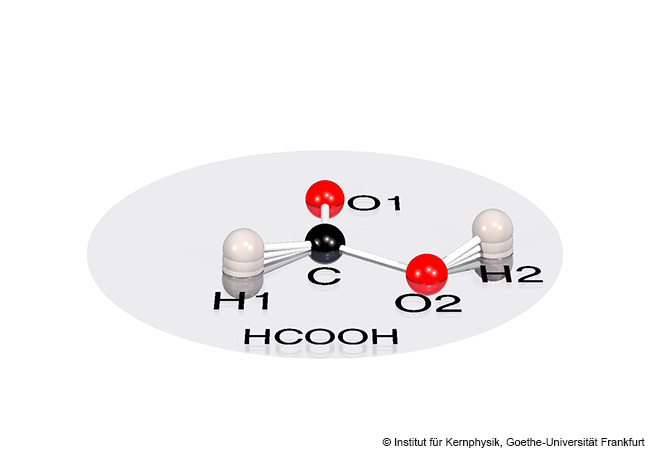UniReport: Herr Kirchhoff, wenn Sie heute auf die Zeit an der Goethe-Uni zurückschauen: Woran erinnern Sie sich am intensivsten?
Bodo Kirchhoff: Ich bin 1970, nach einem längeren Amerika-Aufenthalt, im Wintersemester an die Uni gekommen, um Pädagogik zu studieren. Vor der Mensa in Bockenheim standen damals die Büchertische; dort fand man alles, von dem man glaubte, damit die Welt verändern und begreifen zu können. Es war von der Architektur und vom AfE-Turm her etwas sehr Dunkles, und ich hatte auch nicht eine Sekunde lang die Vorstellung, an einem Campus zu studieren. Ich beneide schon Studierende, die heute einen solchen haben.
Hat das Studium der Pädagogik Ihre Arbeit als Schriftsteller geprägt?
Pädagogik war für mich ein Fach, das eine unendliche Freiheit bot! Ich konnte alles belegen, überall hingehen, niemand wollte auch was Besonderes von einem. Es war eine Art von Studium Generale. Ich habe das Studium vor allem gewählt, weil es mir den größten Freiraum gegeben hat. Ich habe später auch promoviert, um Zeit für das Schreiben zu gewinnen. Das Entscheidende, das ich an der Uni gelernt habe, habe ich aber in privaten abendlichen Arbeitsgruppen gelernt. Mit Geisteshäuptlingen, die sich zwischen Hegel, Marx, Freud, Foucault, Lacan und anderen bewegten. Ein geistesparadiesischer Zustand; gleichzeitig gab es aber auch niemanden, der einen an die Hand genommen und einem die Richtung gewiesen hätte. Man war also auch ein Stück weit in dieser Freiheit sehr verloren.
Ihr Kollege Andreas Maier, auch Alumnus und Poetikdozent, hat in seinem im letzten Jahr erschienenen Roman „Die Universität“ den Philosophen-Jargon unter den Studierenden zum Thema gemacht.
Ja, man hat mit Begriffen um sich geworfen, sei es auch nur, um den Frauen im Seminar zu imponieren, die Frauen wollten umgekehrt sicherlich auch die Männer beeindrucken. Die Literaturlisten waren gewissermaßen der Phallus am Ende eines kleinen Aufsatzes. Es gab nicht die prüfende Instanz, die einem gesagt hätte: Lass die Kirche im Dorf! Das musste man sich schon selbst erarbeiten.
»Ich habe studiert, um Zeit für das Schreiben zu gewinnen«
Sehen Sie sich als Exponent der 68er-Generation, wie würden Sie in der Rückschau Ihr Verhältnis zur Protestgeneration beschreiben?
Exponent würde ich nicht sagen, ich bin davon berührt oder gestreift worden, ich habe mich sozusagen in diesem Fahrwasser bewegt. Aber ich habe mich nie irgendeiner Gruppierung angeschlossen. Wenn drei oder vier Leute der gleichen Meinung waren, habe ich mich zurückgezogen. Ich war schon sehr ein Einzelgänger. Ich habe ganz zweifellos von dieser Zeit profitiert, von der Unruhe, die mit meiner eigenen inneren Unruhe korrespondierte. Ich denke, dass diese äußere Ruhe und das „Gesetteltsein“ auf dem Campus heute mit einem inneren Bedürfnis der Studierenden korrespondiert, möglichst rasch in gut dotierte Stellungen zu kommen, viele wollen ja heute verstärkt Beamte werden, das ist ja wieder im Kommen. So gesehen war das damals doch eine ganz andere Zeit.
In Ihrem autobiografischen Roman „Dämmer und Aufruhr“ spielt die Mutter des Protagonisten eine große Rolle, die als schwärmerisch geschildert wird, dem Schönen zugetan ist, aber vieles nicht wahrhaben möchte. Der erste verlegte Text des Protagonisten bricht gewissermaßen mit dieser beschönigenden Weltsicht – ein Generationskonflikt, der symptomatisch für das Verhältnis der Kriegsgeneration und der ihr Folgenden ist?
Ich habe diese Auseinandersetzung sicherlich auf meine Weise in der Literatur gesucht. Es gab natürlich andere Formen, die bis in den Terrorismus geführt haben. Das war die Opposition zu den christlichen und sehr bürgerlichen Elternhäusern. Bei mir war dieser Widerstand ein anderer: Ich habe Dinge geschrieben, die „indiskutabel“ waren.
Ein anderes, wichtiges Thema Ihres Romans ist die Verführung durch den Musiklehrer. In Ihrer Poetikvorlesung 94/95 hatten Sie das Thema „Missbrauch“ im Internat bereits angeschnitten, ohne dass dies damals größere Resonanz erzielt hätte. In Ihrem Roman kommt das Thema nun in literarisierter Form vor, was viele Leserinnen und Leser sicherlich sehr bewegt hat.
Für diejenigen, bei denen die Sprache nicht Teil ihres Berufes ist, ist es sicherlich sehr schwer, über so etwas zu reden. Für mich hingegen ist die Sprache mein Ein und Alles, mir schadet es nicht, wenn ich darüber rede, mich bringt das weiter. Für mich ging es nicht darum, etwas zu offenbaren, sondern darum, eine angemessene Sprache dafür zu finden. Für mich war das immer in erster Linie eine Herausforderung als Schriftsteller.
Hat die öffentliche Debatte um MeToo einen Einfluss auf Ihr Werk gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Den Roman habe ich nach dem Tod meiner Mutter begonnen; das hätte ich auch fortgeführt, wenn um mich herum die Welt eingestürzt wäre. Bei der Debatte um MeToo muss man vorsichtig sein: Ich finde es grundsätzlich richtig, dass darauf hingewiesen wird, dass jegliche Form sexueller Belästigung besonders von Abhängigen völlig indiskutabel ist. Dazu gibt es bereits viele Gesetze, die man ausschöpfen muss.
Christian Kracht hat in seiner Poetikvorlesung mit der Erinnerung an einen Missbrauch seitens eines Geistlichen für Aufsehen gesorgt, auch wenn er dies nicht literarisiert hat.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen: Mich interessiert nicht so sehr, was andere machen. Ich habe sozusagen meine eigene Zeitrechnung in diesen Dingen. Das trifft auch auf 68 an der Uni zu: Ich habe eigentlich von Anfang an meinen eigenen Plan verfolgt, als Schriftsteller mein Leben zu verbringen; alles andere hat mich sehr wenig interessiert.
Sie sind promovierter Pädagoge und kennen sich auch in der Wissenschaft gut aus; spielt die Wissenschaft für Sie noch eine Rolle?
Nein, überhaupt nicht. Es ist sicherlich so, dass ich das ein oder andere Buch, das mich interessiert, mit größerer Leichtigkeit lesen kann. Was meine Bücher reich macht, beziehe ich aber über meine Augen und Ohren, und natürlich über andere Literatur. Was ich lese, ist zu ca. 99 Prozent Literatur.
Wäre eine Fortführung des Romanprojekts denkbar, bis in die Gegenwart?
Nein, auf keinen Fall. Denn alles, was danach käme, wäre sozusagen eine Karrieregeschichte, und die interessiert mich nicht. Mich hat interessiert darzustellen, wie zwingend bei mir das Schreiben war, dass es dazu praktisch keine Alternative gab. Ich gebe ja seit 16 Jahren gemeinsam mit meiner Frau Schreibseminare in Italien, und da kommen auch immer wieder Leute mit der Vorstellung, man könne mal nebenbei ein Buch schreiben. Schreiben heißt aber, dass vieles andere eben nicht geht.
Die Fragen stellte Dirk Frank
Bodo Kirchhoff: Dämmer und Aufruhr. Roman der frühen Jahre, Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt 2018
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.19 des UniReport erschienen.