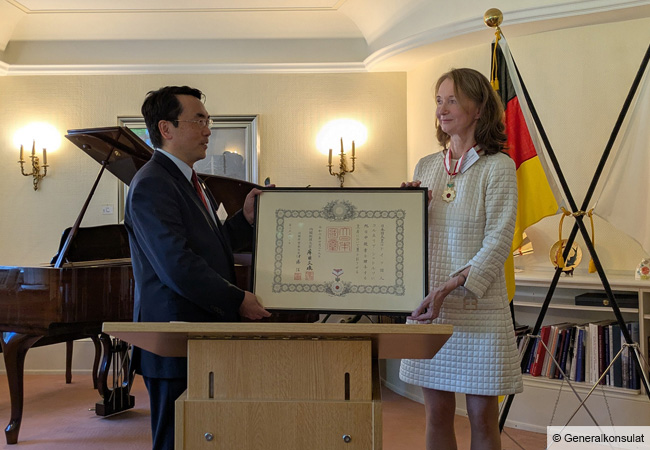Der Historiker Werner Plumpe zeigt in seinem neuen Buch „Gefährliche Rivalitäten“, wie Geschichte immer schon von wirtschaftlichen Rivalitäten geprägt war.

UniReport: Herr Plumpe, einmal etwas salopp gefragt: Haben wir dieses Buch Donald Trump und seiner zweiten Amtszeit zu verdanken?
Werner Plumpe: Nein, der Vertrag über das Buch stammt vom Dezember 2023. Aber die Wahl von Donald Trump hat dem Thema erhebliche zusätzliche Brisanz verliehen.

Sind die Voraussetzungen, in diesen bewegten Zeiten als Historiker ein Buch zu schreiben, eigentlich gut? Es passiert natürlich einiges, aber lassen sich die Brüche und Verschiebungen bereits welthistorisch einordnen? Mit anderen Worten: Ist besonders Trumps Unberechenbarkeit eine Zumutung für Gegenwartsdiagnosen oder sollte man sein erratisches Agieren auch nicht überbewerten, gibt es dafür vielleicht sogar auch Vorläufer?
Da sprechen Sie einen zentralen Punkt an. Die gegenwärtigen Ereignisse entziehen sich der historischen Analyse, und über die Zukunft ist der Historiker so ratlos wie alle anderen. Die Einordnung der gegenwärtigen „Turbulenzen“ verlangt andererseits gerade nach dem historischen Blick, der es vielleicht erleichtert, die aktuellen Ereignisse nicht so zu dramatisieren, wie das bezogen auf die Person von Donald Trump derzeit in der Regel der Fall ist.
Wirtschaftskriege gebe es schon lange, sagen Sie in Ihrem Vorwort, doch sei es spätestens seit dem 17. Jahrhundert immer stärker darum gegangen, die eigene Produktionskraft zu stärken, die des Gegners zu schwächen. Können Sie das vielleicht kurz erläutern?
Die jeweilige Wirtschaftsleistung entscheidet nicht nur über die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. In einer Welt unterschiedlicher Staaten bestimmt sie auch weitgehend deren Handlungsmöglichkeiten, sodass es in der Staatenkonkurrenz eine Frage der Selbstbehauptung wurde, die eigene Wirtschaftskraft zu stärken und die der wirklichen oder vermeintlichen Gegner zu schwächen. Wirtschaftlich zumindest so stark zu sein, die eigene Existenz zu sichern und die Handlungsspielräume der Konkurrenten möglichst einzugrenzen, war daher entscheidend. Wirtschaftskriege haben insofern mit Wirtschaft vor allem instrumentell zu tun. Vorrangig geht es um die politische Frage der jeweiligen Handlungspotenziale.
Der Begriff des »Wirtschaftskrieges« ist eigentlich eine Metapher, denn streng genommen wird die Auseinandersetzung zwischen Staaten nicht militärisch, sondern mit Mitteln des wirtschaftlichen Handelns ausgetragen. Oder kann ein Wirtschaftskrieg auch kriegerische Maßnahmen im engeren Sinne umfassen?
Hier ist die Abgrenzung grundsätzlich nur schwer möglich, denn die Eskalationspotenziale waren und sind gewaltig. Handelsblockaden, Sanktionen und Boykotte können leicht in offene Konflikte umschlagen, wie andererseits auch gezielt Gewalt (etwa Kaperwesen und Piraterie) eingesetzt wurde, um unter der Schwelle des offenen Krieges der Konkurrenz materiell zu schaden.
Sie konstatieren für die Gegenwart einen Ordnungsverlust, bedingt durch das Ende einer von den USA dominierten Welt (was keineswegs für eine Phase des weltweiten Friedens gestanden habe). Was könnte an die Stelle der Pax Americana treten, wer wird eine neue Ordnung aufrechterhalten können? Ist Trumps „Dealmaking“ eine neue Variante multilateralen Handelns in einer ‚unordentlichen‘ Welt?
Historisch gesehen sind Phasen einer nach Regeln ablaufenden grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Kooperation, in der es natürlich weiterhin Wettbewerb gibt, eher selten. Solche Phasen gab es vor allem dann, wenn ein Staat wie Großbritannien nach den napoleonischen Kriegen oder die USA nach dem Zweiten Weltkrieg so dominant ist, dass er nicht nur die Regeln der Kooperation bestimmen kann, sondern alle anderen letztlich aus Eigeninteresse veranlasst sind, auf gute Beziehungen mit der stärksten Wirtschaftsmacht zu setzen. Das ist aber, wie gesagt, sehr voraussetzungsvoll, und die Voraussetzungen der Pax Americana sind in den vergangenen Jahren ebenso erodiert wie die britische Dominanz vor 1914. Die Gefahr besteht, dass die neue Multipolarität, in der es einen dominanten Akteur nicht mehr gibt, Eskalationen auslöst, die in eine große Katastrophe münden können. Insofern ist Trumps Deal-Politik, also robuste Wirtschaftsdiplomatie mit dem Ziel, sich irgendwann zu einigen, unter Umständen ein Lichtblick, dass der große Knall vermieden werden kann. Garantien dafür gibt es keine, aber die stete Mischung von Boykotten, Piraterie und Krieg vor allem zwischen Frankreich und Großbritannien, die die multipolare Welt der vornapoleonischen Zeit beherrschte und letztlich in den großen Krieg der Jahre um 1800 mündete, zeigt, wie viel auf dem Spiel steht.
Eine Abschottung über Zölle, sagen Sie, können eigentlich nur große Volkswirtschaften wie die USA oder China überstehen, deren Markt groß genug ist. Das bedeutet aber, dass eine Exportnation wie Deutschland im besonderen Maße von freiem Handel abhängig ist, Zollschranken treffen uns in besonderem Maße. Sie schreiben an einer Stelle mit Blick auf Deutschland: Je größer die Integration in die Weltwirtschaft, desto geringer die autonome Handlungsfähigkeit. Diese Paradoxie auszuhalten, darauf käme es an?
Staaten wie Deutschland, die Niederlande oder Italien können deshalb keine Wirtschaftskriege führen, da der Erfolg ihrer Volkswirtschaften viel zu sehr von einer funktionierenden Arbeitsteilung abhängt. Je mehr Handel, umso erfolgreicher, und umso geringer die autonomen Handlungsmöglichkeiten. Der Erste Weltkrieg ist sehr lehrreich; die schärfste Waffe der Alliierten war die effektive Blockade Deutschlands und dessen Ausschluss von der Weltwirtschaft. Dass die NS-Regierung auf Autarkie gesetzt hat, um nicht vom Welthandel abhängig zu sein, war wirtschaftlich unsinnig; es diente allein dem Krieg. Die deutsche Volkswirtschaft ist um den Preis ihres Erfolgs auf offene Märkte angewiesen. Das ist nicht immer einfach, aber letztlich unvermeidlich. Das derzeitige Reden, sich unabhängig zu machen, ist insofern weder vielversprechend noch wirklich vernünftig.
Ein grenzüberschreitendes Wirtschaften ohne jegliche Wirtschaftskriege wäre prinzipiell für alle beteiligten Länder von Nutzen – oder gibt es doch immer auch Verlierer dabei?
Ja, gerade das macht Ordnungen, selbst wenn sie zustande kommen, auf Dauer brüchig. Ordnungen garantieren zumeist einen beschleunigten ökonomischen Strukturwandel, von dem die Ordnungsmächte selbst aber nicht notwendig besonders profitieren. Großbritannien verlor in der Pax Britannica ebenso sukzessive an ökonomischem Gewicht wie derzeit die USA in der globalen Ordnung, die sie selbst herbeigeführt haben. Großbritannien war so klug, sich mit dem Wandel zu arrangieren, zumal es dem Land trotz seiner Gewichtsverluste wirtschaftlich gut ging. Das ist mit den USA derart anders, die ihren Gewichtsverlust gegenüber China als existenzielle Bedrohung wahrnehmen. Das war schon bei Obama und Biden so; Trump nutzt andere Mittel, ist seinen Vorgängern aber so unähnlich nicht.
„Statische“ Konstellationen sind Ihrer Ansicht nach die Ausnahme: In friedlichen Zeiten führt Wirtschaftswachstum zu Konflikten; in Phasen von Wirtschaftskriegen hingegen entsteht quasi wieder der Wunsch nach einer neuen Ordnung. An anderer Stelle sprechen Sie auch von der ewigen Paradoxie von Ordnung und Rivalität. Diese ewige Dialektik kann einen also zugleich optimistisch als auch pessimistisch nach vorne blicken lassen?
Es gibt im ökonomischen Wandel keine statischen Zustände. Jede neue Technik, jede Verschiebung von Transportkosten, jede Verschiebung von Arbeitskräften, Kapital und Wissen ändern die Bedingungen und variieren die regionalen Gewichte. Ordnungen in diesem steten Wandel sind selten und sehr voraussetzungsvoll. Bisher waren sie das Ergebnis großer Kriege mit nur einem Sieger. Dieser Preis erscheint mir aber zu hoch; daher sind mir robuste Aushandlungsprozesse schlicht sympathischer, auch wenn das keineswegs einfach wird und stets die Bereitschaft zum Kompromiss voraussetzt.
Jedenfalls ließe sich auch wirtschaftshistorisch ein „Ende der Geschichte“, wie in den 90er-Jahren noch von Francis Fukuyama behauptet, nicht begründen?
Nein, das ist völlig unrealistisch. Der Wandel hört nie auf, und da Wirtschaftskraft über politisches Gewicht entscheidet, wird es auch bei Rivalitäten bleiben. Dass aus diesen Rivalitäten gefährliche Konflikte werden, lässt sich, wenn Vernunft und Kaltblütigkeit vorherrschen, allerdings unter Umständen vermeiden.