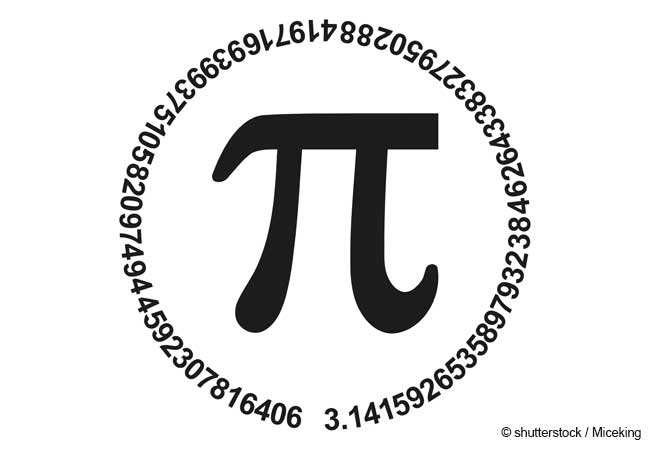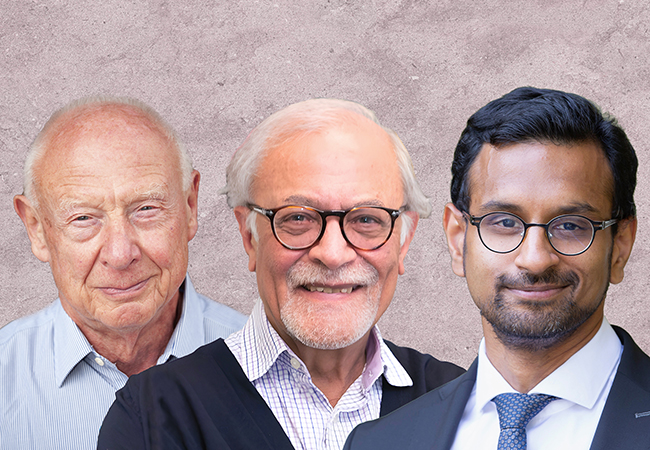Die Kunstpädagogin Katja Gunkel erforscht, wie Social Media, dabei speziell Instagram, den alltäglichen Umgang mit Bildern massiv verändert hat.

UniReport: Frau Dr. Gunkel, wie sind Sie als Kunstpädagogin auf das Thema Social Media gekommen? Man könnte meinen, dass es sich eher um ein medienwissenschaftliches Thema handelt, oder wäre das zu eng gedacht?
Katja Gunkel: Zum Einstieg scheint es mir produktiv, die Frage nach dem Verständnis von Kunstpädagogik zu stellen. Nicht umsonst heißt der an unserem Institut angebotene Bachelor- und Masterstudiengang „Kunst, Medien, kulturelle Bildung“. Ich selbst habe am Lehrstuhl Neue Medien von Prof.in Dr. Birgit Richard promoviert, die für ihre Expertise im Bereich jugend- wie popkultureller Stile und materieller Kulturen bekannt ist. Die dort betriebene Forschung steht in der Tradition der Critical Cultural Studies und bezieht daher Bilder ganz unterschiedlicher Provenienz aufeinander. Auch im Sinne der Visuellen Kultur, am Institut vertreten durch Prof.in Dr. Verena Kuni, greift der alleinige Fokus auf Kunst im engeren Sinne zu kurz. Folglich wird die Forschungsperspektive um alle Bilder, die uns im Alltag umgeben, erweitert. In dem Zusammenhang ist ein kritischer Blick auf produktions- und rezeptionsästhetische Aspekte unerlässlich, sind Bilder doch sowohl Produkte als auch Produzenten von Diskursen. Die Forschungsdesigns sind somit notwendigerweise transdisziplinär, gehen dabei jedoch stets vom konkreten Gegenstand, das heißt Bildphänomen, aus.
Ihnen ist am Anfang Ihrer Beschäftigung aufgefallen, dass die Bilder unserer Gegenwart im Gewand des Altertümlichen daherkommen. Das ist aber mittlerweile wieder verschwunden?
Ja, die Presets zur One-Click-Bildbearbeitung haben in den Anfängen von Social Media, stilprägend war hier vor allem Instagram (Version 1.0, 2010), vor allem Look und Haptik von analogen Fotoabzügen zitiert. Das gehäufte Aufkommen dieser, damals im Feuilleton häufig als ‚Retro-Kamera-Apps‘ bezeichneten, mobilen Softwareanwendungen hat verschiedentlich Theoretiker*innen auf den Plan gerufen. So spricht Simon Reynolds vor allem im Bereich der Popmusik von „Retromania“ (2011), die seit der Jahrtausendwende durch die simultane Präsenz vergangener Jahrzehnte und deren Revivals gekennzeichnet sei, jedoch keine eigene Identität besitze. Hans Ulrich Gumbrecht wiederum konstatiert eine „breite Gegenwart“ (2010), die in Anbetracht einer krisenhaft vorgestellten Zukunft Vergangenes nicht loslassen könne.
An den Bildphänomenen hat mich ursprünglich insbesondere der vermeintliche Widerspruch von modernster Digitaltechnologie, welche die Produktionsmittel kennzeichnet, und dem stilistischen Rückbezug auf weitgehend historisch gewordene fotografische Kulturtechniken interessiert. Spannend fand ich auch, dass mit den formalästhetischen Anleihen an Polaroid-Material Original und Unikat plötzlich zumindest in Form geisterhafter Nachbilder im Diskurs des mobilen digitalen Bildes auftauchen. Besagte ‚Retro-Ästhetik‘ spielt gegenwärtig jedoch keine nennenswerte Rolle mehr.
Man spricht seit einigen Jahren auch von der Konsumästhetik.
Vor dem Hintergrund der im spätkapitalistischen Alltag omnipräsenten wie vielgestaltigen Verzahnung von Ästhetik und Konsum widmete sich das gleichnamige interdisziplinäre Forschungsverbundprojekt, in dessen Kontext ich promoviert habe und an dem unter anderem Prof. Dr. Heinz Drügh und Prof.in Dr. Birgit Richard beteiligt waren, der neutralen wie differenzierten Betrachtung unseres Umgangs mit käuflichen Dingen, wie er sich in den verschiedensten Arten des Ge- und Verbrauchs sowie den vielfältigen Formen der Aneignung von Konsumobjekten zeigt. Weder affirmierend noch pathologisierend geht es bei einer konsumästhetischen Forschungsperspektive zunächst um die Anerkennung der ästhetisch-semiotischen Besetzung von und Identifikation mit kulturindustriellen Gegenständen. Der Terminus setzt sich demzufolge entschieden von der diskursdominierenden negativ konnotierten Bezeichnung „Warenästhetik“ ab, die Wolfgang Fritz Haug 1971 prägte.
Wie geht man als Forscher*in vor, inwieweit muss man sich auf die Welt der Apps einlassen, sie selber auch anwenden (können)?
Angelehnt an die von Mieke Bal formulierte kulturanalytische Herangehensweise gehe ich grundsätzlich qualitativ-empirisch, und zwar in der Regel induktiv-phänomenologisch vor: Das heißt, ich entwickle meine Fragestellungen und Hypothesen in enger Auseinandersetzung mit dem Material und nicht umgekehrt. Ich gehe zuerst einmal mit einer großen Offenheit auf den Untersuchungsgegenstand zu. Mithilfe einer transdisziplinären Methodologie versuche ich, die verschiedenen Ebenen des Gegenstandes abzudecken. Ich bin aber in erster Linie Bildwissenschaftlerin, keine Sozialwissenschaftlerin. Ich führe zum Beispiel keine Interviews mit den User*innen. Von den Bildern komme ich zur deren Produktionskontext, das heißt zu Software und Hardware. Aus konsumästhetischer Perspektive betrachte ich eine App als Warenform, die einer Usability- und Convenience-Logik folgt. So können die Bilder mit bestimmten Filtern bearbeitet werden, die vorkonfektioniert sind. Als kulturelle Artefakte knüpfen diese visuellen Schablonen an bestimmte Sehgewohnheiten und Bildtraditionen an, gemäß der Konzeption impliziten Wissens schreiben sie ebenso soziokulturelle Bias fort. Das interessiert mich natürlich besonders.
Dennoch schaue mir ebenso an, mit welchem Werbeversprechen die Apps locken, zum Beispiel. im Fall von Instagram mit einer Instant-Nobilitierung und Ästhetisierung des mobilen digitalen Bildes. Alles lässt sich per One-Click in ein ‚Kunstwerk‘ transformieren, Filter sei Dank – so zumindest die herstellerseitige Verheißung. Einerseits also eine Verkunstung der App, verbunden mit einer Demokratisierung von Produktionsmitteln und einer Partizipation der User*innen an der Kunsterzeugung. Andererseits eine zunehmende Entfremdung von weitgehend automatisiert ablaufenden Bildverarbeitungsprozessen sowie visuelle Uniformität, algorithmisch erzeugte Filterblasen, Plattformkapitalismus und Kommerzialisierung des ‚Sozialen‘, die auf verschiedensten Ebenen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen einhergeht. Allein, bereits die Teilhabe an Social Media muss Mensch sich buchstäblich leisten können.
Wie sieht es aus mit dem Einwand, dass man ja nur auf den Knopf drückt und das Gerät beziehungsweise die App das Bild von alleine generiert. Würden Sie das gelten lassen?
Wer so argumentiert, ist vermutlich auch der Überzeugung, dass Kunst von handwerklichem Können kommt. Diese Position hat sich jedoch spätestens mit der Konzeptkunst überholt. Die Entscheidung, bei der Bilderstellung einen bestimmten Filter zu verwenden, vielleicht sogar mehrere miteinander zu kombinieren, ist meines Erachtens bereits eine produktive Handlung – ob das gleich künstlerisch zu nennen ist, lässt sich am und im Einzelfall diskutieren. Es ist aber eine Handlung, die in der Welt ist und für viele Menschen eine hohe Alltagsrelevanz besitzt. Eine App wie Instagram hat fundamental die Art und Weise verändert, wie wir heutzutage mit Bildern umgehen, wie wir vielleicht auch durch die Welt gehen und diese nach einer bestimmten Bildförmigkeit abscannen. Früher sprach man von Fotogenität, heute von Instagrammabilität. Diese Wechselwirkung findet man gerade im touristischen Kontext sehr stark. Menschen, die das Virtuelle aus ihrem Leben verbannen möchten, sehen die Reziprozität einfach nicht.
Sie haben sich in Ihrer Forschung auch mit der Social-Media-FotoSharing-App BeReal beschäftigt. Hier können die User nur recht spontan einen ‚realen‘ Ausschnitt ihres Lebens veröffentlichen, dafür haben sie gerade einmal zwei Minuten Zeit – ein ernst zu nehmende Gegenbewegung zum Optimieren von Fotos mittels der Insta-App?
Die damit suggerierte Authentizität der Bilder ist natürlich auch nur ein Effekt der Inszenierung. Authentizität ist kein Essenzialismus, sondern etwas, das nach bestimmten Kriterien funktioniert und manche Menschen im Sinne einer glaubhaften Darstellung besonders gut beherrschen. Was man an BeReal gut sieht, ist das Ringen um ein authentisches Sein, das unverstellt, unmittelbar ist. In dem Zusammenhang finde ich beispielsweise die jüngste Kooperation von Meta mit dem Brillenhersteller Ray-Ban spannend. Im Sinne eines Wearables trifft modisches Lifestyleaccessoire auf integrierte Digitalkamera und mobiles Internet. Auch hier geht es darum die Mittelbarkeit des Fotografierens auf ein Minimum zu reduzieren, das heißt unauffällig Fotos aufzunehmen und gleichzeitig am Geschehen teilzuhaben.
Es wird nun gerade darüber diskutiert, welche Apps noch eine Zukunft haben und welche nicht. Facebook scheint für junge Leute keine Rolle mehr zu spielen – droht Instagram ein ähnliches Schicksal?
Instagram gibt es bereits seit 13 Jahren; eine beachtliche Zeit für eine App. Das Erfolgsrezept gründet vor allem auf einer aggressiven Updatepolitik. Bewährte Strategie ist die Integration von Funktionen, welche potenzielle Konkurrenz auszeichnet (Mikrovideos im Fall von Vine, Face-Filter und Stories im Fall von Snapchat, Reels im Fall von TikTok und so weiter). Auf diese Weise kommt Mensch an Instagram im Grunde nicht vorbei, vereint sie doch alle relevanten Funktionen und Medienformate.
Es gibt wiederum auch die Beobachtung, dass die User auf Social Media immer mehr in eine Passivität des Zuschauens verfallen, anstatt selber etwas zu posten oder sich zu vernetzen.
Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Instagram begünstigt medienstrukturell das komfortable wie beiläufige Konsumieren von Inhalten, die wie im Fall der Stories automatisch durchlaufen. Beim Scrollen durch den Feed muss ich hingegen noch den Minimalaufwand eines händischen Vollzugs betreiben, um die Bilder in Bewegung zu versetzen.
Der durch Social Media kultivierte Medienkonsum ist insofern problematisch, als dass die algorithmische Selektion die Entstehung von Filterblasen begünstigt. Wenn wir nur das angezeigt bekommen, was unseren eigenen Interessen entspricht, steht die Repräsentativität des Angezeigten infrage. Die Netzwerklogik begünstigt diese Gleichheit. Irgendwann bespiegeln wir uns nur noch selbst.
Questions: Dirk Frank