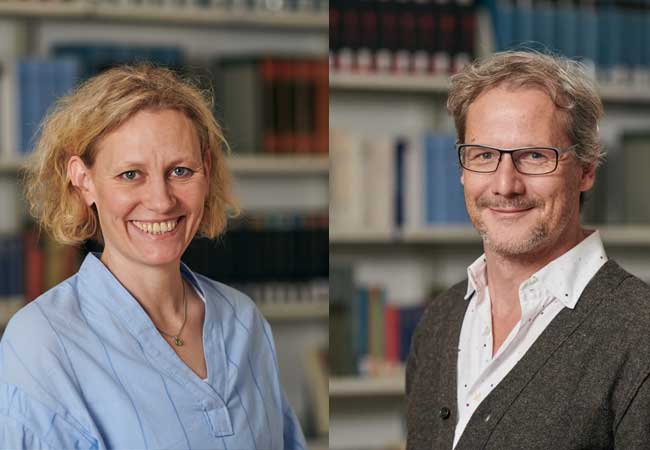Die Germanisten Prof. Susanne Komfort-Hein und Prof. Heinz Drügh zu den intensiven und auch paradoxen Momenten seiner Lesung
UniReport: Liebe Frau Komfort-Hein, lieber Herr Drügh, die Jubiläumsdozentur ist gerade zu Ende gegangen, woran werden sich Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern, wie fällt Ihr persönliches Resümee aus?
Prof. Heinz Drügh: Christoph Ransmayr selbst hat ein schönes Bild dafür benutzt, was mitunter von solch öffentlichen Vorträgen hängenbleibt. Oft sind das keine ganzen Gedankengänge, sondern manchmal nur ein Bild, ein Satz, der irgendwie insistiert, den man nicht vergisst, über den man immer wieder nachdenkt. Ransmayrs Vorlesung war voller solcher Bilder. Wie das des indischen Großmoguls Akbar in der Stadt Fatehpur, der, in der Krone eines Baums aus rotem Sandstein liegend, ohne selbst zu sprechen alle möglichen Ansichten von Gelehrten, Philosophen, Dichtern oder Religionsstiftern angehört habe mit der Devise: „Jedem zuhören, keinem glauben.“ Persönlich war die Begegnung mit Christoph Ransmayr ausgesprochen anrührend; in den späten 1980 ern war ich ein regelrechter Fan des Romans „Die letzte Welt“, hatte ihn dann irgendwann ein bisschen aus den Augen verloren. Es war sehr schön, sich jetzt aus diesem Anlass wieder intensiver mit Ransmayrs Arbeiten zu beschäftigen. Das ist ja überhaupt ein wunderbarer Effekt einer solchen Veranstaltung. Und nicht vergessen werden wir natürlich: dass die Tage mit Christoph Ransmayr unmittelbar vor dem Corona-Lockdown stattfanden. Er hat ja auch eindringlich darauf hingewiesen, in Corona-Zeiten nicht jene zu vergessen, die in erbärmlicher Weise in Flüchtlingslagern vor den geschlossenen Toren Europas ihr Dasein fristen.
Prof. Susanne Komfort-Hein: Da kommt bei Ransmayr auch die Frage nach der kritischen Intervention der Literatur ins Spiel. Aus der abgründigen Erkenntnis, dass es „nur ein Schritt war aus dem reinen Kunsthimmel zur Anbiederung mit der Barbarei“, bezog Ingeborg Bachmann in der ersten Frankfurter Poetikvorlesung vor 60 Jahren ihre Forderung nach einer moralischen Verantwortung der Literatur nach Auschwitz. Das bedeutete für sie Arbeit an der beschädigten Sprache, ein unermüdliches Unterwegssein im Auftrag dessen, für das die Zeit noch nicht gekommen ist; – auch in Ransmayrs literarischem Kosmos werden als intervenierende Kraft der Literatur ein unermüdliches Unterwegssein, Grenzüberschreitung und Verwandlung gegen einen auf Dauer ausgerichteten totalitären Machtanspruch und im Dienst der Erinnerung an eine noch unabgegoltene Vergangenheit aufgeboten. So wird gerade dem nicht alle Zeiten Überdauernden das Vermögen zu nachhaltiger Widerständigkeit zugetraut, das in seiner Wahlverwandtschaft mit dem Nomadischen der Sicherheit eines unumstößlichen Standpunkts entbehrt, stets neuer Aushandlungen bedarf und sich ins Offene vielfältiger Begegnungen mit dem Unbekannten entlässt. Das Erzählen zeigt sich bei Ransmayr in seiner ganzen sozialen Energie, – als ein Weitererzählen, ein Überliefern und Übersetzen, als ein vielstimmiger Resonanzraum. Es verbindet Erfahrung, Erfindung, Erinnerung und das Spiel mit der Form sowie der aneignenden Aktualisierung. Intensive Arbeit an der poetischen Sprache scheint in der raffinierten ästhetischen Verdichtung seiner Texte auf. Das verlangt auch von uns Leser*innen die mitspielende Lektüre, lässt uns nicht unberührt.
Christoph Ransmayr hat sich in seinem Vortrag »Unterwegs nach Babylon« unter anderem sehr kritisch zum sogenannten »Sekundären« des Literaturbetriebes geäußert, dem er die reine und unvermittelte Lektüre des Lesers entgegensetzt. Wie sehen Sie als Literaturwissenschaftler diese Kritik, wie ist diese einzuordnen?
Drügh: „Jedem zuhören, keinem glauben“, oder? Wir bleiben da ziemlich entspannt. Denn es ist immer gut, sich als Literaturwissenschaftler daran erinnern zu lassen, dass die Beschäftigung mit Literatur, der akademisch nachzugehen ein gehöriges Privileg ist, sich nicht nur im universitären Diskurs mit seiner Wissenschaftssprache aufhalten kann. Eine solche Wissenschaftssprache ist allerdings etwas, das sich in der modernen Ausdifferenzierung der Gesellschaften notwendig ergibt – in den Literaturwissenschaften nicht anders als in anderen Fächern. Allerdings sind wir als Universitätsleute verpflichtet, unsere Überlegungen in ganz unterschiedlichen Registern zu formulieren: mit Fachkolleg*innen anders als mit Studienanfänger*innen; mit Doktorand* innen anders mit einer literaturinteressierten Öffentlichkeit – das Gespräch mit letzterer ist übrigens einer der besonders schönen Aspekte der Poetikvorlesung. Unvermittelte Lektüre allerdings, da bin ich mir nicht sicher, ob dieser Mythos – und das ist ein Mythos – nicht sogar einem solchen Gespräch im Weg steht. Man kann immer fragen, was die lesende Person spezifisch in einen Lektüreprozess einbringt, und danach zu fragen und darüber zu streiten, ist aus meiner Sicht sogar essenziell für jede Ästhetik. Allerdings: Vermeintlich verschwurbelte Titel akademischer Abschlussarbeiten in der Vorlesung zum Verlachen und wohlfeilen Kopfschütteln auszustellen, wie das Ransmayr an einer Stelle gemacht hat, ist nicht mein Fall.
Komfort-Hein: Das sehe ich auch so. Ransmayrs Positionierung ist aber kein Einzelfall: Gehört eine verteidigte Eigenlogik der Literatur zum signifikanten Einsatz von Poetikvorlesungen, so auch ein bisweilen ausgeprägt programmatischer Anti-Akademismus. Autonomieästhetisches Gatekeeping wie der Mythos unvermittelter Lektüre begeben sich in eine gleich doppelte Frontstellung gegen die Zumutungen durch das vermeintlich „Sekundäre“ der literaturwissenschaftlichen Zurichtung und der Spielregeln des Literaturbetriebs. Gibt die Poetikdozentur nicht selten die Bühne für die Inszenierung von Konkurrenz zwischen Literatur und Literaturwissenschaft, so lässt sich aber daneben auch eine Komplizenschaft entdecken, die sich u. a. als Einfluss von philologischen Lektürepraktiken und Beobachtungsroutinen auf das Genre der Poetikvorlesung zeigt.
Ransmayr hat in seinem Vortrag ebenso den Wert poetologischer Überlegungen relativiert; jede Zeile gelesener Literatur sei bedeutender als das, was ein Schriftsteller über Literatur zu sagen habe. Ist es nicht paradox, das in einer Poetikdozentur zu verkünden?
Drügh: Das ist zunächst einmal ein Topos, der zur captatio benevolentiae fast jeder Poetikvorlesung gehört. Schon Ingeborg Bachmann hat in der allerersten Frankfurter Poetikvorlesung so aufgemacht. Aber ist das nicht neben dem Rhetorischen auch irgendwie normal, dass ein Künstler so etwas sagt? Sein oder ihr Medium ist eben die Kunst, und nicht deren Analyse oder hermeneutische Durchdringung. Dieser Registerwechsel, den die Poetikvorlesung verlangt, verlangt den Künstler*innen einiges ab, und sie finden zum Austrag dieser Schwierigkeit ganz verschiedene Formen. Das wahrzunehmen ist nicht der geringste Reiz der Poetikvorlesung. Nicht im zirzensischen Sinn, sondern intellektuell (na ja, vielleicht doch auch ein bisschen zirzensisch, wie bei jedem Vortrag übrigens; jetzt, wo wir podcasthörend im Corona-Lockdown sind, ist man ja geneigt, das zuzugeben).
Komfort-Hein: Die paradox anmutende Zurückweisung und gleichzeitige Erfüllung der Form ist auch in dem komplexen Spannungsfeld zwischen Literatur, Literaturwissenschaft und Literaturbetrieb begründet, in dem sich heute Autor*innen bewegen und das auch die Institution Poetikdozentur prägt: zwischen akademischer Vorlesung und künstlerischer Performance unter den hochkompetitiven ökonomischen Vorzeichen der Profilierung im Betrieb.
Begleitet wurde die Poetikvorlesung im Vorfeld von drei literaturwissenschaftlichen Vorträgen, die sehr gut besucht waren. Könnte das auch für kommende Dozenturen ein attraktives Format sein?
Komfort-Hein: Als institutioneller Ort und Medium ästhetischer Reflexion wie auch als Forschungsgegenstand leistet die Poetikdozentur einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Status, zu Form und Theorie von (Gegenwarts-) Literatur. Dieses Potenzial wollen wir noch weiter stärken, indem wir die jeweilige Poetikvorlesung als kompakte wissenschaftliche Veranstaltung konzipieren, die auch eine literarisch interessierte Öffentlichkeit zum Gespräch einlädt. Das kann wieder eine literaturwissenschaftliche Vortragsreihe sein. Ebenso ist auch an Workshops mit den Autorinnen oder studentische Forschungsprojekte gedacht. Mit großer Resonanz haben Heinz Drügh und ich das Format der begleitenden Konferenz zu Christian Krachts Poetikvorlesung im Mai 2018 erprobt. Zu Monika Rincks Poetikvorlesung wird es ebenfalls eine Konferenz (zur Gegenwartslyrik) geben, die unser Kollege Nathan Taylor organisiert.
Im kommenden Sommersemester wird Monika Rinck die Poetikdozentur übernehmen. Worauf dürfen sich die zahlreichen Freundinnen und Freunde der Frankfurter Poetikvorlesungen freuen?
Komfort-Hein: Mit Monika Rinck werden wir eine der herausragenden avantgardistischen Stimmen zeitgenössischer Lyrik mit der Vorlesung „Vorhersagen. Poesie und Prognose“ bei uns zu Gast haben. Das Publikum darf sich also auf eine Begegnung mit ihrer experimentellen lyrischen Formensprache, mit vielfältigen Grenzgängen und Dialogen zwischen Genres, Medien und Künsten, zwischen Theorie und Poesie freuen.
Die Fragen stellte Dirk Frank
Wegen der Corona-Pandemie kann Monika Rincks Poetikvorlesung im Sommersemester leider nicht wie geplant stattfinden.
Wir freuen uns dennoch, dass wir einen Ausweichtermin vereinbaren konnten. Unsere Gastdozentin wird an drei Dienstagabenden (17. und 24. November sowie am 1. Dezember 2020) ihre Poetikvorlesungen im Hörsaalzentrum am Campus Westend halten.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 2.20 des UniReport erschienen.