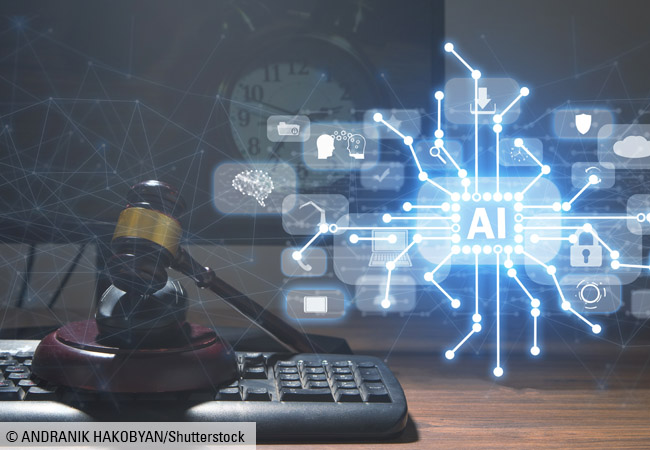Frankfurter Tag der Rechtspolitik befasste sich mit rechtlichen Fragen der Familienplanung.
Zwei Mütter, zwei Väter, „junge“ Eltern im Pensionsalter – was ist „normal“ in Sachen Familiengründung? Der Fortschritt in der Reproduktionsmedizin lässt neben dem hergebrachten Familienmodell viele andere denkbar erscheinen. Doch was ist erlaubt und – auch im Sinne der Kinder – erwünscht? Neben ethisch-moralischen Fragen wirft die neue Machbarkeitsmedizin auch zahlreiche juristische Fragen auf.
Um diese ging es beim Tag der Rechtspolitik 2017 an der Goethe-Universität. Ein brisantes Thema stand im Mittelpunkt des Tages: „Väter, Mütter, Kind: Reproduktionsmedizin und Recht“ lautete diesmal der Titel der Veranstaltung, die alljährlich vom Fachbereich Rechtswissenschaft gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz angeboten wird.
Das Problem sei nicht neu, sondern „so alt wie die Menschheit“, wie Dekan Prof. Albrecht Cordes in seiner Begrüßung deutlich machte: Schon in der Vergangenheit habe es zum Beispiel immer wieder Diskussionen um die Vaterschaft gegeben – auch wenn diese ohne medizinische Hilfe zustande gekommen war. Und schon immer war ein unerfüllter Kinderwunsch eine große Belastung.
Die moderne Reproduktionsmedizin ist für viele Paare Anlass zur Hoffnung. Was medizinisch machbar ist, ist bislang in Deutschland allerdings nicht immer erlaubt: Legal sind lediglich Samenspenden, die Spende von Eizellen und die Leihmutterschaft sind verboten. Damit herrscht hierzulande ein restriktiverer Umgang mit der Thematik als in manch anderem europäischen Land.
Der Embryonenschutz hat einen hohen Stellenwert – was nicht nur bei Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch zu Unzufriedenheit führt, sondern auch bei Forschern, denen hinsichtlich mancher Projekte die Hände gebunden sind.
Gibt es ein Recht auf Fortpflanzung?
Das Recht zur Nichtfortpflanzung durch den Zugang zu Verhütungsmitteln und durch die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs wurde vor allem von Frauen im 20. Jahrhundert hart erkämpft. Und auch die Tatsache, dass das Persönlichkeitsrecht sich auch auf die geschlechtliche Identität und die individuelle Sexualität bezieht, kann als Errungenschaft angesehen werden. Doch gibt es auch ein Recht auf Fortpflanzung?
Diese Frage stellte die Frankfurter Verfassungsrechtlerin Ute Sacksofsky ins Zentrum ihres Vortrags und legte dar, dass die Freiheit derer, die sich die Elternschaft wünschen, an rechtliche Grenzen stößt. Es sei zweifelhaft, ob das Grundgesetz alle Handlungen schützt, die auf die „Kreation einer anderen Person“ abzielen. Einschränkungen stellen zum Beispiel die Schutzrechte der Frau dar, aber auch die Würde des Kindes, das unter Umständen zum „Produkt“ wird.
Sacksofsky sprach von der Notwendigkeit eines Fortpflanzungsgesetzes anstelle des Embryonenschutzgesetzes. Das Diskriminierungsverbot wiederum legt nahe, dass alle Menschen Zugang zu reproduktionsmedizinischen Maßnahmen erhalten. Die strenge Regelung in Deutschland jedoch sieht Ute Sacksofsky durchaus als berechtigt an. Ihre Kollegin Prof. Marina Wellenhofer, die an der Goethe-Universität unter anderem Familienrecht lehrt, wandte sich dem Problem der rechtlichen Elternschaft zu.
Vater im rechtlichen Sinne ist zunächst der Ehemann oder der „Wunschvater“, der die Vaterschaft anerkannt hat; ansonsten gilt das Kind bei einer anonymen Samenspende als vaterlos. Lange diskutiert war in Zusammenhang mit Samenspenden das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung. Zu Beginn dieses Jahres hat der Gesetzgeber geregelt, dass Kinder, die auf dem Wege der Samenspende gezeugt worden sind, erfahren können müssen, wer ihr genetischer Vater ist. Hierfür wurde ein zentrales Spenderregister eingerichtet.
Zugleich wurde festgelegt, dass zwischen Kind und genetischem Vater keine erb- oder unterhaltsrechtliche Beziehung besteht. Aus der Praxis berichtete Dr. Renata von Pückler, Richterin am Oberlandesgericht Frankfurt, die derzeit am Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz tätig ist. Sie führte dem Auditorium vor Augen, welche sozialen Härten aus dem Verbot der Leihmutterschaft entstehen können:
Ein italienisches Paar hatte ein Kind von einer Leihmutter in Russland austragen lassen, doch die italienischen Behörden sprachen ihnen die Elternschaft ab. So kam das sechs Monate alte Baby zunächst für viele Monate in ein Kinderheim, bevor es an eine Pflegefamilie vermittelt werden konnte. Eine mehrfache Traumatisierung für das Kind wurde in Kauf genommen, um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden und eine präventive Wirkung zu erzielen. Von Pückler bezeichnete es als ein „grundlegendes Dilemma“, dass „präventive Erwägungen auf dem ‚Rücken‘ eines einzelnen individuellen Schicksals ausgetragen“ würden.
»Fortpflanzungstourismus«
Soll man vor diesem Hintergrund den „Fortpflanzungstourismus“ und damit die rechtlichen Schwierigkeiten bei der Anerkennung der Elternschaft beenden, indem man die Gesetze liberalisiert? Was würde das für den Schutz der Menschenwürde der Leihmütter bedeuten? Und wie ist es für ein Kind, von einer Frau ausgetragen zu werden, die weder seine leibliche noch seine rechtliche Mutter ist?
In der Podiumsdiskussion, an der außer den Referenten auch der Theologe Prof. Lukas Ohly und Anne Meier-Credner vom Verein Spenderkinder teilnahmen, wurde deutlich, dass in die rechtswissenschaftliche Debatte auch ethische und psychologische Aspekte einfließen sollten. Prof. Felix Maultzsch hatte schon zuvor die Kommerzialisierung des weiblichen Körpers als „das eigentliche Problem in der Debatte um Leihmutterschaft“ bezeichnet.
Ein ehemaliger Familienrichter wies darauf hin, dass lesbische Paare es ungleich schwerer haben, gemeinsam als Eltern anerkannt zu werden. Prof. Cornelius Prittwitz forderte zum Nachdenken darüber auf, ob rechtlich nicht mehr als zwei Elternteile denkbar wären. Ein Zuhörer berichtete von eigenen Erfahrungen: Er habe vier Kinder von Leihmüttern im Ausland austragen lassen, habe aber bei deutschen Behörden zum Teil lange Zeit um die Anerkennung seiner Vaterschaft kämpfen müssen.
Freiwillige Leihmutterschaft solle erlaubt werden, das gehöre auch zum Selbstbestimmungsrecht der Frau. Das Verbot fuße in einem überkommenen Familienbild. Ute Sacksofsky widersprach: Es sei die Entscheidung des Gesetzgebers, ob er eine Kommerzialisierung zulassen wolle. Dahinter stehe kein bestimmtes Familienbild.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.18 (PDF-Download) des UniReport erschienen.