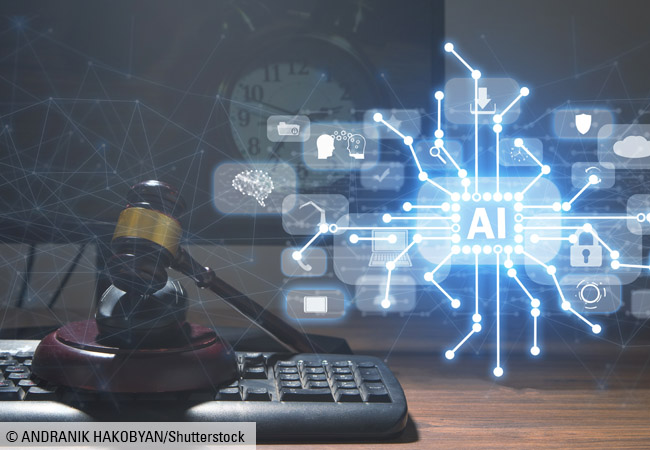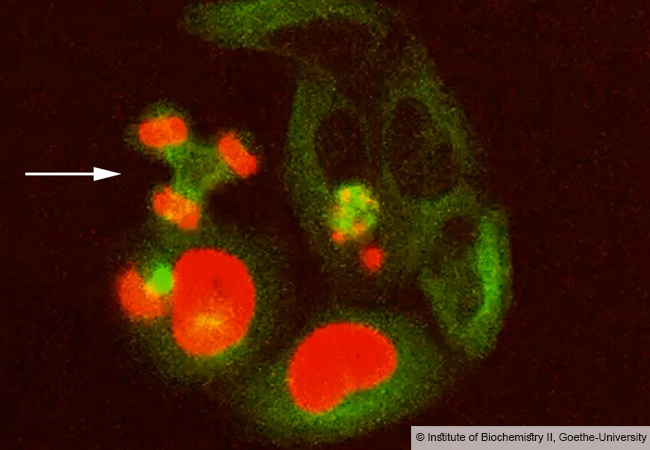Helmut Siekmann, Professor für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht, erklärt, warum die gegenwärtige Politik der Europäischen Zentralbank rechtlich und ökonomisch fragwürdig ist und warum Inflation ein so großes Problem ist.
Helmut Siekmann, Professor für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht, erklärt, warum die gegenwärtige Politik der Europäischen Zentralbank rechtlich und ökonomisch fragwürdig ist und warum Inflation ein so großes Problem ist.
Die Europäische Zentralbank (EZB) spielt immer noch die wesentliche Rolle im Kampf gegen die Folgen der europäischen Staatsschuldenkrise. Um die Wirtschaft anzukurbeln, versorgt sie die Märkte aktuell mit einer Geldflut, indem sie in großem Stil Staats- und Unternehmensanleihen kauft. Ist diese Maßnahme, das sogenannte „Quantitative Easing“ (QE), legal?
Grundsätzlich darf die EZB entsprechend ihrer Satzung Anleihen am Markt kaufen. Dieses Recht ist allerdings beschränkt auf Zwecke, die in ihrer Zuständigkeit liegen: der Geldpolitik. Die Erlaubnis für ein Instrument bedeutet nicht, dass man es für jeden Zweck verwenden darf. Wenn die EZB mit QE also das Ziel verfolgt, strukturelle Probleme in einigen Euro-Mitgliedstaaten zu lösen, dann ist das nach meiner Ansicht allgemeine Wirtschaftspolitik, die definitiv in den Bereich der Mitgliedstaaten fällt und nicht der EZB.
Würde es das Problem lösen, wenn man das Mandat der EZB auf wirtschaftspolitische Ziele erweitert, ähnlich wie in den USA?
Natürlich lassen die sich die Kompetenzen der EZB erweitern. Dazu ist allerdings ein sehr komplexer Prozess nötig, der etwa Referenden in mehreren Mitgliedsstaaten umfasst. Darüber hinaus könnten dadurch neue rechtliche Probleme entstehen. Zum Beispiel könnte eine solche Änderung in Konflikt mit dem Demokratieprinzip in Artikel 79,3 Grundgesetz treten, da sie einer Institution, die nicht unter demokratischer Kontrolle steht, sehr viel Macht einräumt.
Abgesehen von diesen rechtlichen Hürden würde ein solcher Schritt aber auch nicht das eigentliche Problem lösen. Eine Zentralbank kann mit ihren Instrumenten keine strukturellen Probleme lösen, sondern nur Zeit kaufen. Wenn die Nullzinsgrenze erreicht ist und die Mitgliedstaaten keine Strukturreformen durchgeführt haben, ist nichts gewonnen. Im Gegenzug sind mit QE jedoch eine ganze Menge Risiken verbunden. Es führt zu einem langfristigen Sinken der Zinssätze, was die Finanzmärkte komplett verzerrt. Es entsteht die Gefahr, dass Investitionen in riskante oder ineffektive Geschäfte fließen, die keinen tatsächlichen Ertrag versprechen. Nicht zuletzt sinkt der Druck auf die Regierungen, ihre Haushalte zu konsolidieren und eine solide Finanzpolitik zu machen – mit dramatischen Konsequenzen: Wenn die Zinsen plötzlich wieder steigen, wären manche Einheiten sofort pleite. Deutschland könnte plötzlich mit einem Haushaltsdefizit von bis zu 40 Milliarden Euro konfrontiert sein, von Italien oder Frankreich, die viel höhere Schulden haben, ganz zu schweigen. Das Grundproblem ist, dass die Zinsen ihre Funktion verlieren, Kapital der nützlichsten Verwendung zuzuführen.
Im Übrigen darf auch die amerikanische Notenbank Fed keine Wirtschaftspolitik im umfassenden Sinn durchführen, auch wenn ihre Kompetenzen weiter gefasst sind als die der EZB. Es ist eine offene Frage, ob die Fed Strukturpolitik machen dürfte. In jedem Fall ist es ihr untersagt, wirtschaftliche Maßnahmen nur für einzelne Staaten durchzuführen – so wie es die EZB mit ihrem OMT-Programm vorgesehen hatte. QE ist demgegenüber weniger problematisch, da es nicht einzelne Staaten oder deren Banken bevorzugt. Dennoch kann man es als indirekte Staatsfinanzierung betrachten.
Man hört immer wieder das Argument, dass die EZB gar keine andere Wahl hat, weil die Mitgliedstaaten einfach ihre Haushalte nicht konsolidieren (“Fiscal Dominance”).
Aus juristischer Sicht ist es ein fragwürdiges Argument, dass die EZB ihre Kompetenzen überschreiten muss, weil andere ihre Pflicht nicht erfüllen. Aus ökonomischer Sicht hat es allerdings eine gewisse Berechtigung. Zu Beginn der Krise hat Jean-Claude Trichet, der damalige EZB-Präsident, immer betont, dass er die unkonventionellen Maßnahmen nur für eine kurze Zeit durchführen wird, um den Mitgliedstaaten Zeit zum Handeln zu verschaffen. Damals war keine andere Institution in der Eurozone in der Lage, schnell genug zu handeln. Aber heute, sechs Jahre später, wird dieses Argument immer schwächer.
Aber hat die EZB nicht ein Mandat, die Deflation zu bekämpfen?
Die EZB argumentiert oft mit einem Inflationsziel von etwas unter zwei Prozent. Das ist jedoch eine selbstgesteckte Zielmarke. Der Begriff “Inflationsziel” findet sich weder in ihrer Satzung noch irgendwo anders im EU-Primärrecht. Das Ziel, das in der Satzung formuliert ist, ist Preisstabilität, und das bedeutet null Prozent Inflation plus eventuell einen gewissen Spielraum, um Messfehler zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht bestimmt eher der Wunsch nach einer gewissen Inflation diese Politik als der Kampf gegen Deflation. Inflation schadet allen, die Geldforderungen haben, während Schuldner davon profitieren. Damit führt jede Art von Inflation zu Verteilungseffekten zwischen Mitgliedstaaten und, innerhalb von Staaten, zwischen bestimmten Teilen der Bevölkerung. Die meisten Deutschen haben Sparbücher und andere Formen von Ersparnissen, während Menschen in anderen europäischen Ländern mehr in Immobilien investieren, die üblicherweise über Kredite finanziert sind. Die größten Schuldner sind aber die Staaten. Aus meiner Sicht ist das der Grund, warum ein gewisses Maß an Inflation inzwischen ein akzeptiertes Politikziel ist. Aber die Umverteilung von Vermögen ist nicht Aufgabe einer Zentralbank.
Haben die nationalen Zentralbanken in Europa, etwa mit Blick auf die Notfall-Liquiditätshilfe ELA (“Emergency Liquidity Assistance”), zu viel Macht?
Es ist rechtlich im höchsten Maße fragwürdig, dass nationale Zentralbanken das Recht haben, ihren Banken ELA zu gewähren. In der Satzung der EZB und des ESZB, des europäischen Systems der Zentralbanken, lässt sich das nur auf eine sehr unklare Vorschrift, Artikel 14,4, stützen, die besagt, dass nationale Zentralbanken Funktionen auf eigene Verantwortung und Haftung durchführen dürfen, solange dies nicht die Ziele und Aufgaben des ESZB stört. Nach meiner Interpretation erlaubt diese Vorschrift nur Maßnahmen, die nicht als Geldpolitik gelten können, wie zum Beispiel Bankenaufsicht. ELA kommt jedoch üblicherweise ins Spiel, wenn die EZB weitere Kredite an eine Bank oder ein Bankensystem eines Mitgliedstaates ablehnen muss. Wenn man das Beispiel Griechenland nimmt: Solange die Staatsanleihen, die die griechischen Banken halten, als wertig angesehen wurden, konnten die Banken diese als Sicherheiten verwenden, um von der EZB Liquidität zu erhalten. Als die EZB die Anleihen dann nicht mehr akzeptierte, kamen die nationalen Zentralbanken und gewährten ELA. Wenn die Bereitstellung von Liquidität durch die EZB Geldpolitik ist, was ist dann ELA? Doch die EZB hat einen Prozess aufgestellt, wonach sie ELA akzeptiert, solange es nur für eine begrenzte Zeit gewährt wird und innerhalb eines zuvor festgesetzten Rahmens bleibt. Aus rechtlicher Sicht ist das eine sehr merkwürdige Konstruktion ohne jede solide Grundlage.
Ist diese Machtbalance zwischen dem Zentrum und den Zweigstellen in den USA besser organisiert?
Der wichtigste Unterschied zwischen dem europäischen und dem US System ist, dass die regionalen Zweigstellen der Fed in wirtschaftlichen und nicht in politischen Grenzen agieren. Der Grund ist, dass sie lokalen Geschäftsbanken gehören und somit eher private als öffentliche Institutionen sind. Sie verstehen sich somit nicht als Vertreter irgendeines Bundesstaates. In Europa haben wir stets die Gefahr, dass nationale Politiker ihre Zentralbanken unter Druck setzen, politische Bedürfnisse ihres Heimatstaates in ihren Entscheidungen im EZB Rat zu berücksichtigen. Auch wenn es sich nicht belegen lässt, gibt es doch einige Hinweise, dass nationale Befangenheiten eine Rolle bei den Entscheidungen des EZB Rats spielen.
Der Text ist eine Übersetzung eines Interviews aus dem SAFE Newsletter Q1 2016.
Autorin: Muriel Büsser