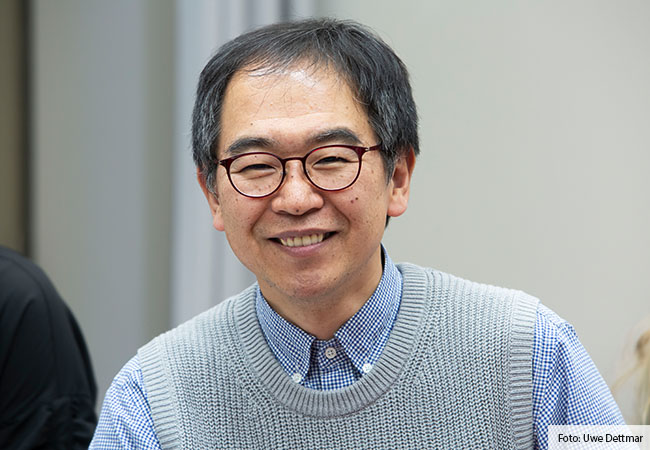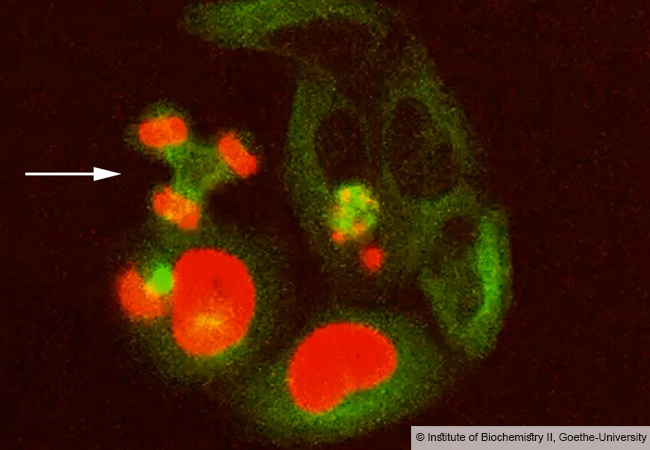Politikwissenschaftler Markus Siewert spricht im Interview über die Konsequenzen aus den Midterm Elections, die gesellschaftliche Polarisierung und die Nach-Trump-Ära.
Politikwissenschaftler Markus Siewert spricht im Interview über die Konsequenzen aus den Midterm Elections, die gesellschaftliche Polarisierung und die Nach-Trump-Ära.
Der Frankfurter Politikwissenschaftler Dr. Markus Siewert wurde mit einer Arbeit zur Rolle des amerikanischen Präsidenten im Gesetzgebungsprozess unter Clinton, Bush und Obama promoviert. Goethe Uni online sprach mit ihm über den Ausgang der Midterm Elections in den USA.
Nach Wahlen gibt es meist nur Sieger – so auch bei den Midterm Elections. Doch wer hat aus Ihrer Sicht wirklich gewonnen: Donald Trump oder Nancy Pelosi?
Man kann tatsächlich sagen, dass beide Sieger sind. Die Demokraten hatten im Repräsentantenhaus eine lange Dürrezeit ohne Mehrheit – mit Ausnahme von zwei Jahren unter Obama. Von daher ist die Wahl auf alle Fälle ein Erfolg für die Demokraten und Nancy Pelosi. Vor allem, wenn man sieht, welche Hürden die Demokraten überwinden mussten. Wir haben viel über „voter suppression“ lesen können, d.h. Versuche, Wählgruppen systematisch zu demotivieren bzw. die Stimmabgabe zu erschweren. Dabei handelt es sich besonders um solche Gruppen, die eher demokratisch wählen. Hinzu kommt noch ein für die Republikaner vorteilhafter Zuschnitt der Wahlkreise. Dass die Demokraten trotzdem so gut abgeschnitten haben, ist bemerkenswert. Nichtsdestotrotz hat auch Trump Recht, wenn er sich als Sieger bezeichnet: die Republikaner haben die Mehrheit im Senat behalten. Und man muss auch sagen, es gibt zwar eine mehrheitliche Unzufriedenheit mit der Trumpschen Politik, aber sie ist nicht so deutlich, wie wir das vielleicht aus der Ferne wahrnehmen wollen.[dt_gap height=“10″ /]
Beiderseits kaum Kompromissbereitschaft
[dt_gap height=“10″ /]Trump hat gesagt, er werde auf die Demokraten zugehen. Halten Sie das für realistisch?
Bereits 2016 gab es unterschiedliche Szenarien, wie Trump regieren könnte: mit den Republikanern republikanische Politik machen oder stärker als Vermittler auftreten und die Dinge umsetzen, die er für richtig hält. Rückblickend war die Kompromissbereitschaft mit den Demokraten doch sehr gering, so dass meiner Ansicht nach wenig Hoffnung darauf besteht, dass Trump in den nächsten zwei Jahren mit den Demokraten zusammenarbeiten wird. Andererseits wiederum könnte auch Trump Purzelbäume schlagen, die Demokraten würden ihn nicht unterstützen. Obama ging es umgekehrt ja genauso.
In Ihrer Doktorarbeit haben Sie sich mit dem amerikanischen Gesetzgebungsprozess befasst. Welche Rolle spielen die amerikanischen Präsidenten?
Institutionelle Faktoren sind schon sehr, sehr entscheidend. Das heißt: Bei der Gesetzgebung spielen die Mehrheitsverhältnisse im Kongress eine zentrale Rolle.
Dann müsste Trump in den vergangenen zwei Jahren ja mit der republikanischen Mehrheit durchregiert haben.
Nein. Wir beobachten vielmehr, dass der Gesetzgebungsprozess nahezu komplett zum Stillstand gekommen ist. Es ist schon überraschend, wie wenig legislativ beschlossen wurde. Die meisten Veränderungen wurden administrativ umgesetzt.
Das heißt, es gab keine großen Gesetzesänderungen?
Im Grunde fallen mir nur die Steuererleichterungen ein. So neu ist das aber nicht: Schon unter früheren Präsidenten – auch Obama – ging es mit der gesetzgeberischen Tätigkeit abwärts. Das liegt einerseits an der Polarisierung innerhalb des Kongress, andererseits aber auch am Zusammenspiel von Präsident und Kongress. Das entstehende Vakuum wird dann vom Präsidenten durch andere Instrumente ausgefüllt, etwa durch bürokratische Maßnahmen. Dass diese Situation für eine Demokratie suboptimal ist, liegt auf der Hand.
Aber Trump hätte ja die Mehrheit gehabt, um Gesetze zu realisieren.
Präsident Trump hat gar nicht großartig versucht, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten. Das Verhältnis war ja von Anfang an angespannt, weil er ein Außenseiter innerhalb der Republikanischen Partei war und die Partei quasi von außen eingenommen hat. Überrascht hat es dennoch, dass er nicht stärker mit den „eigenen“ Mehrheiten regiert hat, sondern von Anfang an einen sehr klaren Stil verfolgte: „Das mach ich selber“ – was ja auch seinem Ideal von politischer Führung entspricht.[dt_gap height=“10″ /]
Verlust der Mehrheit positiv für Trump?
[dt_gap height=“10″ /]Insofern stellen die neuen Verhältnisse keine große Hürde für Trump dar – im Gegenteil vielleicht. Wird er es darauf anlegen, dass die Demokraten in zwei Jahren als Blockierer dastehen?
Die Situation hat sich für ihn tatsächlich auch zum Positiven geändert: Er kann auf Konfrontation schalten und hat in Nancy Pelosi einen klaren Gegenpart, eine Kontrastfolie – so sie denn als Sprecherin des Repräsentantenhauses gewählt wird. Natürlich wird er 2020 sagen: Ich wollte ja, aber die Demokraten wollten nicht.
Inwiefern hat sich Präsident Trump mit seinem einseitigen Vorgehen über bestehende Regeln hinweggesetzt?
Einseitiges Handeln zählt mittlerweile zum Standardrepertoire US-amerikanischer Präsidenten. Ursprünglich aus der Not geboren, suchen die Präsidenten Wege, die Handlungsunfähigkeit im Kongress zu umgehen. Das Land muss ja regiert werden, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Bereits Reagan und Clinton haben diese einseitigen Instrumente eingesetzt. Das ist dann unter George W. Bush durch die Decke geschossen und hat sich auch unter Obama fortgesetzt. Obama hatte zwar im Wahlkampf versprochen, das nicht mehr zu machen, dann aber doch immer stärker unilateral gehandelt, wobei man bei ihm vielleicht anfangs noch einen guten Willen erkennen konnte.
Haben die Regelungen, die nicht über Gesetze eingeführt werden, überhaupt auf Dauer Bestand?
Ja, sie haben zunächst einmal die gleiche Gültigkeit wie Gesetze. Der Präsident kann allerdings nur an bestehende Gesetze andocken und natürlich kann ein präsidentieller Erlass mit einem einfachen Gesetz oder durch die Gerichte gekippt werden. Wenn der Kongress also sagt: Diesen Erlass unterstützen wir nicht, zum Beispiel den sogenannten Muslim-Ban, dann könnte er jederzeit ein anderes Gesetz verabschieden. Natürlich kommt hier die Blockade im Kongress dem Präsidenten wiederum zu Gute und weitet seinen Handlungsbereich aus.[dt_gap height=“10″ /]
„Der Vertrauensverlust ist enorm“
[dt_gap height=“10″ /]Es sind aber schon viele Fakten durch Präsident Trump geschaffen worden, die nicht so leicht rückgängig zu machen sind.
Klar, vieles, was Trump im Bereich Umweltschutz, Gesundheits- und Sozialpolitik umgesetzt hat, würde ein Demokratischer Präsident wieder rückgängig machen. Aber manches ist halt doch passiert: Es macht schon einen Unterschied, ob man vier Jahre Fracking in einem Naturschutzgebiet betreibt oder nicht. Und gerade auf außenpolitischer Bühne ist der Vertrauensverlust natürlich enorm. Hier sind schon erhebliche Zweifel angebracht, ob eine neue Person im Weißen Haus das nochmal kitten kann, selbst wenn sie ähnlich wie Obama einen Starstatus in Europa hätte. Andererseits schaffen es die USA doch alle vier bis acht Jahre, sich neu zu erfinden. Die Selbstheilungskräfte dieses Systems sind ungeheuerlich.
Trumps Auftreten hat ja vielleicht den positiven Effekt, dass die Europäer jetzt zusammenrücken.
Die Europäer scheinen sich schon klar darüber zu sein, dass sie sich stärker gemeinsam einbringen müssen, wenn sie weiterhin eine aktive Rolle in der Weltpolitik spielen wollen. Wobei ich hier immer gegen das Kurzzeitgedächtnis anrede: Dieselbe Diskussion gab es schon während der Bush-Präsidentschaft und in den 1980er Jahren mit dem Nato-Doppelbeschluss. Aber nun scheint es, als ob wir nicht einfach zum Status Quo ante zurückkehren können – allerdings ist Europa leider gerade sehr mit sich selbst beschäftigt.
Hierzulande beklagen wir, dass sich die Parteien immer ähnlicher werden. In den USA ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall: Die Kluft zwischen den beiden Lagern wird immer größer.
Dass die Polarisierung wächst, können wir bereits seit den 1960er Jahren beobachten: Es gibt eine immer klarere Aufteilung: liberale, progressive und städtische Wähler geben ihre Stimme den Demokraten, konservative und ländliche Teile der Bevölkerung wählen Republikaner. Diese Lücke zwischen den parteipolitischen Lagern wird tatsächlich jedes Jahr ein Stückchen größer.[dt_gap height=“10″ /]
„Immer weniger Möglichkeiten zum Konsens“
[dt_gap height=“10″ /]Auffällig ist, dass sich bei dieser Wahl besonders viele junge, linke Frauen bei den Demokraten haben aufstellen lassen.
Der Genderaspekt passt in diesen Trend. Nicht nur auf Kandidatenebene, sondern gerade auf der Ebene der Wähler dehnt sich der Konflikt aus. Heutzutage wählen Frauen eher blau und auch junge Menschen. Das führt aber auch dazu, dass die Gräben immer stärker zunehmen und es immer weniger Möglichkeiten gibt, bei gesellschaftlichen Fragen einen übergreifenden Konsens zu finden.
Statt zu Politikverdrossenheit zu führen, scheint dieser Zustand die Menschen in den USA aber eher zu mobilisieren.
Das stimmt. An der Wahlbeteiligung etwa zeigt sich das sehr deutlich. Aber auch in anderen Teilen der Zivilgesellschaft ist eine deutliche Mobilisierung festzustellen. Die Trump-Präsidentschaft polarisiert ungemein und führt zu einem stärkeren Engagement.
Die US-amerikanische Gesellschaft ist tief gespalten. Was müssen wir tun, damit unsere Gesellschaft nicht auf diese Weise auseinanderfällt?
Mit Blick auf Deutschland kann die USA schon ein Lehrbeispiel sein: Wollen wir Parteien, die sich ähnlich sind und damit eben auch kompromissfähiger, oder wollen wir eine stärkere Polarisierung und Abgrenzung, die dann aber auf Kosten von gesellschaftspolitischem Konsens gehen? Wollen wir eine Politik, die auf Problemlösung angelegt ist? Leider wird das, aus meiner Sicht, zu oft als langweilig wahrgenommen. Mit der AfD und früher mit der Linken oder den Grünen sind mehr Leben und mehr Polarisierung im Parlament. Wenn aber die Gemeinsamkeiten immer mehr in den Hintergrund treten, bekommt man eben eine Situation wie in den USA. Die derzeitigen massiven gesellschaftspolitischen Umbrüche, die jeden einzelnen von uns direkt betreffen oder auch subkutan spürbar sind, müssen stärker von der Politik angegangen werden. Bis dato hat die Politik aber noch keine Antworten auf die Bedürfnisse und Ängste gefunden, die die Menschen derzeit beschäftigen. Klar, Präsident Trump ist eine Antwort, aber vielleicht gelingt uns Europäern, eine zukunftsorientierte Alternative zu entwickeln.
Interview: Anke Sauter