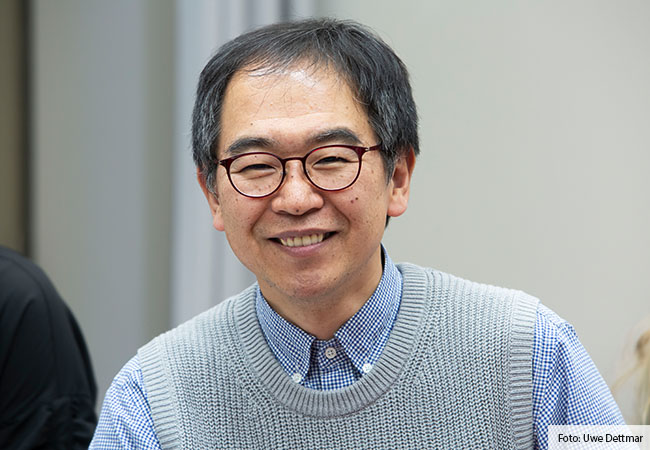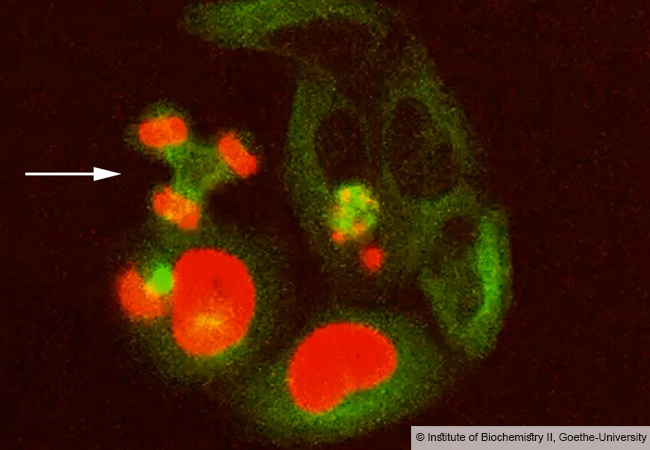Der Soziologe Christian Stegbauer erklärt in seinem neuen Buch die „12 Grundannahmen der Netzwerkforschung“. In welchen Strukturen Menschen agieren und welche neuen Beziehungen sich ergeben können oder auch verschlossen bleiben, lässt sich auch gut an Studierenden im ersten Semester untersuchen.

„Wollen wir uns auf Social Media vernetzen?“ Diese Frage fällt heutzutage oft im Laufe eines Gesprächs zwischen Leuten, die sich gerade kennengelernt haben. Reagiert die soziologische Netzwerkforschung auf die Konjunktur des Begriffs ‚Netzwerken‘? Die Netzwerkforschung, erläutert Prof. Christian Stegbauer, versucht prinzipiell Strukturen von Beziehungen zu erklären. Die Netzwerkforschung berücksichtigt in ihren Analysen die sozialen Kontexte in Form von Verflechtungen in Beziehungsmustern. Identität und damit auch Individualität entstehen erst, so die Grundannahme, durch Einfluss und Auseinandersetzung mit anderen Menschen; dabei beeinflusst der einzelne auch andere. „Wenn man heute sagt, dass Vernetzung wichtig sei, meint man den Begriff eher metaphorisch. Aber in der modernen Netzwerkforschung bzw. -analyse spielt das Metaphorische keine Rolle.“
Netzwerke und ihre Erforschung sind zuerst einmal als ein Phänomen der Moderne zu begreifen. Soziologen wie Ferdinand Tönnies oder Georg Simmel gingen davon aus, dass die Gemeinschaft sich in Richtung Gesellschaft entwickelt. Während man es in der Vormoderne noch tendenziell immer mit denselben Menschen zu tun hatte, fächerten sich in der modernen Gesellschaft die sozialen Kreise immer weiter auf. Während in einer multiplexen Gesellschaft der Vormoderne verschiedene Arten von Beziehungen mit denselben Menschen geteilt wurden, verkehrt der Mensch in der uniplexen Moderne in unterschiedlichen sozialen Kreisen, damit werden die Beziehungen in verschiedene Funktionalitäten aufgespalten.
Die Netzwerkforschung ist eine vergleichsweise junge Disziplin innerhalb der Soziologie, deren Methodologie erst in den 70er Jahren entwickelt wurde. Zwar hat sich die Soziologie immer schon mit Beziehungen beschäftigt, man hat dabei aber nicht genau genug auf die Strukturen geschaut, kritisiert Christian Stegbauer, selbst dann nicht, wenn es um die Erforschung von Gruppen geht. Stegbauer sieht in den klassischen Methoden der Soziologie auch große Defizite; so z. B., wenn es um quantitative Befragungen geht. Der einzelne Mensch wird isoliert nach einer Meinung gefragt, der soziale Einfluss im Interview soll möglichst vermieden werden. Dabei könnte die Antwort je nach Kontext aber anders ausfallen. Stegbauer nennt hier als Beispiel eine Studie aus den 1930er Jahren zu rassistischen Haltungen in den USA: Während viele US-Amerikaner in Hotels und anderen Unterkünften bei einer Befragung angaben, Chinesen kein Quartier anzubieten, zeigte eine ergänzende Recherche, dass in der realen sozialen Praxis chinesische Reisende kaum auf Ressentiments stießen. „Meinung und Verhalten, das zeigt dieses Beispiel aus der Forschung deutlich, liegen doch oft weit auseinander. Das ist in hohem Maße erklärungsbedürftig: Der Beziehungsaspekt in einer Interviewsituation, also eine Art von Mikrostruktur, ist auch etwas, womit sich die Netzwerkforschung beschäftigt“, sagt Stegbauer. Eine Erklärung könnte beispielsweise sein, dass Interviewantworten auch von der Spezifik der Beziehung zwischen Fragendem und Antwortendem abhängen. Solche Beziehungen, die sich auf das Antwortverhalten der Befragten auswirken können, bilden sich ziemlich schnell heraus.
Studium: Neue Lebensphase (auch) mit alten Beziehungsmustern
In seinem neuen Buch zieht der Soziologe zur Erläuterung der „Grundannahmen der Netzwerkforschung“ auch die Beziehungen unter Studierenden heran. Für ihn eine erstaunliche Beobachtung: Auf die Frage, wo und wann sich die Teilnehmenden seines Seminars kennengelernt haben, antwortet eine sehr große Mehrheit mit: „in der Orientierungswoche“, und häufig sogar „am ersten Tag“. Etwas relativiert sich der Eindruck, wenn man genauer überprüft, wie sich Bekanntschaften im Studium aufgebaut haben. „Es hängt immer auch davon ab, ob es sich um ein Massenfach oder eher um ein kleines Fach handelt; darum, wie das Studium aufgebaut ist, ob man sich eher in anonymen Vorlesungen oder in kleinen, überschaubaren Seminaren begegnet und ob man Seminararbeiten gemeinsam anfertigt“, erläutert Stegbauer. „Aus einem Seminar, das ich mit einer Kollegin zusammen mit Studierenden aus Mainz und Frankfurt durchgeführt habe, weiß ich, dass in einem kleineren Fach wie der Soziologie in Mainz die Studierenden sich wesentlich besser kennen, weil sie sich eher in den Seminaren über den Weg laufen. Frankfurt hingegen gehört zu den größten soziologischen Instituten in Deutschland, dadurch ist die Zahl der Seminare wesentlich höher, man begegnet sich dadurch nicht so leicht. Wenn man es auf eine Formel bringen wollte, könnte man sagen: An einer großen Universität wie der Goethe-Universität, natürlich auch in einer Großstadt wie Frankfurt, ist man als Studi tendenziell einsamer.“
Die große Bedeutung, die eine Orientierungswoche fürs Netzwerken von Erstis hat, wurde gerade im letzten Sommersemester von Stegbauer und seinen Studierenden untersucht. Nicht alle, die für das Studium an eine Universität kommen, besitzen die gleiche Offenheit, Kontakte zu knüpfen. Besonders groß ist diese, wenn man für das Studium aus einer anderen Stadt umziehen muss und noch niemanden kennt. Aber wenn man schon in der Stadt lebt und zur Schule gegangen ist, hat man in der Regel ein Netzwerk aus Freunden und Familie jenseits der Universität. „Man kann sich auch noch eine dritte Gruppe anschauen, die der Tagespendler. Für die stellt sich das Problem, das sie Zeit zwischen den Veranstaltungen haben, die sie nicht unbedingt nutzen können. Beziehungsnetzwerke müssen bekanntlich gepflegt werden, ob an dem alten oder neuen Wohnort. Diese Zeit fehlt den Pendlern aber in der Regel, wenn sie viel Zeit in Bus und Bahn verbringen.“
Den Netzwerkforscher interessieren nun aber vor allem Strukturen, die der Netzwerkbildung zugrunde liegen. Die sogenannte Strukturation ist etwas, was der Einzelne gar nicht unbedingt selber wahrnimmt. Stegbauer macht dies an Begegnungen von Studierenden und Berufsschülern auf dem Campus fest: Dabei kommt es zu wenig Austausch und Kontakten, man kennt die andere Gruppe nicht und reflektiert auch nicht unbedingt darüber, warum es nicht zum Knüpfen von Beziehungen kommt. „Homophilie nennt man in der Netzwerkforschung ein weiteres Phänomen, nämlich dass die Merkmale der Sozialkontakte meist übereinstimmen. Und wenn man sich dann innerhalb einer bestimmten sozialen Schicht oder Gruppe anfreundet, dann werden die gemeinsam geteilten Interessen noch weiterentwickelt. Dann hat man aber das Gefühl, dass man sich seine Freunde und Bezugspersonen selber aussucht, weil die Strukturation, also die Bedingungen, unter denen Kontakte überhaupt zustande kommen können, sich hinter unserem Rücken vollzieht. Man kann sagen, es handelt sich um eine unsichtbare Hand des Sozialen, welche die Beziehungsfäden miteinander verwebt.“
Christian Stegbauer
Die 12 Grundannahmen der Netzwerkforschung
Reihe „Essentials“,
Springer Verlag 2024, Wiesbaden, 132 Seiten
Prof. Christian Stegbauer ist Apl. Professor für Soziologie an der Goethe-Universität und Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Netzwerkforschung, seit 2018 deren Vorsitzender.