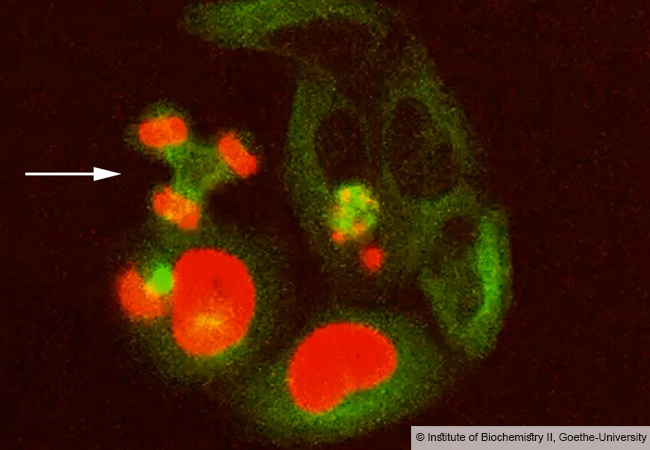Die Technische Universität Darmstadt, eine der drei Rhein-Main-Universitäten (RMU), widmet sich nicht nur in den ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Fächern innovativen Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen.
Die TU Darmstadt verfügt über zwei Hauptstandorte: den im Südosten der Stadt gelegenen Campus „Lichtwiese“ und den Campus „Stadtmitte“. Strenggenommen ist der letztgenannte kein Campus, denn die Gebäude der TU verteilen sich über Darmstadts überschaubaren Innenstadtkern und prägen diesen ganz erheblich.
Jung und doch traditionsreich: Das Stadtschloss, das gerade grundsaniert wird, das Alte Hauptgebäude, aber auch das zum Hörsaal umgebaute ehemalige Maschinenhaus sind mit ihren historischen Fassaden wirkliche Hingucker in einer stark vom Krieg zerstörten Stadt. Wie an vielen Universitäten wurde aber auch in Darmstadt in den 1960er und -70er Jahren pragmatisch-nüchtern gebaut, wovon viele Gebäude wie die Mensa zeugen.
Aber auch neue architektonische Impulse werden gesetzt: Die neue Universitäts- und Landesbibliothek, deren Form an ein kleingeschriebenes „b“ erinnert, hat mit ihrer luftigen und zugleich neo-klassischen Architektur eine Baulücke gefüllt und somit neue urbane Plätze zum Verweilen entstehen lassen.

In Darmstadts Zentrum spielt die Technische Universität aber nicht nur in baulicher Hinsicht eine tragende Rolle. „Ohne die vielen studentisch initiierten Konzerte, Lesungen und Partys wäre in der Stadt kulturell deutlich weniger los“, findet Julian Haas. Der Informatikstudent sitzt im Senat und war einige Jahre auch im AStA-Vorstand tätig.
Darmstadt sei eine richtige Studentenstadt, denn immerhin gebe es, berücksichtigt man auch die Immatrikulierten der Hochschule Darmstadt, mehr als 42.000 Studierende in der gut 150.000 Einwohner zählenden Stadt, betont Haas. Man studiere also gerne in Darmstadt, aber: Die Ruhe und Beschaulichkeit in der Stadt könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wohnungssuche kein einfaches Unterfangen sei.
Zwar seien die Mieten nicht so hoch wie in Frankfurt, aber günstig könne man in Darmstadt auch nicht mehr wohnen, beklagt Haas. In seinem Studienfach, der Informatik, seien zudem die Vorlesungen überlaufen, und das Betreuungsverhältnis sei auch nicht optimal, merkt er kritisch an. Das dürfte im Jahre 1877 noch anders gewesen sein: Mitten in der Zeit der Industriellen Revolution, in der an vielen Orten vorausschauend auf technisch orientierte Hochschulen gesetzt wurde, wurde die damalige Technische Hochschule Darmstadt gegründet.
1882 wird Erasmus Kittler hier der weltweit erste Professor für Elektrotechnik. Verglichen mit geschichtsträchtigen Universitäten wie der Uni Heidelberg ist die TU Darmstadt sicherlich keine alte Hochschule. Jedoch wird auch hier Tradition großgeschrieben, weiß Pressesprecher Jörg Feuck zu berichten. Der studierte Politologe und langjährige Redakteur der Frankfurter Rundschau hat prägende Erfahrungen mit dem Logo gemacht:
Die Bildmarke der Universität, der Kopf der Athene, sollte vor ein paar Jahren leicht modifiziert werden. Doch gehöriger Protest unter den Hochschulangehörigen, so Feuck, bewies, dass das Logo in der alten Form beibehalten werden sollte. „Ich habe das im Endeffekt als erfreulich und als klares Bekenntnis empfunden, dass man sich sehr mit dem Logo identifiziert und es pflegen möchte.“
Erste autonome Universität Deutschlands
Mit dem 2004 vom Hessischen Landtag einstimmig beschlossenen „TU Darmstadt-Gesetz“ hat die TU Darmstadt auch in der jüngsten Vergangenheit reichlich Aufmerksamkeit im In- und Ausland erzeugt:
Als erste autonome Universität in Deutschland wurde sie bundesweit richtungsweisend für ähnliche Modelle. Der Mathematiker Professor Dr. Hans Jürgen Prömel, seit 2007 Präsident der TU, macht deutlich: „Wir haben in den vergangenen 12 Jahren einen intensiven Lernprozess erlebt: Man kann als Hochschule nicht einfach einen Schalter umlegen und ist dann autonom. Autonomie muss man lernen und aktiv leben. Und dieser Bewusstseinswandel hat die gesamte Universität erfasst.“

Er betont die Selbstverantwortung der Universität für Entscheidungen, die früher das Ministerium in Wiesbaden traf. Vor allem die Personalautonomie sei ein wichtiges Instrument, um die Universität auf zukunftsträchtige und spannende Forschungsfelder vorzubereiten. „Wir haben die Autonomie beispielsweise dafür genutzt, um ein Zentrum für Cognitive Science zu gründen. Zugleich mussten wir selber dafür Sorge tragen, woher wir die Stellen für die neuen Professuren nehmen.“
Auch im Bereich Bauen manifestiert sich die Eigenverantwortung der Universität: Seit Prömels Amtsantritt wurden ca. 450 Millionen Euro in neue Gebäude und Umbauten investiert. „Wir haben entschieden, an welchen Stellen wir das Geld investieren und welche Gebäude uns für Forschung, Lehre und den Zuwachs an Lernzentren wichtig sind.“ Allein die neue Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) hat 73 Millionen Euro gekostet.
Neue Strukturen und insbesondere ein mit Personal stark aufgestocktes Baudezernat waren notwendig, um die neuen Aufgaben administrativ zu bewältigen. Auch an anderer Stelle wurden neue Governance-Ebenen etabliert: Ein eigenes Referat Qualitätsmanagement sorgt für das Monitoring der Leistungen und Zielsetzungen etwa der Fachbereiche und der Verwaltung.
Interdisziplinarität: Geist und Technik mit vereinten Kräften
Wie wirbt Uni-Präsident Prömel gegenüber Studieninteressierten für seine Universität? „An der TU beschäftigen wir uns mit wichtigen Zukunftsfeldern, in denen künftig mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen“, sagt Prömel wie aus der Pistole geschossen. Wer Wegweisendes über Industrie 4.0 oder Digitalisierung erfahren wolle, der sei an der TU Darmstadt richtig. Zugleich werde die Bedeutung einer Gründerkultur im Sinne von Entrepreneurship und Mut zum Umsetzen von Forschungsergebnissen in Innovationen den Studierenden fächerübergreifend vermittelt.
„Mit unseren längst zum Vorzeigemodell gewordenen fächerübergreifenden Projekten in der Studieneingangsphase geben wir etwa den angehenden Ingenieuren an die Hand, dass es mehr als Ingenieurswissen bedarf, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu meistern.“ Wichtig sei es, sich die Grundlagen der Naturwissenschaften zu erarbeiten, aber ebenso, die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Geistes- und Sozialwissenschaften zu suchen.

Interdisziplinarität, so Prömel, sei an einer mittelgroßen Uni leichter umzusetzen: „Die Durchlässigkeit zwischen den Fächern ist erfahrungsgemäß größer.“ Wie ist nun aber das Verhältnis von Geistes- und Sozialwissenschaften zu den technischen Fächern, gibt es da nicht bestimmte fächerspezifische Reibungen? Prömel konzediert, dass die Geisteswissenschaften schon eine gewisse „Schutzzone“ benötigten, da sie auch beim Einwerben von Drittmitteln aufgrund der Volumina der ausgeschriebenen Programme nicht so stark seien wie Ingenieurwissenschaften.
Grundsätzlich ist der Präsident der TU Darmstadt aber davon überzeugt, dass sich die Geistes- und Sozialwissenschaften auch an einer Technischen Universität anerkannt und eingebunden fühlen. „Ein Beispiel ist das neue Feld der Digital Humanities: Da befinden sich unsere Geisteswissenschaftler in einem sehr guten Austausch mit unserer großen Informatik.
Und auch im Verbund mit unseren RMU-Partneruniversitäten Frankfurt und Mainz hat dieser Ansatz riesige Potenziale“, unterstreicht Prömel. Julian Haas, der selber Informatik studiert, ist da etwas skeptischer. Er wünscht sich eine stärkere Berücksichtigung der eher kleinen Geistes- und Sozialwissenschaften auch bei der Mittelvergabe:
„Auch die technischen Fächer sollten noch mehr Bereitschaft dafür zeigen, sich von einer rein technischen Denkweise zu lösen und sich auch für ethische Fragestellungen zu öffnen“, wünscht sich Haas. Seine Hoffnung setzt er auch auf die RMU-Allianz: Wenn Fächer über Universitätsgrenzen hinweg kooperieren, könnte Darmstadt beispielsweise von den breiter aufgestellten Geistes- und Sozialwissenschaften in Frankfurt profitieren.
Auch der Roboter muss lernen …
Von den Studierendenzahlen her ist der Fachbereich Informatik der größte an der TU Darmstadt. Und auch im Hinblick auf die Forschung gibt es hier einige Leuchttürme zu besichtigen. Im Alten Hauptgebäude experimentieren Nachwuchswissenschaftler aus dem Fachgebiet „Intelligente autonome Systeme“ von Professor Jan Peters in modernen Labors mit Robotertechnologie. Zwar geht es hier primär nicht darum, Humanoide zu entwickeln, wie sie zum Beispiel als „Terminatoren“ in der Science Fiction schon lange unterwegs sind.
Mögen diese fiktionalen Roboter einem Wissenschaftler nur ein müdes Lächeln ins Gesicht zaubern, so geht die Forschung durchaus Wege, die erstaunlich sind: In Darmstadt arbeitet man augenblicklich an Weiterentwicklungen jener Roboter, die nur programmierte und damit feststehende Bewegungen ausführen können. Für Asimo, den wohl bekanntesten Humanoiden, kann ein Stein auf seinem Weg schon zum unüberwindbaren Hindernis werden.
Das Zauberwort lautet hier „Lernen“: Dr. Elmar Rückert und seine Kollegen wollen den Robotern nämlich beibringen, wie sie lernen. Denn gerade mittelständische Unternehmen benötigen keine Fertigungsroboter, die wie bei der Autoproduktion eine klar definierte Bewegung ausführen, sondern intelligente und anpassungsfähige Varianten. Das kann bedeuten, dass dem Roboter beim Zusammenbau eines Möbelstücks Bewegungen über eine vom Menschen bediente Kamera vorgegeben werden, aus denen er dann selbstständig die notwendigen Abläufe zusammensucht.
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“true“ style=“1″]
Die Technische Universität Darmstadt
Die Technische Universität Darmstadt zählt zu den mittelgroßen Universitäten in Deutschland; sie gehört dem Universitätsverbund technischer Universitäten an (TU9) an. Sie hat rund 26.300 Studierende, 4 700 Mitarbeiter, davon über 300 Professoren.
Die TU Darmstadt war 2007 und 2012 in der Exzellenzinitiative des Bundes erfolgreich, heute werden eine Graduate School of Computational Engineering „Beyond Traditional Sciences“ und eine Graduiertenschule für Energiewissenschaft und Energietechnik gefördert. Zusätzlich ist die TU Darmstadt am Exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ der Goethe-Universität beteiligt. Auch im Rahmen der Hessischen LOEWE-Initiative werden verschiedene Zentren und Schwerpunkte an der TU Darmstadt gefördert. 2015 wurden insgesamt 154 Millionen Drittmittel eingeworben.
Die Universität hat sechs Profilbereiche definiert: Cybersicherheit; Internet und Digitalisierung; Teilchenstrahlen und Materie; Thermo- Fluids und Interfaces; Energiesysteme der Zukunft; Vom Material zur Produktinnovation.
[/dt_call_to_action]
Selbst von „Artgenossen“ können im Darmstädter Labor Roboter lernen, wenn sie beim Tischtennisspielen gegeneinander antreten. Und auf einer weiteren Entwicklungsstufe hat der Roboter sozusagen gelernt, wie er lernen kann und sich flexibel neuen Situationen anpasst, wie es künftig auch auf sensiblen Feldern wie der Pflege in Altenheimen einmal notwendig werden kann. Dass Lernen immer auch eine spielerische Seite hat, merken Besucher des Roboterlabors spätestens dann, wenn sie gegen einen Roboter beim Strategiespiel „Tic Tac Toe“ antreten müssen:
Wenn der Roboterarm den ersten Zug getätigt hat, ist es schwer, noch gegen ihn zu gewinnen. „Bislang sind die Roboter noch semi-autonom“, betont Rückert; man sollte, so der Forscher, auf den Fortschritt, den die Technologie in den nächsten Jahren machen wird, nicht mit Schreckensszenarien reagieren. „Kognitive Fähigkeiten, wie sie der Mensch in den ersten Lebensjahren entwickelt, zu erwerben ist für einen Roboter nach wie vor sehr schwierig.“
Jedoch sieht Rückert durchaus die Notwendigkeit, dass die Politik in der Zukunft ein Regelwerk festschreiben sollte. „Ich denke nicht, dass ein Roboter jeden Beruf ersetzen sollte.“ Jedenfalls kann sich Rückert nicht vorstellen, dass ein intelligenter und autonomer Roboter sogar ein Team leiten kann – das sehen in den technikverliebten USA manche Forscher bereits anders.
Digital, aber nicht papierlos …
Die Möglichkeiten digitaler Datenverarbeitung und Kommunikation erscheinen schier unbegrenzt. Doch auf dem Weg ins digitale Zeitalter lauern auch Fallstricke, sind Prinzipien des Datenschutzes und der Datentransparenz zu beachten. Ein Feld, auf dem analoge Medien künftig von digitalen abgelöst werden können, ist das Wahlverfahren. Anstatt sein Kreuzchen auf einem Papierzettel zu machen, könnte der Wähler doch auch am Computer seine Stimme abgeben.
Dass dies nicht ganz so einfach ist, wie es klingt, kann Dr. Jurlind Budurushi, Mitarbeiter im Fachgebiet Security, Usability, Society (SECUSO) anschaulich erläutern: Jeder Wähler muss etwa bei Kommunalwahlen auch ohne technisches Vorwissen seine individuell abgegebenen Stimmen überprüfen können. Das bedeutet: Die digital eingegebenen Daten müssen gewissermaßen auch außerhalb des Systems gecheckt werden können, es bedarf also eines papiernen Ausdrucks.

Warum nun überhaupt an dem digitalen Wahlverfahren EasyVote forschen, wenn der „Medienbruch“, also ein hybrides Verfahren, das analog und digital verbindet, unvermeidlich ist? Betrachtet man das Hessische Kommunalwahlgesetz, dann gibt es gute Gründe dafür: Denn dieses erscheint dem Außenstehenden zuerst einmal als sehr komplex. Man kann panaschieren, d. h. seine Stimmen an die Bewerber verschiedener Parteien verteilen, aber auch kumulieren, d. h. einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben, und die beiden Möglichkeiten miteinander kombinieren.
Das digitale Wahlsystem kann den Wähler aktiv unterstützen, den Überblick über bereits vergebene und noch mögliche zu vergebende Stimmen zu behalten, indem es auf Fehler oder sich aufhebende Konstellationen aufmerksam macht. Die Forscher fanden in einer Studie heraus, dass dadurch die Zahl der ungültigen Wahlzettel signifikant verringert werden könnte. Ob Verfahren wie EasyVote einmal bei Wahlen zum Einsatz kommt, ist noch nicht ganz klar. Budurushi vermutet, dass junge Wähler digitalen Stimmverfahren gegenüber offener sind.
Dass man in Deutschland einmal von zuhause aus auf elektronischem Weg seine Stimme abgeben wird, stellt für ihn eine Alternative zur Briefwahl dar, nicht jedoch einen Ersatz für das traditionelle Wahllokal: „Ein Wahllokal ist zugleich so etwas wie eine geschützte Zone und ein öffentlicher Ort, und gerade das ist ja für eine Wahl nicht ganz unwichtig.“
Wenn die Kaffeemaschine gehackt wird …
Wenn über die Sicherheit von digitalen Geräten gesprochen wird, denkt man meist an Rechner, Laptops und Smartphones, vielleicht manchmal auch an Bordcomputer im intelligenten, vernetzten Auto. Der neueste Trend ist die Digitalisierung von Alltagsgeräten: Kaffeemaschinen, Türschlösser oder Heizungs-Thermostate können über winzige Chips mit dem Internet verbunden werden. Schätzungen gehen davon aus, dass in ein paar Jahren weltweit bis zu 20 Milliarden solcher internettauglicher Geräte im Einsatz sein werden.
Cybersecurity, kurz „CYSEC“, heißt der junge Profilbereich, in dem die TU Darmstadt ihre Forschungsaktivitäten in IT- Sicherheit bündelt. Hier werden auch die Sicherheitsrisiken des „Internet der Dinge“, im Englischen kurz und knapp „IoT“, untersucht. Der Informatiker Markus Miettinen erklärt im IoT Security Lab, warum hier gewaltige Sicherheitslücken klaffen: „Die Hersteller solcher Alltagsgeräte sind natürlich keine IT-Experten und gehen daher recht sorglos mit dem Einbau von Chips um, die den Anschluss ans Internet ermöglichen.
Damit können die Geräte aber potenziell von außen gehackt werden.“ Miettinen und das Team des Security Lab arbeiten daran, dass Sicherheitslücken in IoT-Geräten vom System automatisch erkannt werden. Der Nutzer kann dann beispielsweise die Firewall-Einstellungen ändern. Wünschenswert wäre ebenso, dass die für solche Fragen sensibilisierten Kunden den Druck auf die Hersteller erhöhen, damit diese mehr Sorgfalt bei der Anbindung ihrer Geräte ans Internet walten lassen.
Die Wissenschaftler bezeichnen dieses Feld als „privacy by design“. Vorerst betreiben die Darmstädter Informatiker in diesem Bereich Grundlagenforschung – der wohl nicht aufzuhaltende Boom des IoT verleiht ihrer Forschung ein hohes Maß an Relevanz. Die „gehackte Kaffeemaschine“ mag heute vielleicht noch nach einem schlechten Witz klingen, doch sollte sich die Gesellschaft rechtzeitig auf Sicherheitslücken von weit größerer Tragweite einstellen …
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“plain“ style=“1″ line=“false“]
 Im Porträt: Die Johannes Gutenberg-Uni in Mainz
Im Porträt: Die Johannes Gutenberg-Uni in Mainz
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) kann auf eine lange Tradition verweisen – und ist doch eine junge dynamische Hochschule. Mit vielen Neu- und Umbauten rüstet sie sich für die neuen Herausforderungen. Ein Besuch bei einer der drei Rhein-Main-Universitäten (RMU). Weiterlesen »
[/dt_call_to_action]
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 6.16 (PDF-Download) des UniReport erschienen.