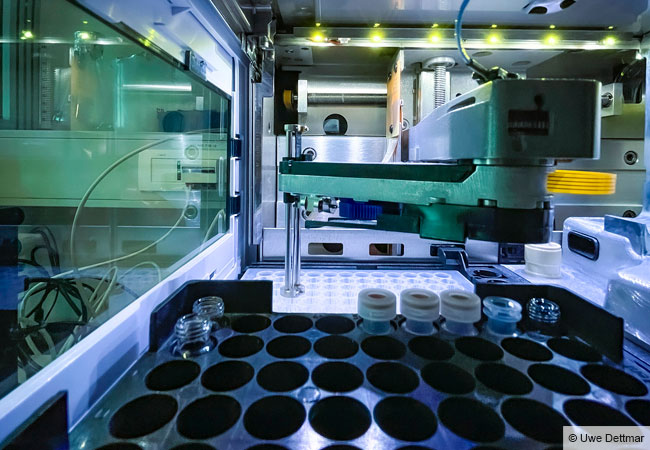Der Jurist Rudolf Steinberg über sein Buch »Zwischen Grundgesetz und Scharia. Der lange Weg des Islam nach Deutschland«
UniReport: Herr Professor Steinberg, Sie beschäftigen sich in Ihrem aktuellen Buch bereits zum wiederholten Mal mit dem Verhältnis von Islam und Mehrheitsgesellschaft. Was war der Anlass dafür, warum hat das Thema für Sie als Jurist einen so großen Stellenwert? Fehlt in Deutschland in der Debatte der juristische Sachverstand, argumentieren die meisten Menschen zu moralisch und emotional?
Prof. Steinberg: In der Tat fehlt in Debatten über den Islam in Deutschland den Diskutanten oftmals die nötige Distanz; es sind Streitgespräche, in denen man eher übereinander, nicht miteinander redet. Aber der Anstoß dafür, mich erneut mit diesem Thema zu befassen, war vor allem die Frage, wie ein pluralistisches Gemeinwesen organisiert sein muss, damit ein Mindestmaß an Einheitlichkeit erreicht wird. Was braucht man, damit ein friedliches Zusammenleben möglich ist? Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat mal auf einer Veranstaltung gesagt: Wenn wir, die Aufgeklärten, uns nicht offen mit dem Thema auseinandersetzen, dann tun es die Nichtaufgeklärten. Und das ist ja gerade die Situation.
Integration sei keine Einbahnstraße, hat ein Integrationsforscher einmal gesagt.
Dem stimme ich absolut zu! Wenn Sie Millionen Einwanderer haben – davon viereinhalb bis fünf Millionen Muslime –, dann hat ein Staat die Verpflichtung, auf diese Menschen zuzugehen. Das sind immer wechselseitige Herausforderungen, wobei wir, die Mehrheitsgesellschaft, schon auch sagen sollten, was für uns unverzichtbar ist. Das ist für mich als Verfassungsrechtler ja ziemlich eindeutig, dass es über die Eckwerte der Verfassung nichts zu verhandeln gibt. Ich schließe mich im Übrigen der Meinung des Rechtsund Islamwissenschaftlers Mathias Rohe an, der auf einer Veranstaltung an der Goethe-Uni gesagt hat: „Ich bin Eurozentrist.“ Unsere Werte sind so wichtig, dass wir uns auch für diese einsetzen müssen. Aber wir müssen andererseits da, wo es nicht um das Unverzichtbare geht, auf den anderen auch zugehen und seine Lebensformen akzeptieren.
In Ihrem Buch geht es um die islamische Rechtsprechung, die Scharia, die hierzulande mit fundamentalistisch-extremistischen Urteilen in Verbindung gebracht wird. In Ihrem Buch legen Sie eine differenzierende Betrachtung nahe.
Bisweilen wird auch in unserer Rechtsprechung, zum Beispiel in den Verwaltungsgerichten, so getan, als ob die Scharia eine Art muslimischer Katechismus sei. Das stimmt so aber nicht, es gibt höchst unterschiedliche Ansichten darüber, was der „richtige Weg“, so die Übersetzung von Scharia, ist. Was wir durchaus feststellen können ist, dass sich ungefähr seit 100 Jahren eine restriktive und reaktionäre Auslegung der Scharia durchgesetzt hat. Was ich nun bestimmten Kritikern des Islam vorwerfe ist, dass sich diese auf diese eingeengte Auslegung des Korans und der Hadithe einschießen; mit anderen Worten argumentieren sie genauso fundamentalistisch wie der von ihnen kritisierte reaktionäre Islam. Es gibt Religionsforscher, die sogar betonen, dass von den drei abrahamitischen Religionen der Islam die toleranteste sei. Spätestens seit den Anschlägen auf das World Trade Center und dem islamistischen Terror auch in Europa erscheint dem einen oder anderen das vielleicht abwegig. Aber man muss sehen, dass der Westen ganz entscheidend mit dazu beigetragen hat, dass sich die reaktionären Deutungen der Scharia haben durchsetzen können. Hierzu haben nicht zuletzt die kolonialen und militärischen Interventionen Amerikas und europäischer Mächte in den islamischen Ländern beigetragen. Westliche Staaten haben gerne mit Diktatoren arabischer Länder zusammengearbeitet. Finanziert wurde das weltweite Vordringen fundamentalistischer Islam-Bewegungen unter anderem mit den Öl-Dollars der Wahhabisten aus Saudi-Arabien, einem engen Verbündeten des Westens. Liberalere Interpretationen des Islam wurden verdrängt. Deutschland hat lange Zeit darauf gesetzt, durch die Zusammenarbeit mit den Heimatländern radikale Muslime fernhalten zu können. So war im Nachhinein betrachtet die Zusammenarbeit mit Ditib anfangs sehr positiv. Dann musste man jedoch feststellen, dass die Türkei sich wenn auch nicht auf dem Wege zu einer fundamentalistischen, dann aber doch zu einer osmanisch-orthodoxen Auslegung des Islams befindet.
Rudolf Steinberg
…war von 2000 bis 2008 Präsident der Goethe-Universität. Neben „Zwischen Grundgesetz und Scharia. Der lange Weg des Islam nach Deutschland“ (Campus Verlag 2018) ist von ihm auch „Kopftuch und Burka. Laizität, Toleranz und religiöse Homogenität in Deutschland und Frankreich“ (Nomos Verlagsgesellschaft 2015) erschienen.
Die Aufzeichnung einer Diskussion mit Prof. Steinberg, Prof. Susanne Schröter und Prof. Rainer Forst über das Buch „Zwischen Grundgesetz und Scharia“ im Forschungskolleg Humanwissenschaften ist hier abrufbar.
In Deutschland verweisen viele Kritiker von öffentlich ausgestellten religiösen Symbolen auf Frankreich und den Laizismus. Was ist Ihrer Meinung nach daran problematisch?
Die verfassungsrechtliche und ideengeschichtliche Entwicklung ist in Frankreich eine komplett andere. Der Laizismus ist im französischen Verfassungsrecht verankert, gleichwohl ist die Trennung von Staat und Kirche längst nicht so entschieden, wie immer wieder in Deutschland behauptet wird. Es gibt vielfältige Formen der Zusammenarbeit; so stellt der Staat zum Beispiel Grundstücke für Moscheen zur Verfügung. In Deutschland gibt es kein Trennungssystem, wohl aber eines, das man als Kooperationsverhältnis bezeichnet, das manche Lösungen einfacher macht. Das sehen auch französische Beobachter so.
Eines der meistdiskutierten Themen in der öffentlichen Debatte ist die Burka. Wie schätzen Sie das ein, ist der religiöse Gehalt das Entscheidende hier, sind die Burka bzw. Niqab vom Prinzip der Religionsfreiheit gestützt?
Da ergibt sich ein großer Dissens zwischen mir und dem Politischen Philosophen Rainer Forst, so sehr wir auch in wesentlichen Punkten übereinstimmen. Meines Erachtens gibt es hier eine kulturelle Grenze: Unsere Kultur beruht auf dem Prinzip des Sichtbaren. Unsere Häuser sind nach außen ausgerichtet, während in der arabischen Architektur das Prinzip des Abschließens erkennbar ist, das Leben spielt sich meist im Innenhof ab. Auch beim Umgang mit dem Bild des Heiligen, aber auch des Menschen sieht man deutliche Unterschiede. Wenn sich Frauen diese im Übrigen nach Auffassung der meisten Islamgelehrten nicht von der Religion vorgeschriebenen Kleidungsstücke überziehen, dann sage ich, dass dieses Verhalten nicht zu unserer Kultur der Sichtbarkeit passt. Denn dieses Zeichens bedienen sich – wenn man einmal von den arabischen Touristinnen in der Goethestraße absieht – vor allem Salafistinnen, die damit bewusst ihre Trennung, Ausgrenzung und Nicht-Kommunikation zum Ausdruck bringen. Rainer Forst wirft mir an dieser Stelle vor, ich würde einseitige Zuschreibungen machen, die ich an anderer Stelle den Kritikern des Kopftuches vorwürfe. Aus meiner Kritik an der Praxis des Niqab- und Burka-Tragens ergibt sich aber nicht notwendigerweise die Pflicht, mit Sanktionen dagegen vorzugehen. Man muss nicht nur schauen, ob tatbestandliche Gründe vorliegen für Verbote, sondern auch nach Maßgabe des Opportunitätsprinzips vorgehen. Deshalb bin ich gegenüber einem Burkaverbot in der Öffentlichkeit skeptisch. Bei hoheitlichen Aufgaben des Staates sollten Formen der Vollverschleierung allerdings nicht toleriert werden. Ebenso nicht bei Veranstaltungen in Schule und Hochschule oder auch vor Gericht. Hier ist die Kommunikation aller Beteiligten ganz wichtig, hier hat die Niqab nichts zu suchen. Als Jurist weiß ich auch, dass man mit rechtlichen Verboten die wenigsten Probleme aus der Welt schafft. Man müsste eine Stufe davor ansetzen: Die Imame sollten den jungen muslimischen Frauen vermitteln, dass der Koran das Tragen eines solchen Bekleidungsstückes nicht vorsieht. Man sollte verhindern, dass diese jungen Menschen sich selber aus der Gesellschaft ausgrenzen und sich radikalen Gruppen wie den Salafisten anschließen.
Ein Streitpunkt in der Diskussion ist ja auch der Schwimmunterricht.
Da bin ich der Meinung, dass man eine Common-Sense-Antwort finden muss, nach Maßgabe der als wichtig erachteten Lernziele. Wenn man zu der Überzeugung gelangt, dass der Schwimmunterricht für das gemeinsame Lernen von Jungen und Mädchen essenziell ist, dann sollte man das auch durchsetzen. Wer wie Rainer Forst das nicht möchte, der akzeptiert, dass sich Menschen in eine abgeschlossene Parallelwelt zurückziehen. Es gibt dazu eine ganze Reihe interessanter Gerichtsentscheidungen in der Schweiz, aber auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In diesen Entscheidungen wird der Gedanke der Integration in den Fokus gerückt. Verbote allein bringen allerdings auch hier wenig, man muss die Eltern überzeugen.
Also wäre das vor allem eine Aufgabe des Bildungssystems?
Ja, die zentrale Frage lautet: Wie kann man junge Leute mit unseren grundlegenden Werten vertraut machen? Das kann ja nur die Schule übernehmen. Was ich beklage: Im Rahmen unseres LOEWE-Zentrums IDeA sind konkrete Vorschläge erarbeitet worden, wie man in Kindergarten und Schule mit diesen Problemen von Migranten umgehen kann, leider hat die Schulverwaltung dies wohl nicht zur Kenntnis genommen.
Ihnen liegt eine institutionelle Einbindung der Vertreter des Islams am Herzen.
Wenn wir einen deutschen Islam haben wollen, müssen wir die institutionellen Rahmenbedingungen dafür schaffen und die Moscheegemeinden in unser religionsverfassungsrechtliches System integrieren. Es wäre wünschenswert, dass in den Moscheen die dort tätigen Imame eine mit unseren Werten verträgliche Auslegung der Scharia vermitteln. Davon gibt es aber noch viel zu wenige. In Deutschland arbeiten ungefähr 900 Imame aus der Türkei, das sind Staatsangestellte bei Diyanet. Viele davon können kein Deutsch, kennen auch gar nicht die Lebensbedingungen der jungen Leute. Das ist auch ein Grund, warum deutsche salafistische Konvertiten einen so großen Zuspruch bei den Jungen haben – sie sprechen nämlich deren Sprache. Wir haben diese Aufgabe in den Moscheegemeinden in den letzten 30 Jahren gewissermaßen an die Herkunftsländer ‚outgesourced‘. Intelligent wäre es, wenn der Staat muslimische Religionslehrer beschäftigte, die dann halb freigestellt auch in den Gemeinden als Imame tätig wären. Wer einen Bachelor oder Master in Islamwissenschaft ablegt, verfügt natürlich noch nicht über die nötige Lehrpraxis. Die könnte nach Vorbild der Referendarausbildung im Rahmen eines Seminars vermittelt werden. Eine andere Überlegung zielt auf die Finanzierung der Moscheegemeinden. Wir haben in Deutschland das System der sogenannten Staatsleistungen. Jährlich fließen etwa 500 Millionen Euro an die Kirchen. Könnte man nicht in angemessener Weise auch muslimische Gemeinschaften fördern? Damit könnte der Staat zugleich auch Forderungen an die Moscheegemeinden stellen. Ich schaue sehr skeptisch auf Ditib, gleichwohl sollte man nicht vollständig und vor allem nicht sofort auf die Zusammenarbeit verzichten. Stattdessen sollte man sich bemühen, mit den aufgeschlossenen Vertretern ins Gespräch zu kommen. Wir sollten nicht alles in Bausch und Bogen verurteilen, sondern uns die vielen positiven Beispiele anschauen.
Die Fragen stellte Dirk Frank
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.19 des UniReport erschienen.