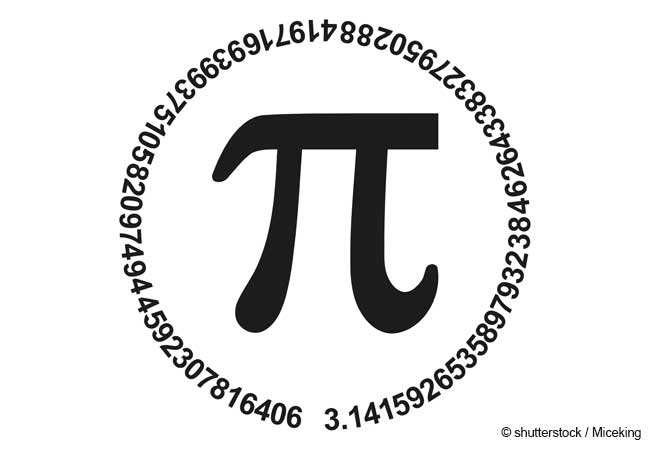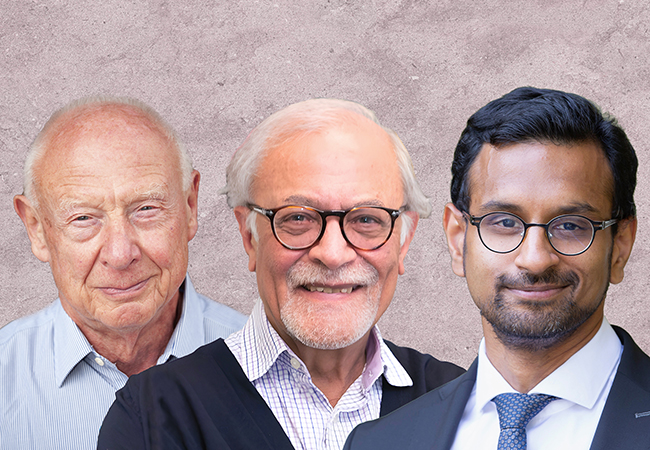Eine Professorin wie Christine Ecker würde man spontan erst mal nicht am Klinikum der Goethe-Universität, an der „Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters“ vermuten: Weder gehört sie zu den Klinikern, also zu den Medizinerinnen und Medizinern, die sich hier um Diagnose und Therapie der jungen Patienten kümmern, noch ist sie als Psychologin beziehungsweise Psychotherapeutin angestellt.
Als Leiterin der Gruppe „Klinische Bildgebung“ hat sie einen anderen fachlichen Hintergrund und konzentriert sich ganz auf ihre Forschung, für die sie insbesondere Magnetresonanztomogramme (MRT) auswertet, die von den Gehirnen ausgewählter Patienten sowie gesunder Kontrollprobandinnen und -probanden aufgenommen werden. Zwar hatte Ecker nach dem Abitur zunächst begonnen, Psychologie zu studieren.
Aber während des Grundstudiums wurde ihr klar: „Das Psychologiestudium baut größtenteils auf ganz abstrakten Konstrukten auf. Solche kognitiven Prozesse und Gedankengänge finde ich ziemlich schwer zu verstehen. Ich denke da eher ‚mechanistisch‘, das heißt, ich betrachte lieber, wie verschiedene Einflüsse auf ein System wirken und welche Auswirkungen das hat.“
Begeisterung für das Komplexe
Dementsprechend war Ecker schon immer an Gehirnforschung interessiert, so dass sie nach dem Vordiplom nach England ging, um in Oxford Neurowissenschaften zu studieren – in Deutschland wurde dieser Studiengang Ende der 1990er Jahre noch nicht angeboten. Und die Faszination, die das Gehirn, insbesondere das menschliche Gehirn, schon damals auf sie ausübte, ist ungebrochen:
„Das Gehirn ist ja ein unglaublich komplexes Organ“, schwärmt Ecker; diese Komplexität ermögliche ganz unterschiedliche Herangehensweisen: „Zum einen kann man versuchen, das Gehirn über seine Anatomie zu verstehen, zum anderen ist es natürlich aufschlussreich, die Funktionsweise des Gehirns zu studieren.“ Außerdem lasse sich das Gehirn mit seinen verschiedenen Neurotransmittern, die Signale von Nervenzelle zu Nervenzelle weitergeben, gewissermaßen als pharmakologisches Organ betrachten, fügt Ecker hinzu und folgert:
„Daraus ergibt sich quasi automatisch, dass wir in der Hirnforschung mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Medizin, Biologie, Psychologie, Mathematik, Informatik und anderen Gebieten zusammenarbeiten, und dieser interdisziplinäre Ansatz macht mir besonderen Spaß.“ Ihr Forschungsgebiet bezeichnet Ecker als biologische Psychiatrie:
Sie wendet biologische Modelle auf Erkrankungen der Seele an und sucht nach deren hirnorganischen Ursachen. Genauer gesagt konzentriert sich sich auf eine ganz bestimmte Krankheit: Autismus. Diese Störung der sozialen Interaktion und der Kommunikation ist angeboren und häufig von Depressionen, ADHS, sozialen Phobien oder anderen Angststörungen begleitet. Sie wird typischerweise im Kindesalter diagnostiziert und kann bislang nur schwer behandelt, geschweige denn geheilt werden.
Von geistig behindert bis hochbegabt
„Faszinierend finde ich, wie groß das Spektrum der Symptome ist. Nicht nur, dass manche Autisten hochbegabt, andere wiederum geistig behindert sind“, erläutert Ecker. Allgemein seien die Symptomschweregrade und Symptomprofile äußerst breit gefächert. So äußere sich Autismus neben gestörtem Sozialverhalten und eingeschränkter Kommunikation auch in stereotypem Verhalten, also in der ständigen Wiederholung von Bewegungsabläufen.
Während die soziale Interaktion und die Kommunikation allerdings bei allen Autismus-Patientinnen und – Patienten beeinträchtigt seien, zeigten einige von ihnen kaum Stereotypien, andere hingegen ausgeprägte zwanghafte und immer wiederkehrende Handlungsmuster. Eckers wissenschaftliches Ziel besteht derzeit darin, mit Hilfe verschiedener MRT-Verfahren zu untersuchen, ob es trotz dieses breiten Spektrums Gemeinsamkeiten gibt, anhand derer sich das Gehirn eines Autisten grundsätzlich vom Gehirn eines gesunden Probanden unterscheiden lässt.
Und das ist in der Tat der Fall. So hat Ecker festgestellt, dass es im Autistengehirn zwar prinzipiell die gleichen Hirnareale gibt, dass diese aber größer, kleiner oder anders miteinander verschaltet sein können. Außerdem entwickeln sich beide Gehirne unterschiedlich über die Lebensspanne des Probanden, der Probandin hinweg:
Bis zum Alter von fünf bis sechs Jahren scheint das Gehirn von Autisten insgesamt deutlich schneller zu wachsen, während anschließend die Dicke der Hirnrinde stärker abnimmt, als das bei Gesunden der Fall ist. Bislang beschränkte sich die Autismusforschung im Wesentlichen darauf, autistische Probanden mit einer gesunden Kontrollgruppe anhand von Gruppenmittelwerten zu vergleichen.
Das erlaubt aber für einen einzelnen Patienten noch keine Vorhersage: Wenn ein Gehirn in einem Aspekt den gleichen Wert aufweist wie das durchschnittliche Autistengehirn, so bedeutet das nicht, dass bei diesem Patient automatisch auch Autismus vorliegt. Eckers Fernziel ist es hingegen, sogenannte Biomarker für Autismus zu finden, also Merkmale in der Gehirnstruktur, die charakteristisch für Autismus sind.
Überdies plant Christine Ecker, die Diagnosen mithilfe des sogenannten maschinellen Lernens zu unterstützen. Hierbei lernen Computeralgorithmen auf Basis der Gehirnanatomie, Muster im Gehirn zu finden, die Menschen mit Autismus von nicht autistischen Probanden unterscheiden, so dass Computer auf diese Weise vorhersagen können, auf wen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Autismusdiagnose zutrifft.
[Autorin: Stefanie Hense]
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 4.18 des UniReport erschienen. PDF-Download »