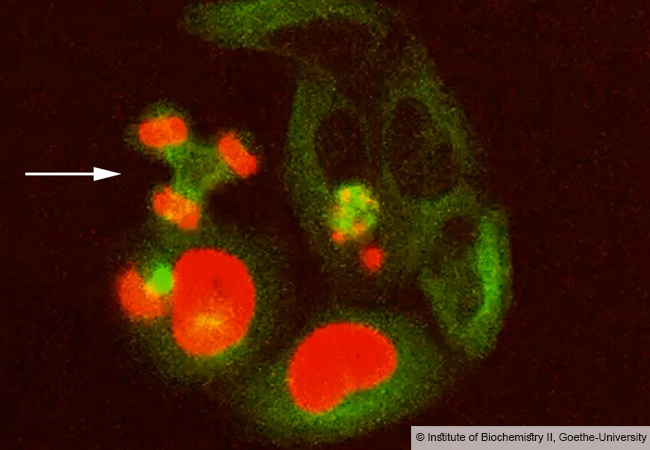Interview mit Gerhard Minnameier über die Förderung moralischen Verhaltens in Unternehmen, das Trittbrettfahrer-Problem und die wiederkehrende Relevanz des Homo Oeconomicus.
Ihre Professur lautet auf „Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik“. Das heißt, Ihre Forschung liegt an den Schnittstellen zwischen Wirtschaftswissenschaften, Pädagogik, Philosophie und Psychologie. In welchem Fach fühlen Sie sich am wohlsten?
Eigentlich in allen. Thematisch getrieben liegt der Schwerpunkt immer mal wieder mehr in der einen Richtung, mal in der anderen. Von Hause aus bin ich Wirtschaftspädagoge. Durch die Beschäftigung mit der Kaufmannsmoral und Fragen der Entwicklung von Moral und Kompetenz ergeben sich zwangsläufig Überschneidungen mit der Psychologie, Philosophie und teilweise auch naturwissenschaftlichen Ansätzen.
Konkret beschäftigen Sie sich unter anderem mit der Entwicklung moralischen Denkens und Handelns in wirtschaftlichen und beruflichen Kontexten. Mit welchen Mitteln lässt sich diese Entwicklung beeinflussen?
In der Wirtschaftspädagogik geht man davon aus, dass wirtschaftliches Handeln die Moral, wenn überhaupt, eher negativ beeinflusst. Konkurrenz- und Wettbewerbsstrukturen führen letztlich dazu, dass der Einzelne mehr an die eigenen Interessen denkt als an die der anderen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Menschen mit kaufmännischer Bildung eigeninteressierter entscheiden als andere. Aber man muss sehen, dass dies in einer Marktwirtschaft auch systematisch so gewollt ist. Insofern ist schon die Frage, auf welches Ziel Bildungsprozesse ausgerichtet werden sollen, alles andere als trivial.
Die Idee der Marktwirtschaft ist ja – im Sinne von Adam Smith –, dass der Einzelne zwar seinen Interessen folgt, dabei aber auch zum Wohle der Gemeinschaft handelt.
Das ist im Grunde auch immer noch richtig. Marktwirtschaftliches Handeln und wettbewerbliche Strukturen werden nicht zuletzt aus ethischen Gründen legitimiert. Wettbewerb ist im marktwirtschaftlichen System sozial erwünscht. Man muss dabei weiterreichende soziale Strukturen von näheren unterscheiden. Werte, die z.B. im privaten Kreis moralisch erwünscht sind, wie etwa gegenseitige Fürsorge, würden im öffentlichen Umgang zu Vetternwirtschaft oder Korruption führen. Allerdings wissen wir natürlich auch, dass der Markt manchmal versagt. Gleichzeitig können wir nicht darauf vertrauen, dass der Staat durch Gesetzgebung einen Ordnungsrahmen schafft, durch den ungewollte Effekte wirtschaftlichen Handelns eliminiert werden.
Die Ökonomen Alain Cohn, Ernst Fehr und Michael André Maréchal haben in einem Experiment untersucht, ob Banker grundsätzlich unehrliche Menschen sind oder ob sie nur im beruflichen Kontext zu unehrlichem Verhalten neigen. Sie finden heraus, dass letzteres der Fall ist. Wie lässt sich das verstehen?
Wir wissen, dass die meisten Menschen in bestimmten Situationen oder Kontexten sehr anfällig für eigeninteressiertes Handeln sind. So zeigt sich die Tendenz, sich durch moralisches Fehlverhalten finanzielle Vorteile zu verschaffen, besonders dann, wenn die soziale Wertschätzung im beruflichen Umfeld vom Einkommen und der Performance abhängt, bzw. die Personen das zumindest so empfinden. In dem Fall muss man sich nicht wundern, dass sie sich entsprechend verhalten. Da die Menschen unter anderen Bedingungen durchaus zeigen, dass sie auch zu anderer Moral fähig sind, liegt es auf der Hand, dass das Problem eher in den situationalen Bedingungen liegt als in der persönlichen ethischen Entwicklung des Einzelnen.
Das bedeutet also, dass moralisches Fehlverhalten, etwa während der Finanzkrise, nicht unbedingt ein ethisches Problem ist, sondern eher ein strukturelles?
Ich denke schon. Die meisten „unmoralischen“ Handlungen, die wir da beobachten konnten, hatten eher mit Fehlanreizen zu tun als mit einer verkorksten Moral. Wenn man sich die prominenten Fälle von Betrug anschaut, dann wurde zwar formal gegen unternehmensinterne Regeln verstoßen, aber informell hat es quasi jeder so gemacht. Und wenn man mit diesem Fehlverhalten Erfolg hatte, war das natürlich völlig in Ordnung. Insofern war auf der informellen Ebene gar nicht so klar, welche Regeln tatsächlich gelten sollten. Für den Einzelnen geht es letztlich immer um das Streben nach Anerkennung. Insofern müssen gerade Finanzunternehmen darüber nachdenken, wofür sie Anerkennung zollen. Wenn es nur um Gehalt, Bonus und den Platz in der Rangordnung geht und nicht darum, was jemand wirklich zum Unternehmenserfolg beiträgt, dann muss man sich nicht wundern. Die Banken sollten sich insofern damit beschäftigen, wie sie ihren Mitarbeitern eine andere Orientierung geben können, wie sie „angemessenes Verhalten“ im Sinne ihres Unternehmens definieren.
Wie ließe sich das erreichen? Es gibt ja immer wieder Versuche, moralisches Handeln durch Ethik-Kodizes vorzuschreiben. Funktioniert das?
Ein Kodex allein funktioniert in der Regel nicht. Er kann allenfalls die Funktion haben, Menschen an moralische Prinzipien zu erinnern. Für diesen Effekt ist es nicht einmal besonders wichtig, was in dem Kodex steht. Allein der Verweis darauf kann bewirken, dass man sich darum bemüht, nicht nur das eigene Interesse zu verfolgen. Diese Wirkung hält aber in der Regel nicht lange an und lässt sich auch nicht beliebig oft wiederholen. Ein Kodex kann insofern sinnvoll sein, wenn man an einer bestimmten Stelle Praktiken ändern und gewissermaßen einen positiven Sog in eine neue Richtung entfalten möchte, der Menschen aus ihrem alten Fahrwasser herausholt. Für nachhaltige Wirkungen bedarf es aber insbesondere einer systematischen und glaubhaften Implementierung einer Unternehmensphilosophie bzw. Unternehmenskultur, die auf gemeinschaftlichem Handeln zum Wohle des Unternehmens basiert.
Wie lässt sich das erreichen?
Zunächst muss es im beruflichen Kontext im Interesse des Arbeitgebers sein, überhaupt etwas ändern zu wollen. In vielen Firmen, gerade in der Finanzindustrie, ist es ja durchaus erwünscht, dass die Mitarbeiter in einem gewissen Wettbewerb untereinander stehen. Möchte ein Arbeitgeber dagegen tatsächlich ein kooperatives Verhalten fördern, etwa innerhalb einer Abteilung oder eines Teams, sind im Wesentlichen drei Schritte nötig: Der Arbeitgeber muss erstens Mitarbeiter einstellen, die die entsprechende moralische Kompetenz mitbringen, das Streben nach dem eigenen Nutzen dem Interesse der Gemeinschaft unterzuordnen; er muss zweitens Strukturen schaffen, die das Teamgefühl fördern; und drittens dafür sorgen, dass einzelne nicht die Kooperativität anderer ausnutzen und „Trittbrett fahren“ können. Diese Problematik kennen wir aus Spielen mit öffentlichen Gütern oder auch aus dem Gefangenendilemma: Wenn sich die einen kooperativ verhalten und es keine Sicherungsmechanismen zu deren Schutz gibt, kann es für andere vorteilhaft sein, nicht zu kooperieren. Ein Arbeitgeber, der ein gemeinschaftliches Klima schaffen möchte, muss also sicherstellen, dass Schwarze Schafe gegebenenfalls auffallen bzw. keine Anreize haben, „auszubrechen“ und damit die Moral der anderen zu korrumpieren.
Sie beschäftigen sich in mehreren Publikationen mit dem moralpsychologischen Konzept des „Happy Victimizers“. Gemeint sind damit Menschen, die, obwohl sie ein moralisches Prinzip kennen, nicht immer danach handeln und diesen Verstoß sogar positiv bewerten. Ist es dieses Phänomen, das man im marktwirtschaftlichen Berufsalltag z.B. in Banken beobachtet?
Das Konzept des „Happy Victimizers“ beschreibt ursprünglich ein Verhalten von Kindern im Alter von ca. 4 bis 6 Jahren. Man ging davon aus, dass sich dieses Verhalten anschließend „auswächst“. Ziel meiner Arbeiten in dem Bereich ist zum einen zu zeigen, dass es dieses Phänomen durchaus noch im Erwachsenenalter gibt: Menschen, die wissen, was moralisch richtig wäre, aber nicht motiviert sind, dementsprechend zu handeln. Zum anderen halte ich die Folgerungen der „Happy Victimizer“-Vertreter für falsch. So messen diese das moralische Verhalten von Teilnehmern beispielsweise mit einem Gefangenendilemma nach dem Motto: Wer kooperiert, ist moralisch motiviert, wer nicht kooperiert, dem fehlt es an moralischer Motivation. In der Ökonomik wissen wir aber, dass es in einer solchen Situation absolut rational ist, nicht zu kooperieren, wenn man keine Sicherungsmechanismen einbauen kann. Aus meiner Sicht ist es insofern pädagogisch problematisch, Menschen dazu zu erziehen, ökonomisch irrational zu handeln und sich dadurch ausbeutbar zu machen. Das würde auf eine Benachteiligung gerade der moralisch Motivierten hinauslaufen, was weder wirtschaftsethisch noch wirtschaftspädagogisch sinnvoll sein kann. Es hat mit Moral nichts zu tun, Menschen in restriktiven Situationen dazu zu bringen, sich selbst zu schädigen. Die Existenz von „Happy Victimizers“ ist aus meiner Sicht nicht durch moralische Erziehung zu überwinden, sondern sie hat in bestimmten Situationen schlicht ihre Berechtigung.
Wenn es letztlich immer von den Strukturen und der Situation abhängt, wie Menschen handeln, welche moralischen Kompetenzen kann die Wirtschaftspädagogik dann noch vermitteln?
Man kann Handlungsentwürfe und spezifische Kompetenzen für bestimmte Situationen vermitteln. Wenn im Arbeitskontext jeder gegen jeden spielt, sollte man die moralische Kompetenz haben, das erstens zu erkennen, zweitens eine Veränderung zu wollen und drittens sollte man Strategien kennen, wie man zu neuen „Spielregeln“ kommt. Wenn Sie beispielsweise die Situation eines Gefangenendilemmas nehmen, sollte man zu allererst in der Lage sein, die Restriktionen richtig einzuschätzen und eine Kooperation zu verweigern, wenn es ein „One-Shot-Game“ ist und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der andere kooperiert. In einer solchen Situation ist es durchaus angebracht, dass „jeder schaut, wo er bleibt“, was im Übrigen auch ein moralisches Prinzip ist, wenngleich ein recht simples. Aus einer höheren moralischen Perspektive ist aber natürlich Kooperation vorzuziehen, man möchte sich ja auch nicht auf Kosten anderer bereichern. Wer zu einer solchen Sichtweise in der Lage ist, tut gut daran zu versuchen, die Situation und die faktisch bestehenden Regeln falls möglich zu beeinflussen und zu verändern. Im Rahmen eines wiederholten Gefangenendilemmas ist z.B. eine „Tit for tat“-Strategie möglich, durch die man einen impliziten Vertrag zum beiderseitigen Vorteil mit den Mitspielenden aushandeln kann, kooperativ zu spielen. Die Möglichkeit, sein Gegenüber gegebenenfalls für unkooperatives Verhalten zu bestrafen, indem man ebenfalls zu seinen Lasten „ausbricht“, wäre ein Beispiel für die bereits erwähnten Sicherungsmechanismen, die geschaffen werden müssen, um kooperatives Verhalten in Unternehmen zu fördern und vor Ausbeutung zu schützen.
In einer Publikation vergleichen Sie das Konzept des „Happy Victimizer“ mit dem Konzept des Homo Oeconomicus. Ist letzteres für Sie noch brauchbar?
Es kommt darauf an, wie man es versteht. Das Image des Homo Oeconomicus hat sich ja in den letzten zwanzig Jahren sehr gewandelt. Um die Jahrhundertwende herum hat man das Konstrukt des Homo Oeconomicus als völlig weltfremd verurteilt und die These vertreten, dass sich Menschen real völlig anders verhalten. Seit einigen Jahren schwenkt das wieder um. Studien aus der Sozialpsychologie, aber auch aus der experimentellen Ökonomik haben gezeigt, dass die Menschen oft „moralische Heuchler“ sind. Sie sind nur dann moralisch, wenn sie nach außen zeigen können, dass sie damit soziale Standards erfüllen, und somit von sozialer Belohnung ausgehen oder von der Vermeidung sozialer Sanktionen. Die Forscher nennen das „moral hypocrisy“. Damit kehrt der Homo Oeconomicus gewissermaßen wieder in neuem Gewand zurück.
Allerdings geht und ging niemand jemals davon aus, dass reale Menschen rein eigeninteressiert seien wie der modellhafte Homo Oeconomicus. Ich verstehe das Konzept des Homo Oeconomicus abstrakter im Sinne eines Schemas für die Analyse menschlichen Handelns. Nach dem Rational-Choice-Ansatz lässt sich menschliches Handeln als Nutzenmaximierung unter Restriktionen verstehen. Das gilt auch für die Verfolgung moralischer Ziele bzw. die Realisierung moralischer Ansprüche. Dabei zeigt sich, dass Rationalität und Moralität zusammengehören. Es ist meines Erachtens wirtschaftsethisch und wirtschaftspädagogisch falsch, sie gegeneinander in Stellung bringen zu wollen. Dieser Punkt deutet allerdings auch die Möglichkeit an, dass Menschen im Sinne ihrer eigenen Ziele irrational oder ineffizient handeln. Hier stellt sich die Frage, wie das im Denken von Individuen erkannt und verarbeitet wird. Dieser Aspekt ist ebenfalls Teil meiner Forschung im Rahmen der „Inferentiellen Lerntheorie“.
Die Fragen stellte Muriel Büsser, Head of Communication, Research Center SAFE. Dieses Interview ist auch in den WiWi-News 2/2015 erschienen.
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“plain“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]

Zur Person
Gerhard Minnameier ist seit April 2011 Inhaber der Professur für Wirtschaftsethik und Wirtschaftspädagogik an der Goethe-Universität Frankfurt. Seine Forschungsgebiete umfassen die Entwicklung moralischen Denkens und Handelns in wirtschaftlichen und beruflichen Kontexten, Wirtschaftspädagogik im Kontext von Individual-, Unternehmens- und Ordnungsethik, Lehr-Lern-Forschung, Didaktik der Beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie Kompetenzerwerb und Kompetenzentwicklung.
Vor seinem Wechsel nach Frankfurt hatte Minnameier von 2005 bis 2011 den Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der RWTH Aachen inne. Weitere Stationen waren die Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie die Universität Erlangen-Nürnberg.
[/dt_call_to_action]