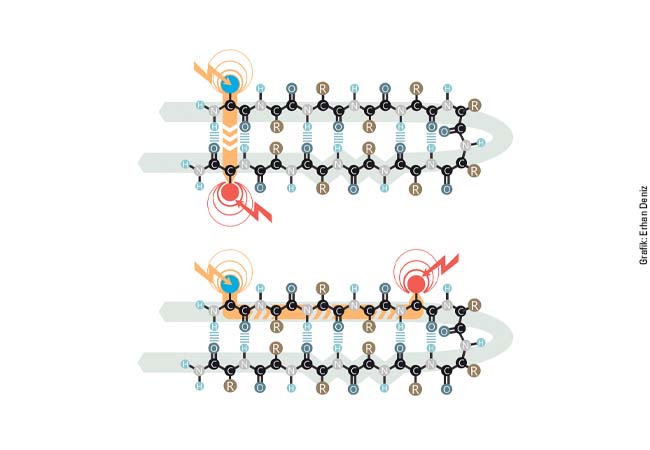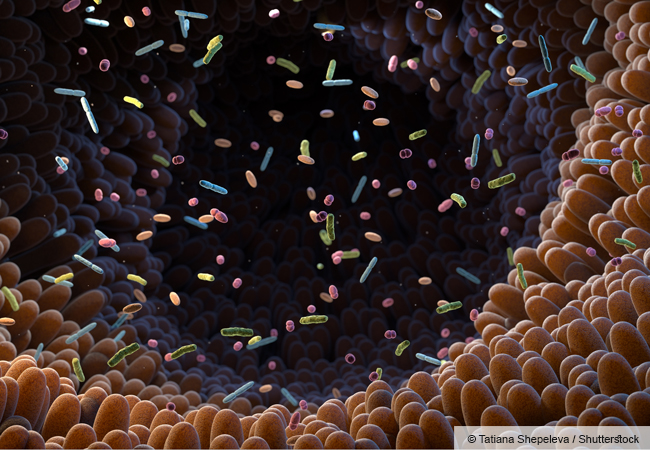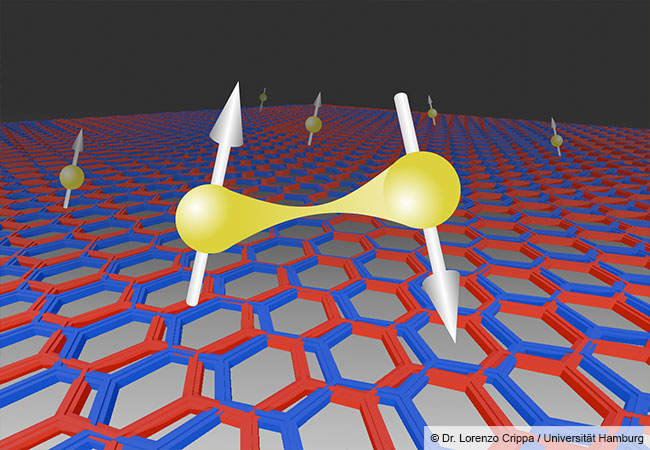Die Zeit vom 1. September bis zum 31. Oktober verbrachte ich als Distinguished Visiting Professor am Institute of Humanities and Social Sciences (IHSS) in Peking. Es ist ein erst seit wenigen Jahren bestehendes Forschungskolleg der Peking University (PKU), die als bedeutendste Universität Chinas gilt, einerseits aufgrund der Zuwendungen und der Lage in der Hauptstadt, andererseits wegen ihrer historischen Rolle in den politischen Transformationen des 20. Jahrhunderts – schon Mao Zedong studierte dort.
Während des Kriegs gegen Japan wurde sie nach Kunming im Süden des Landes ausgelagert und bot Wissenschaftlern die Möglichkeit des Überlebens, die später in der Volksrepublik beim Aufbau des Wissenschaftssystems, der Wirtschaft und der Verteidigung eine große Rolle spielen sollten. Die Universität verfügt über einen weitläufigen Campus. Im Süden und Osten stehen die modernen Gebäude für Forschung und Lehre, dazu die Wohnheime und Mensen. Im Norden und Westen liegen in einer den kaiserlichen Gärten des Sommerpalastes vergleichbaren Anlage verstreute kleine Institute in traditioneller chinesischer Bauweise zwischen Teichen und alten Bäumen, darunter das IHSS.
Es gilt als wichtige neue Initiative zur Belebung der Diskussionen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Nach außen bietet es öffentliche Vorträge, nach innen versammelt es die meist für vier Monate anwesenden Kollegiaten aus allen Teilen Chinas, auch aus Taiwan, Hongkong und Übersee, zweimal in der Woche zu intensiven Gesprächen über deren aktuelle Forschungsgebiete. Dieser wissenschaftliche Austausch fand so gut wie ausschließlich auf Chinesisch statt; nur mithilfe von dolmetschenden Studentinnen sollte und konnte ich daran teilnehmen.
Die Geisteswissenschaftler überwogen mit Forschungsfeldern wie der chinesischen Literatur, der chinesischen Geschichte – besonders intensiv wurde über die Han-Periode und über die chinesische Revolution diskutiert. Es gab Archäologie, die Genderproblematik, Linguistik und anderes. Ich empfand das breite Themengebiet als außerordentlich anregend, konnte aber nur für zwei Monate bleiben, um nach Semesterbeginn meiner Aufgabe als Seniorprofessor in Frankfurt ordnungsgemäß nachkommen zu können.
Zahlreiche Vorträge
Wegen mitgebrachter Verpflichtungen zum Schreiben von Aufsätzen für Tagungsbände musste ich mich in meinem Büro am IHSS hauptsächlich kapitaltheoretischen Problemen zuwenden, aber in überraschendem Ausmaß wurde ich zu einer Vortragstätigkeit an der PKU und außerhalb herangezogen. Die Titel der Vorträge an der PKU in Englisch und Deutsch lauteten: „The Contribution of Economic Knowledge to Welfare and Economic Growth in History”; „The Transformation of Values into Prices on the Basis of Random Systems Revisited”; „The Applicability of Modern Economics to Forms of Capitalism in Antiquity: some Theoretical Considerations and Textual Evidence”; „A Western Perspective on the Yantie lun – Yantie lun von Westen gesehen”; „Goethe als Ökonom”; „Max Weber as a Development Economist”; „Yantie lun (Debate on Salt and Iron): A Classic in a Comparative History of Economic Thought”.
Einige dieser Vorträge wurden an auswärtigen Universitäten wiederholt, nämlich an der Tsinghua Universität und der Renmin Universität in Peking, an der Fudan Universität in Shanghai, in Nanjing, in Kunming mehrfach und schließlich in Qingdao (dem alten Tsingtau der Deutschen). Ergebnisse seien wenigstens angedeutet: Der Bedeutung ökonomischen Wissens für die wirtschaftliche Entwicklung wird im Westen wenig Rechnung getragen; die Wirtschaftsgeschichte dreht sich um die Entwicklung der Technik und der Organisationsformen.
Anders in China: Hier ist der wirtschaftliche Prozess nie als autonom angesehen worden, sondern er wurde stets als in Wechselwirkung mit dem Staat stehend betrachtet. Es war deshalb selbstverständlich zu fragen, welche Auswirkungen eine konfuzianische oder legalistische Staatsphilosophie auf die Entwicklung hatte oder inwieweit die literarisch ausgebildeten Mandarine der Wirtschaft nützliche Institutionen zu schaffen imstande waren. Yantie lun, vordergründig eine Debatte über die Sinnhaftigkeit der Staatsmonopole für Salz und Eisen aus dem Jahre 81 vor Chr., ist den Chinesen wichtig als ein zentrales Dokument der Han-Zeit, in dem sich spiegelt, wie sich im Zusammenstoß der Staatsphilosophien das Staatsverständnis der Chinesen herausbildete, das dann bis zum Ende des Kaiserreichs – also während über 2000 Jahren – im Wesentlichen gültig blieb.
In diesem Text ökonomischen Fragen nachzugehen – ich hatte ihn vor gut 15 Jahren mithilfe von Sinologen als Faksimile eines Drucks von 1501 und mit einer Teilübersetzung im Rahmen der Klassiker der Nationalökonomie herausgegeben –, erschien zumindest den Teilnehmern dieses mehr geisteswissenschaftlichen Kolloquiums neu und aufschlussreich. Ich versuchte eine Gegenüberstellung mit den ungefähr zeitgenössischen Verhältnissen in der hellenistischen Antike.
Es wurde also nicht das Han-Reich mit dem Römischen Imperium verglichen, wie das häufiger geschieht, sondern mit dem individualistischen Erbe der sich weitgehend selbst verwaltenden Stadtstaaten, so dass die Korrespondenz verschiedener politischer Systeme mit der jeweiligen wirtschaftlichen Organisation deutlich hervortrat. Also wurden etwa die Liturgien (die halbwegs freiwillige Finanzierung einzelner militärischer und kultureller Projekte durch reiche Bürger auf Seiten Athens) und die reichsweite Besteuerung der Landwirtschaft in China miteinander verglichen.
Wenig Interesse an Marx
Das Gespräch über so verschiedene wirtschaftliche und politische Formen konnte frei erfolgen. Freilich, im Hintergrund erheben sich der Machtanspruch der Partei und die Dogmatik des chinesischen Marxismus, die eine kommunistische Zukunft aufgrund eines materialistischen Determinismus verheißen und zur stürmischen marktwirtschaftlich- kapitalistischen Entwicklung der Gegenwart in krassem Gegensatz stehen.
In der School of Economics wird die westliche Synthese von Neoklassik und Keynesianismus gelehrt. Der Versuch, eine geistige Brücke zu schlagen, indem ich Marx als Analytiker kapitalistischer Entwicklung und im Besonderen das Transformationsproblem zum Verständnis der Übergänge in der Wertlehre von der Klassik zur Neoklassik vorstellte, wurde mit Toleranz und Erstaunen zur Kenntnis genommen, aber nicht wirklich diskutiert. Das dogmenhistorische Wissen über die Phase der Ökonomieentwicklung, von der man denken sollte, dass sie für das chinesische Wirtschaftsverständnis besonders wichtig sein müsste, scheint erstaunlich gering, ja kaum erwünscht.
Schwierige Arbeitsbedingungen für europäische Forscher
Abschließend eine Bemerkung zu den Bedingungen wissenschaftlicher Arbeit. Man begegnet an der PKU überraschend vielen berühmten westlichen Wissenschaftlern. Sie verweilen meist nur für kurze Zeit an der Universität und halten Vorträge, die aufmerksam aufgenommen werden. Dieser sich günstig darstellende Austausch kontrastiert mit den Erfahrungen vieler in China fest angestellter westlicher Wissenschaftler. Für diese fand während der Zeit meines Aufenthalts eine von der Botschaft der Europäischen Union in Peking organisierte Tagung statt, an der untersucht werden sollte, weshalb so viel mehr chinesische Wissenschaftler im Ausland tätig sind als europäische in China.
Die Bedingungen, unter denen diese Forscher arbeiten, scheinen besonders für Geisteswissenschaftler recht ungünstig zu sein; auch die Regierung ist sich wohl bewusst, dass hier Reformen nötig wären. Man klagt, es seien die Rechtsvorschriften unklar, unter denen gearbeitet wird, man könne sein Gehalt nur zu geringen Teilen nach Europa zurücktransferieren, um da eine Altersversorgung aufzubauen, man werde, auch bei guten Chinesischkenntnissen, nur schlecht in die akademische Gemeinschaft der Dozenten integriert, und es sei schwierig, Forschungsprojekte adäquat zu finanzieren. Drastisch ausgedrückt:
Wer aus dem europäischen in das chinesische Prekariat floh, geriet vom Regen in die Traufe. Andererseits macht das Wissenschaftssystem als Ganzes, ebenso wie die Wirtschaft, den Eindruck eines sich überstürzenden Umbaus: der Wille, sich westliches Wissen anzueignen und dieses selbstständig weiterzuentwickeln, manifestiert sich deutlich und stark. Man ist stolz, nicht nur auf chinesische Geschichte und Errungenschaften, sondern auch auf die geschickte Übernahme und Fortentwicklung westlicher Technologien, und alle geben sich sehr zuversichtlich, dass der chinesische Einfluss zunehmen und sich verstärken werde. Wenn die in China angestellten westlichen Wissenschaftler nicht immer eine leichte Existenz haben, sind sie doch wenigstens Zeugen dieser Entwicklung.
Bertram Schefold ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Goethe-Universität.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 1.20 des UniReport erschienen.
Außerdem liegt die neue Ausgabe des UniReport an sechs Standorten in „Dispensern“ aus: Campus Westend – Gebäude PA, im Foyer / Treppenaufgang; Hörsaalzentrum, Ladenzeile; Gebäude PEG, Foyer; Gebäude RuW, Foyer; House of Finance, Foyer. Campus Riedberg – Gebäude N, Foyer vor Mensaeingang.