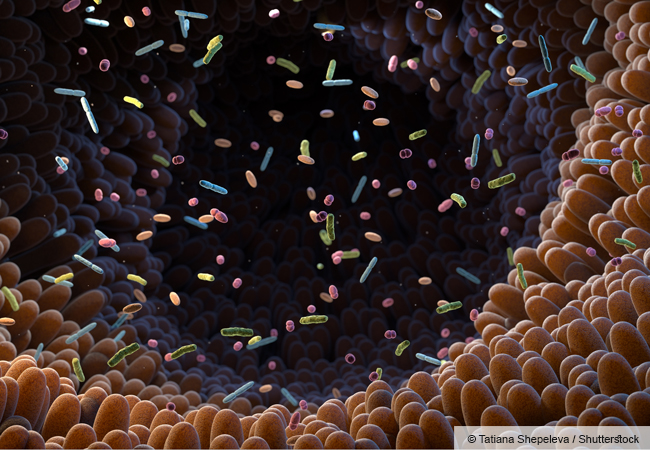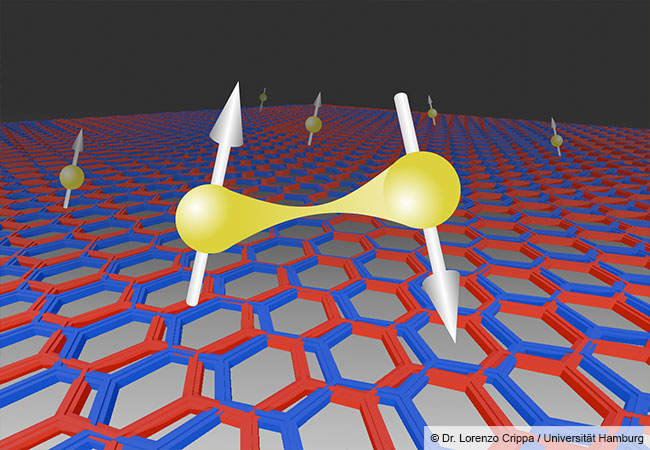Eine Sommeruniversität blickt aus postkolonialer Perspektive auf den Zusammenhang von Religion und europäischer Expansion.

Das Wort „postkolonial“ ist in den letzten Jahren wie kaum ein anderer Begriff aus der wissenschaftlichen in die gesellschaftliche Debatte übergegangen. In dieser populären Verwendung gerät oft Entscheidendes aus dem Blick: Postkoloniale Perspektiven zielen darauf ab, koloniale Phänomene und ihr Fortwirken insbesondere in ihrer Komplexität sichtbar zu machen. Sie zeichnen sich daher weniger durch einen eindeutigen Standpunkt als durch eine Vielfalt an Positionen, Methoden und Zugriffen aus. Für diese Mannigfaltigkeit postkolonialer Arbeitsweisen und ihrer Gegenstände zu sensibilisieren, ist eines der erklärten Ziele des Frankfurter Sommerkurses zur Geschichte der Frühen Neuzeit, der dieses Jahr unter dem Titel Religion postkolonial? steht. Die Summer School findet vom 24. bis zum 26. Juli an der Goethe-Universität statt und wird von den Historiker*innen Birgit Emich, Xenia von Tippelskirch und Michael Leemann organisiert.
Uneindeutigkeiten
Im Zentrum des Kurses steht die Epoche der Frühen Neuzeit, also grob die Zeit von 1500 bis 1800. Dieser zeitliche Zuschnitt hat seinen besonderen Reiz; schließlich stellt postkoloniale Geschichte oft auf die spätere Zeit ab dem 19. Jahrhundert scharf. Dies liegt nahe, handelt es sich hierbei doch um die Hochzeit des europäischen Imperialismus und des sich wissenschaftlich gebenden Rassismus. „Postkoloniale Studien haben nicht nur rekonstruiert, wie diese Prozesse abliefen und fortwirken, sie haben auch sichtbar gemacht, dass es selbst unter diesen Bedingungen kulturelle Verschmelzungen und Widerstand gab. Ich denke aber, dass diese Uneindeutigkeiten und auch eine gewisse Offenheit in der historischen Entwicklung noch besser sichtbar werden, wenn wir den Blick weiten und auf die Epoche vor dem 19. Jahrhundert schauen“, erläutert Birgit Emich, Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit und Principal Investigator beim Forschungsverbund Dynamiken des Religiösen.
Die Frühe Neuzeit ist nämlich einerseits die Zeit der sogenannten europäischen Expansion: Im Zuge der Erschließung neuer See- und Handelswege begannen die europäischen Mächte sukzessive, Gebiete auf anderen Kontinenten für sich zu beanspruchen und zu erobern. „Anderseits war die militärische Dominanz der Europäer in dieser Phase noch nicht ausgemacht. Auch waren ihre Interessen zum Teil noch anders gelagert als zur Blüte des Imperialismus“, erklärt Michael Leemann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der DFG-Kollegforschungsgruppe Polyzentrik und Pluralität vormoderner Christentümer (POLY). In Nordamerika beispielweise ging es der französischen Krone lange weniger um weitreichende territoriale Eroberungen als um die Errichtung lokal begrenzter Handelsstützpunkte. „Sicher betrachteten die Europäer die Indigenen auch in dieser Phase nicht als gleichwertig. Dennoch konnten sie ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus einer gesicherten Überlegenheit entgegentreten. So entstanden Räume der Begegnung, in denen keineswegs eindeutige Machtverhältnisse herrschten“, so Leemann weiter.
Exotisierende, nicht starr rassifizierende Blicke auf Indigene
Xenia von Tippelskirch, Professorin für religiöse Dynamiken und Co-Direktorin des Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales (IFRA-SHS) ergänzt: „Ich habe mich in meiner jüngeren Forschung unter anderem mit dem Besuch einer indigenen Delegation aus Französisch-Louisiana am Hof des französischen Königs im Jahr 1725 befasst. Die zeitgenössischen Berichte über diesen Besuch legen nahe, dass die Europäer zwar damals bereits einen stereotypisierenden und exotisierenden, aber noch nicht unbedingt starr rassifizierend-abwertenden Blick auf die Indigenen hatten.“ Die Besucher aus der „Neuen Welt“ konnten in der Debatte über europäische Dekadenz durchaus auch als positives Gegenbild fungieren. „Dennoch ist nicht zu vergessen, dass die indigenen Würdenträger nicht als ebenbürtige Herrscher eingeladen waren, sondern um Ludwig XV. zu huldigen.“
Ein zentraler Akteur der von von Tippelskirch untersuchten Begegnung ist der Jesuit, der die indigenen Besucher begleitete: Er vermittelte und übersetzte, verfolgte aber zugleich auch ordensstrategische Ziele. Er verweist damit auch auf den inhaltlichen Schwerpunkt der Summer School: die entscheidende Rolle, die Religion und religiösen Akteurinnen in der beginnenden Kolonialisierung zukam. Das Bewusstsein, christlich und damit überlegen zu sein, wie auch der Wunsch, das Christentum zu verbreiten, stellten Legitimationen für gewaltvolle Eroberungen dar. Religiösen Gruppen, insbesondere Orden, kam zudem eine strukturbildende Funktion zu, insofern in der Frühen Neuzeit religiöse und staatliche Macht eng verknüpft waren. Einige katholische Monarchien setzten gezielt Orden ein – so etwa die französische, die Jesuiten, Kapuziner und Ursulinen –, um ihre Herrschaft in den neuen Gebieten zu festigen. Schließlich verbreiteten die Orden nicht nur den „wahren Glauben“. Vielmehr waren sie auch ökonomisch aktiv, sammelten Wissen über die Indigenen und versuchten, sie zu treuen Untertanten zu erziehen.
Je nach Situation waren die Missionare aber durchaus darum bemüht, lokale Bräuche aufzugreifen und den Einheimischen ein attraktives und verständliches Angebot zu machen, z.B. indem sie auf das religiöse Vokabular der zu Missionierenden zurückgriffen. Bisweilen mussten sie sich sogar mit durch die Indigenen vorgenommenen religiösen Adaptionen arrangieren –, trotz ihrer engen Beziehungen zur kolonialen Macht stieß die frühneuzeitliche Mission also auch kulturelle Verschmelzungen an, die nicht immer einseitig zu steuern waren. Uneindeutig und für sie herausfordernd waren zudem Situationen, in denen Missionarinnen auf christliche Gemeinschaften trafen, die sich bereits zuvor und unabhängig von europäischer Intervention gebildet hatten. Dies war z.B. bei den sogenannten ‚Thomaschristen‘ in Südindien der Fall. Wie sollte man sich diesen autochthonen Christinnen gegenüber verhalten? Waren sie als gleichwertig anzuerkennen? Diese Begegnungen geben damit nicht nur einen Einblick in die anthropologischen Fragen, die frühneuzeitliche Missionarinnen beschäftigten. Vielmehr verweisen sie auch auf deren Zusammenhang mit weiterreichenden Entwicklungen der Epoche.
Ambivalenz der Religion
Denn auch bei der grundsätzlichen Frage, welcher Status nicht europäischen Menschen zuzubilligen war, spielten Religion und religiöse Akteurinnen eine prägende und ambivalente Rolle. Auf der einen Seite gehörten Missionarinnen zu den frühesten Kritikerinnen der transatlantischen Versklavung. Auf der anderen Seite, erklärt Michael Leemann, trieb sie die Frage um, inwiefern Nicht-Europäerinnen vollwertige Christinnen sein konnten. „Ich habe mich in meiner Forschung mit der Herrnhuter Mission in der dänischen Karibikkolonie beschäftigt. In den Missionsberichten wird deutlich, dass Missionarinnen die Ansicht vertraten, dass das ,Heidentum‘ unter Schwarzen Menschen gleichsam vererbt werde, weshalb sie selbst als Getaufte keine gleichwertigen Christinnen sein könnten. Die Bedeutung von religiösen Debatten ist für die Geschichte von Rassismus nicht zu unterschätzen.“
Diese und verwandte Probleme wollen die Wissenschaftlerinnen in drei intensiven Tagen mit rund 30 Studierenden und Doktorandinnen und fünf etablierten Expertinnen aus Deutschland und der Schweiz diskutieren. Dieser Statusgruppen übergreifende Austausch hat mittlerweile Tradition: Birgit Emich organisiert seit Jahren Sommerkurse zur Geschichte der Frühen Neuzeit mit wechselnden Themen, in den letzten Jahren mit Unterstützung der Mitglieder der von ihr geleiteten Kollegforschungsgruppe POLY. Auch inhaltlich baut der Sommerkurs auf Vorangegangenem auf. 2023/24 fand schon ein Seminar zu Mission statt und im Februar 2023 die durch Emich mitorganisierte Tagung The Christian Mission and the Religious Other. „Beim Sommerkurs ist es uns ein besonderes ein Anliegen, dass die Teilnehmer*innen vom Standort Frankfurt profitieren. Daher lassen wir uns durch Kerstin von der Krone die Hebraica- und Judaica-Sammlung der Bibliothek zeigen und besuchen mit Anne Schumann-Douosson das Koloniale Bildarchiv, das ebenfalls Bestand der universitären Sammlungen ist“, fügt Emich an.
Wie kommen Archive, Quellen und Dokumente zustande?
Zur „Halbzeit“ wagt der Kurs sogar einen Ausflug in die Zeitgeschichte: In Kooperation mit dem Kino Mal seh’n und dem IFRA-SHS wird der belgische Dokumentarfilm Colette & Justin gezeigt, der sich mit dem Ende der Kolonialzeit im Kongo auseinandersetzt. „An dem Film reizt mich“, erläutert Xenia von Tippelskirch, die auch in den Film einführt, „dass die Grenze zwischen Gut und Böse, zwischen Täter und Opfer nicht eindeutig zu ziehen ist, wie der Regisseur, der seine eigene Familiengeschichte aufarbeitet, schmerzvoll feststellen muss. Außerdem weist der Film auf ein generelles Problem hin, das mich in der Auseinandersetzung mit Kolonial- und Missionsgeschichte beschäftigt: Wie kommen die Archive, die Quellen und Dokumente, aus denen wir die Geschichte rekonstruieren, zustande? Wie kann es gelingen, die Stimmen der Indigenen und Versklavten hörbar zu machen?“ Dieses Anliegen bleibt eine Aufgabe für zukünftige Forschung.
Louise Zbiranski ist Referentin für Wissenschaftstransfer und -kommunikation beim Forschungsverbund »Dynamiken des Religiösen« und koordiniert die Arbeit der »Schnittstelle Religion«.