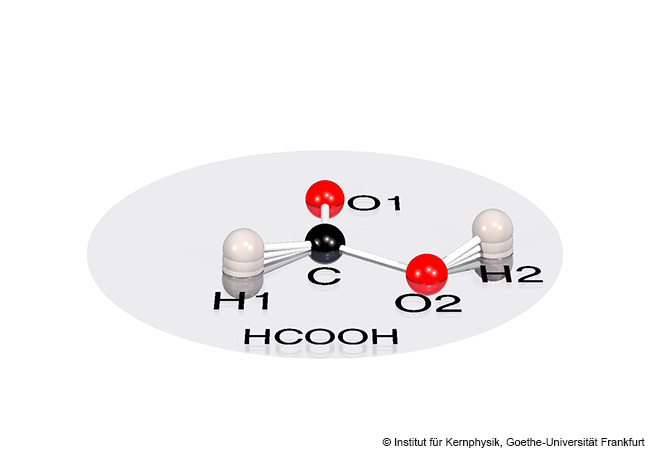Johannes Völz, Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität, zeigt sich angesichts des sich abzeichnenden Wahlergebnisses nur wenig überrascht; Prognosen hätten durchaus darauf hingedeutet, dass ein republikanischer Erdrutschsieg nicht sehr wahrscheinlich sei. Biden gehe gestärkt aus dieser Wahl hervor, und zwar unabhängig davon, ob die Macht über das Repräsentantenhaus am Ende bei den Republikanern oder Demokraten landet. Seiner Einschätzung nach war es nicht nur ein Referendum über Präsident Biden, sondern auch ein Referendum über den vorigen Präsidenten, Donald Trump. “Wer von sich behauptet, trotz Wahlniederlage der eigentliche, rechtmäßige Präsident zu sein, der muss sich auch gefallen lassen, eine Midterm-Wahl zu verlieren – ganz ohne offiziell ein Amt zu haben.“
Herr Völz, noch steht das finale Ergebnis der Kongresswahlen nicht fest, aber zumindest wissen wir mittlerweile, dass die Demokraten die Kontrolle im Senat behalten haben und es keine „rote Welle“ des Trump-Lagers gab. Ein überraschendes Ergebnis?
Johannes Völz: Das Ergebnis erleichtert mich, aber nüchtern betrachtet überrascht es mich nicht. Ich bin kein Wahlforscher, sondern studiere die politische Kultur der USA. Auch ich musste mich also an den allgemein zugänglichen Umfragewerten und Prognosen orientieren. Und die sagten voraus, dass der Ausgang der Senatswahlen völlig offen sei und bei den Wahlen des Repräsentantenhauses zwar republikanische Gewinne zu erwarten seien, aber keinesfalls ein Erdrutschsieg. Fünf bis zwanzig gewonnene Sitze für die Republikaner – das war eine der plausibleren Prognosen. Und das könnte durchaus mit dem Endergebnis übereinstimmen, wir werden es sehen. Es kann aber auch sein, dass die Demokraten am Ende auch das Haus unter ihrer Kontrolle behalten werden. Wir sprechen hier über minimale Verschiebungen, die über Macht oder Machtverlust entscheiden.
Überraschend scheint ja doch zumindest die Tatsache, dass Präsident Biden als Amtsinhaber trotz niedriger Popularitätswerte nicht abgestraft worden ist. Bei den Zwischenwahlen in den letzten Wahlperioden hatte die Partei des Präsidenten ja meist herbe Verluste zu verzeichnen.
Das ist ganz richtig. Wir müssen uns nur die Midterms 1994 unter Clinton, 2006 unter George W. Bush, 2010 unter Obama oder 2018 unter Trump in Erinnerung rufen: jedes Mal bekam die Partei des Präsidenten ordentlich eins auf die Mütze und verlor die Macht in zumindest einer Kongress-Kammer. All diese Zwischenwahlen waren Referenden über den jeweiligen Präsidenten. Diesmal war es aber anders – und das macht diese Wahlen besonders: diesmal war es nicht nur ein Referendum über Präsident Biden, sondern auch ein Referendum über den vorigen Präsidenten, Donald Trump. Trump hatte sich sehr in den Vordergrund gespielt, indem er die Frage nach der Legitimität der von ihm verlorenen Wahl 2020 zur Gretchenfrage für republikanische Kandidatinnen und Kandidaten machte. Also: wer seine Lüge über die angeblich gestohlene Wahl von 2020 nachbetete, konnte davon ausgehen, im Wahlkampf seine Unterstützung zu bekommen. Wer dieser Lüge widersprach oder sich auch nur enthielt, musste in Kauf nehmen, vom Trump-Lager als „Rino“ – als Republican in name only – verunglimpft und bekämpft zu werden. Hinzu kommt noch, dass Trump kurz vor der Wahl ankündigte, seine Entscheidung über eine Kandidatur für 2024 bekanntgeben zu wollen. Bei so viel Aufmerksamkeit auf Trump wurden die Midterms 2022 zur Trump-Wahl. Das ist durchaus eine ironische Pointe: wer von sich behauptet, trotz Wahlniederlage der eigentliche, rechtmäßige Präsident zu sein, der muss sich auch gefallen lassen, eine Midterm-Wahl zu verlieren – ganz ohne offiziell ein Amt zu haben.
Wie lässt es sich denn erklären, dass die Wahl in den USA so knapp ausfiel?
Das ist eine wirklich interessante Frage. Die knappen Ergebnisse der Wahlen in den USA sind erklärungsbedürftig, genauso wie die Effekte, die diese engen Wahlergebnisse auf den politischen Betrieb in Washington und die gesamte politische Kultur der USA haben. Die USA haben sich auf ein äußerst stabiles Gleichgewicht der politischen Kräfte eingependelt. Das lässt sich zurückverfolgen bis in die Tage Reagans. Beide Parteien können sich bei Kongresswahlen seitdem darauf einstellen, zwischen 47 und 53 Prozent der Stimmen zu erhalten. Wirkliche Erdrutschsiege gibt es praktisch nicht mehr. Schon die Wahlen vor zwei Jahren hatten ja ein extrem knappes Ergebnis, jedenfalls im Kongress. Diesmal ist es sogar noch enger. Im Senat wird es zu einer nahezu ausgeglichenen Sitzverteilung kommen, entweder 50-50, oder 51-49. Also auch hier im Grunde eine Bestätigung des gegenwärtigen 50-50-Patts. Dass diese engen Abstände mittlerweile zu einem Muster geworden sind, ist deshalb so erstaunlich, weil sich die Politik in den USA alles andere als in ruhigen Gewässern befindet. Ganz im Gegenteil: Die Republikaner haben sich nicht erst seit Trump schrittweise immer weiter in eine Richtung bewegt, die Gepflogenheiten und Grundgewissheiten der Demokratie über Bord wirft. Auf das Wahlergebnis scheint das aber praktisch keinen Einfluss zu haben. Am Ende steht es wie immer 50-50.
War das denn jemals anders – oder ist dieses Kräftegleichgewicht zwischen Demokraten und Republikanern Ausdruck des Zwei-Parteiensystems?
Von den 1930ern bis zu den 1980ern hatten die Demokraten ein ganz klares Übergewicht – Demokraten und Republikaner waren schlicht nicht auf Augenhöhe. Insbesondere der Süden war praktisch eine Einparteienlandschaft und fest in der Hand der Demokraten. Diese Treue des Südens zu den Demokraten hatte historische Gründe, die zurückreichen in die Zeit der Sklaverei. Damals waren die Demokraten die Partei der Südstaatler – sprich: Sklavenhalter – gewesen. Weiße Südstaatler blieben dann auch im Verlauf des 20. Jahrhunderts den Demokraten treu und machten einen wichtigen Bestandteil der so genannten New Deal-Koalition aus. Diese breite Allianz, die völlig unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Schichten quer durch das Land zusammenbrachte, sorgte dafür, dass die Demokraten fast ein halbes Jahrhundert lang beide Kammern des Kongresses fest in ihrer Hand hielten und auch zwei Drittel der Zeit den Präsidenten stellten. Also eine vollkommen andere politische Landschaft als das, was uns heute als selbstverständlich erscheint.
Wie kam es zur heutigen Situation der engen Wahlergebnisse?
Die New Deal-Koalition begann in den 1970er Jahren zu zerbrechen, als sich die Demokratische Partei hinter die Bürgerrechtsbewegung stellte. Da zogen die Südstaaten-Demokraten nicht mit – sie wanderten zu den Republikanern. Das passierte aber auch nicht auf einen Schlag. Vollzogen war das sogenannte „great realignment“ erst um 1980. Und es dauerte bis 1994, bis die Republikaner den Kongress für sich gewannen.
Sie sagen, die Republikaner hätten sich schrittweise radikalisiert. Wie erklärt sich, dass das Kräftegleichgewicht trotzdem bestehen bleibt? Radikalisiert sich die Wählerschaft der Republikaner im Gleichschritt mit der Partei?
Es scheint so, als gäbe es zwischen Parteien und Wählern Push- und Pull-Faktoren, also eine gegenseitige Wechselwirkung, die die amerikanische Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte hinweg immer weiter polarisiert hat. Auf der einen Seite waren die Republikaner in den 1970ern und 1980ern sehr geschickt darin, einen gesellschaftlichen Backlash gegen die Veränderungen der Sechzigerjahre für sich zu nutzen. Civil Rights Movement, Frauenbewegung, Schwulenbewegung, dazu noch die kulturelle und sexuelle Revolution der so genannten Gegenkultur – das rief reaktionäre Kräfte auf den Plan, die die Republikaner systematisch abschöpften. Erst dadurch wurde die Partei auf nationaler Ebene kompetitiv. Auf der anderen Seite führte der neue Wettbewerb der Parteien dazu, dass diese selbst immer schriller und radikaler auftraten, weil sie sich immer stärker voneinander abheben mussten. Und gerade weil in so einer Situation schon abzusehen ist, dass die geringfügigen Machtverschiebungen nach einer Wahl nicht von Dauer sein werden, wird Wahlen eine geradezu existentialistische Bedeutung zugeschrieben. Immer steht der mögliche Verlust vor der Tür – nicht nur der Verlust der Wahl, sondern der Verlust von all dem, was man gerade mühsam erreicht hat. So wird jede Wahl zu einer Richtungswahl stilisiert, mit immer dem gleichen Ergebnis: die Veränderungen im Gleichgewicht der Sitze sind minimal, zugleich aber von größter Tragweite, denn sie entscheiden – wenn auch nur kurzfristig – darüber, wer die Macht verliert und wer sie gewinnt. Mit anderen Worten: das Gleichgewicht der Parteien bringt nicht etwa gesellschaftliche Ausgeglichenheit hervor, sondern Polarisierung und Radikalisierung. Hier sind zunächst die Parteien das Zugpferd. Aber zu einem gewissen Grad nimmt die Bevölkerung diese Tendenzen der Spaltung und Radikalisierung auf.
Aber trifft das auch auf diese Wahl zu? Sie sagten ja, dass diese Wahl ein Referendum über Trump war, und dass er der große Verlierer ist.
Das stimmt, es sieht in der Tat so aus, als ob die Wähler viele der von Trump gestützten Kandidatinnen und Kandidaten abgelehnt haben, wenn nicht sogar abgestraft – wie im Falle von Doug Mastriano, der als Trumpist um den Gouverneurs-Posten von Pennsylvania kämpfte und 14 Prozentpunkte weniger erhielt als Josh Shapiro, sein Konkurrent der Demokraten. Mittlerweile wissen wir auch, dass in den einzelnen Staaten bei den Rennen um die Posten, die über das Wahlverfahren wachen, die Trumpisten durchweg gescheitert sind. Aber so sehr mich das im Hinblick auf die Stabilität der amerikanischen Demokratie freut: es ist keinesfalls so, dass das Land nun auf einmal wieder zusammenwachsen wird und die Polarisierung ein Ende finden wird. Denn dieses Wahlergebnis passt durchaus zum beschriebenen Polarisierungsprozess. Es gibt in ihm immer wieder Punkte, an denen sich die Partei zu sehr von der breiten Wählerschaft entfernt, weil die Radikalisierung in der Partei eine Art Eigendynamik entfacht.
Die republikanische Partei wurde sehr stark getrieben von der MAGA-Bewegung Trumps. Diese Fraktion macht zwar nur ungefähr 25 Prozent der Unterstützer der Republikaner aus, aber sie ist besonders aktivistisch eingestellt. Und sie engagiert sich bei Vorwahlen, hat also dafür gesorgt, dass einige Kandidatinnen und Kandidaten auf den Wahlzettel kamen, die zwar Trumps Unterstützung hatten, aber kaum konsensfähig waren. Die Demoskopen der New York Times haben sogar gezeigt, dass die Demokraten in just denjenigen Staaten und Wahlkreisen starke Gewinne eingefahren haben, in denen es darum ging, radikale Republikaner abzuwehren. Insbesondere solche, die durch die Blume versprochen hatten, zukünftige demokratische Wahlen zugunsten der Republikaner zu verfälschen.
Dort, wo solche radikalisierten Republikaner nicht zur Wahl standen, haben die Demokraten ernstzunehmende Verluste hinnehmen müssen – etwa im Staat New York. Um diesen Befund zurückzubinden an die größere Polarisierungsdynamik, die wir in den USA seit den 1990er beobachten: man kann diese Wahl als ein Votum für eine neue Austarierung des republikanischen Lagers begreifen. Die republikanische Partei bekommt das Signal, dass sie ein bisschen zu schrill geworden ist. Sich darauf einzustellen bedeutet noch lange nicht, zu einer Partei des Ausgleichs und Kompromisses zu werden.
Ließe das darauf schließen, dass sich die Republikaner in Zukunft vom Trumpisten-Lager verabschieden und moderatere Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen schicken?
Das könnte so sein, es ist aber noch zu früh, Trump ad acta zu legen. Innerhalb der republikanischen Partei hat das Trump-Lager noch immer viel Macht, und es ist nicht so, dass diese Wahl nicht auch eine beträchtliche Zahl von Trumps Gefolgsleuten ins Abgeordnetenhaus brächte. Da sind zahlreiche Leute dabei, die die Lüge vom Wahlbetrug verbreiten und ganz und gar auf schrille Töne setzen. Auf der anderen Seite haben sich seit der Wahl einige einflussreiche Republikaner zu Wort gemeldet und gefordert, die Partei müsse sich nun von Trump losmachen. Da waren einige bekannte Trump-Gegner dabei, etwa der Abgeordnete Adam Kinzinger aus Illinois, aber auch – und das ist sehr viel interessanter – Trump-Vertraute wie Newt Gingrich. Hinzu kommt, dass Trumps größter parteiinterner Konkurrent innerhalb der republikanischen Partei, Ron DeSantis, mit großem Erfolg seinen Gouverneurs-Posten in Florida verteidigt hat. DeSantis ist alles andere als ein Moderater, aber er ist nicht ganz so radikal wie Trump, und zwar insbesondere nicht in den beiden Punkten, die bei der Wahl zu den größten Verlusten der Republikaner geführt haben: weder ist zu befürchten, dass er systematisch demokratische Wahlen delegitimieren und subvertieren will; noch möchte er das Recht auf Abtreibung ganz abschaffen. Er ist also für den gegenwärtigen Moment perfekt aufgestellt: ein Polarisierungspolitiker, der geradezu genüsslich den Kulturkampf anheizt, aber andererseits jemand, der sich nicht so weit von der breiten Wählerschaft entfernt hat wie die radikalen Trumpisten.
Wie dürften die Wahlergebnisse bei den Demokraten aufgenommen werden? Rechnen Sie damit, dass Biden ernsthaft in Erwägung zieht, bei der nächsten Präsidentschaftswahl nochmal anzutreten?
Biden geht auf jeden Fall gestärkt aus dieser Wahl hervor, und zwar unabhängig davon, ob die Macht über das Repräsentantenhaus am Ende bei den Republikanern oder Demokraten landet. Er wird sich damit schmücken, dass er die von den Republikanern angekündigte „rote Welle“ verhindert habe. Ob er 2024 antritt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Für die Demokraten wäre das eine Hypothek. Nicht, weil Biden schlechte Politik gemacht hätte. Er hat ja durchaus ansehnliche Vorhaben umgesetzt bekommen. Man denke an den Inflation Reduction Act, der in Wirklichkeit vor allem ein Programm für erneuerbare Energien und Klimaschutz ist, mit einem Volumen von knapp 400 Milliarden Dollar allein für dieses Thema. Aber man traut ihm schlicht nicht mehr zu, dass er noch die Kraft hat, dieses Amt überzeugend auszufüllen. Bei jedem öffentlichen Auftritt haben die Leute Angst, dass ihm ein rhetorisches Missgeschick passiert. Das passt denkbar schlecht in die Performance-fixierte Kultur der USA. 2024 wäre nach meiner Einschätzung ein passender Zeitpunkt für die Übergabe an jemanden aus der jüngeren Generation. Aber Biden kann das nicht zu früh ankündigen, sonst handelt er sich doch noch ein, was er mit dem Wahlergebnis abgewendet hat: er würde zur „lahmen Ente“.
Worauf muss sich Europa eventuell einstellen, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine? Könnte die bislang starke Unterstützung der Ukraine seitens der USA schwinden?
Biden selbst wird seine Linie, glaube ich, nicht ändern wollen. Hier kommt es nun wirklich aufs Wahlergebnis an. Wenn beide Kammern bei den Demokraten bleiben, dann wird das Wahlergebnis auch den bisherigen Kurs in Sachen Unterstützung der Ukraine legitimieren. Falls das Haus an die Republikaner fällt, ist auch noch nicht so klar, was das eigentlich bedeutet. Denn dann stellt sich immer noch die Frage, wie viel Macht die Trumpisten – die Putin nahestehen – innerhalb der Republikanischen Partei haben werden. Mit anderen Worten: die zukünftige Linie der USA in Sachen Ukraine ist noch nicht ganz absehbar, aber ich rechne momentan nicht mit einem drastischen Kurswechsel.
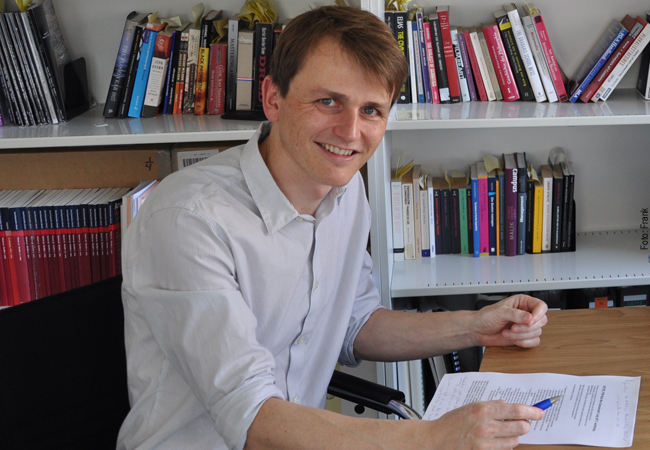
Johannes Völz ist Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt „Demokratie und Ästhetik“ an der Goethe-Universität. Von September 2022 bis August 2023 forscht er als Senior Research Fellow am Käte-Hamburger-Kolleg for Global Cooperation Research an der Universität Duisburg-Essen.