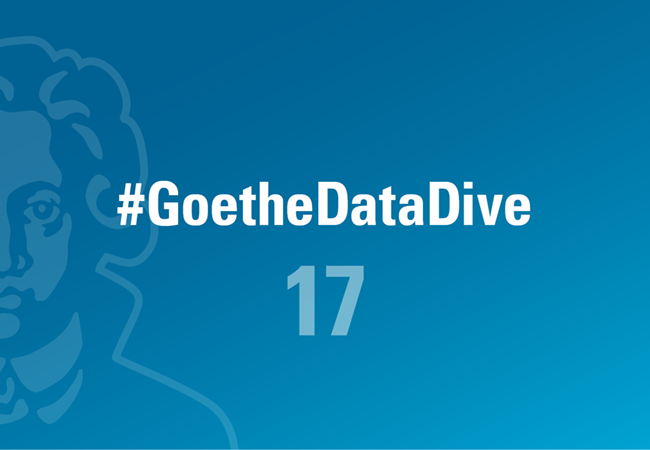Unter dem Titel “Diskursräume gestalten“ veranstaltet die Goethe-Universität im November universitätsweite Wochen zu Rassismus und Antisemitismus. Eröffnet wurden sie am 5. November von dem muslimisch-jüdischen Paar Saba-Nur Cheema und Meron Mendel in einem Podiumsgespräch über die Polarisierung in der deutschen Nahost-Debatte.

„Machen wir uns nichts vor“ – in ihrer Eröffnungsrede sprach Prof. Sabine Andresen Klartext. Rassismus und Antisemitismus, so die Vizepräsidentin der Goethe-Universität, seien tief verwurzelt in der Gesellschaft und also auch an unserer Hochschule kein Ausnahmefall. Eine Verständigung zwischen verschiedenen Positionen sei alles andere als ein Selbstläufer, der Dialog schwierig. Umso mehr zu begrüßen sei die Initiative von Dr. Thuy Loan Nguyen und Dilara Kanbiçak, die beide im Büro für Chancengerechtigkeit zu Diversity Policies arbeiten und die Wochen organisiert haben. Sie hatten in die Universität hineingefragt und Veranstaltungen gebündelt; Angebote von Menschen, die ein Bewusstsein für Diskriminierung schaffen und Empathie fördern wollen. Zum Beispiel mit Vorträgen zu Antisemitismus, mit Podiumsdiskussionen wie etwa über Stereotype gegenüber Regionen der Welt am Beispiel Afrikas in Deutschland, mit Workshops über diskriminierungsfreie Lehre und Empowerment-Workshops für Studierende mit Rassismuserfahrung. Bei der Veranstaltungsreihe ging es den Kuratorinnen der Reihe vor allem auch darum, die Themen Rassismus und Antisemitismus zusammenzubringen.
Die Eröffnung der universitätsweiten Wochen haben Thuy Loan Nguyen und Dilara Kanbiçak selbst in die Hand genommen – und die prominenten Referenten Saba-Nur Cheema und Meron Mendel zum Gespräch geladen. Thema: „Über die Polarisierung in der deutschen Nahost-Debatte. Wie kann der Diskurs besser laufen?“ Saba-Nur Cheema ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität und forscht zu Antisemitismus in der Kindheit. Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und seit 2021 zudem Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Das Paar engagiert sich seit Jahren und besonders seit dem 7. Oktober 2023 für einen jüdisch-muslimischen Dialog und gegen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Cheema und Mendel sind in Moscheen und Unternehmen, in Universitäten, Kultureinrichtungen, Schulen und Gemeinden zu Gesprächen unterwegs und schreiben gemeinsam die monatliche Kolumne „Muslimisch-Jüdisches Abendbrot“ in der FAZ.
„Alle zeigen sich betroffen, alle sind enttäuscht“
Der muslimisch-jüdische Dialog ist schwierig – genauer, er erscheint nahezu unmöglich. Davon berichtete auch Saba-Nur Cheema im Rahmen der gemeinsamen Arbeit mit Mendel als Kuratoren von Kulturveranstaltungen. Kaum habe eine Referent*in einer bestimmten Position für ein Panel zugesagt, ziehe sich ein Referent aus einem „anderen Lager“ zurück. Werde dann eine neue Person gewonnen, setze sich das Karussell der Zu- bzw. Absagen fort. Warum der Dialog oft gar nicht erst in Gang komme, die Gräben zwischen muslimischer und jüdischer Communities immer tiefer würden – einen Grund dafür sieht Meron Mendel in der Selbstbezogenheit vieler, die sich zu Wort meldeten. Wer ein hermetisch geschlossenes Narrativ über die Ereignisse im Nahostkonflikt im Kopf habe, bringe sich in die Debatte nur mit dem Ziel ein, die eigene Position zu bestätigen. Zudem habe die Diskussion über den Nahostkonflikt zunehmend eine soziale Funktion erfüllt: Sie schaffe Peergroups etwa in sozialen Medien, in denen Menschen soziale Heimat fänden. „Vielen Personen der Gruppe ist dann der Zusammenschluss mit der Gruppe wichtiger als die eigene Meinung“, sagt Mendel. Es herrsche ein hoher Konformitätsdruck, der für Künstler*innen ebenso gelte wie für alle anderen, die sich in den Communities wohlfühlten.
Dass zudem „Betroffenheit“ als Argument in der Debatte gelte, schränke die Möglichkeiten von Verständigung weiter ein. „Alle zeigen sich betroffen, alle sind enttäuscht“, sagt Saba-Nur Cheema, die wie ihr Mann in der gesamten Konfliktregion Familie und Freunde hat. „Aber nein, meistens sie sind nicht wirklich betroffen!“ Auch ihr selbst und ihrem Mann gehe es trotz vieler schlafloser Nächte gut im Vergleich zu denen, die in der Konfliktregion lebten. Das Privileg, als nicht unmittelbar Betroffene Zeit zum Nachdenken über einen hochkomplexen und -komplizierten Konflikt zu haben, werde hierzulande nicht wahrgenommen. „Es wird viel zu schnell Partei ergriffen“, meint auch Meron Mendel. Was für das Gegenüber bedeute, dass im Gespräch nicht zugehört oder auch überzeugt werden solle, sondern „ausgeschlossen, vernichtet, ausgegrenzt, zum Verstummen gebracht“.
„Wir müssen mehr über die Grautöne sprechen“
Wenn die Debatte auf der Ebene der Betroffenheit nicht weiterführe, „was kann Dialog dann überhaupt bedeuten?“, fragt Dilara Kanbiçak in ihrer klugen Moderation der Veranstaltung in der PA-Lobby der Goethe-Universität, zu der mehr als hundert Interessenten gekommen sind. Muslimisch-jüdische „Wohlfühlprojekte“ wie gemeinsames Tandemfahren, Kochen und Fußballspielen führten nur dann zu Verständigung, daran lassen Kanbiçaks Gesprächpartner keine Zweifel, wenn gleichzeitig über den Elefanten im Raum – den gemeinsamen Konflikt – gesprochen würde. Dabei dürften alle Beteiligten nicht zu harmoniebedürftig sein, beziehungsweise ihre eigene Verletzlichkeit nicht zum alleinigen Maßstab eines gelingenden Gesprächs erklären, meint Mendel. „Auch auf einem Campus muss man sich entscheiden: Will man – dann aber für alle – einen safe space? Oder will man einen offenen Raum für Streit und Diskussionen?“, fragt Mendel. „Dann kann man sich auch mal verletzen. Das muss man in Kauf nehmen. Nicht zu verletzen geht nicht.“ Ein auf diese Weise ausgetragener Streit sei dennoch respektvoll möglich. Für sie selbst seien etwa folgende vier Regeln die Basis jeder Diskussion, erklärt Cheema: „Weder das Existenzrecht des Staates Israel noch das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat sollen in Frage gestellt werden. Die Gesamtschuld für den Konflikt auf die Schultern einer Partei zu legen, ist per se falsch. Auch verbieten wir uns jeglichen Vergleich zwischen dem Handeln des israelischen Staates und den Nazis – genauso wie jede andere Form von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus. Über alles andere kann gestritten werden.“
Der muslimisch-jüdische Dialog ist schwierig – und doch gebe es ihn schon, betont Saba-Nur Cheema. In Israel werde er etwa in acht jüdisch-arabischen Schulen täglich gelebt. Auch hierzulande würde viel zu wenig über die friedlichen Kräfte auf beiden Seiten berichtet. „Wir müssen mehr über die Grautöne sprechen“, sagt Cheema. Vorbildhaft in diesem Sinne gewesen seien etwa die Arbeiten des israelischen Psychologen Dan Bar-On gemeinsam mit dem palästinensischen Erziehungswissenschaftler Sami Adwan. Ihr israelisch-palästinensisches Geschichtsbuch für Schüler*innen war dreispaltig angelegt: die Spalten links und rechts jeweils der Darstellung historischer Ereignisse aus palästinensischer bzw. israelischer Sicht vorbehalten („was für den einen ein Glücksfall war, war für den anderen eine Katastrophe“). In der Mitte dann: ein leerer Raum für Kommentare der Schüler*innen, für eigene Gedanken. Und wenn heute, erklärt Cheema, eine Lehrerin in einer gründlich vorbereiteten Unterrichtsstunde über den Nahostkonflikt von einem Schüler mit dem Hinweis „Das geht doch schneller!“ auf einen 90-Sekunden-Clip bei TikTok zum Thema unterbrochen werde – ja, dann, sagt sie, dann müsse man eben mit Influencer*innen in Kontakt treten. Und sie dafür gewinnen, facettenreich über den Nahostkonflikt berichten. Diese Anstrengung lohne sich.
Wie der muslimisch-jüdische Dialog vor dem Hintergrund der Polarisierung in der deutschen Nahost-Debatte besser laufen könne, hatte der Titel der Podiumsdiskussion gefragt. Beispielsweise so, wie die Zuschauer das gemeinsame Gespräch von Saba-Nur Cheema und Meron Mendel erlebten. Der Diskursraum wurde von diesen auf bedachte und anregende Weise eröffnet.