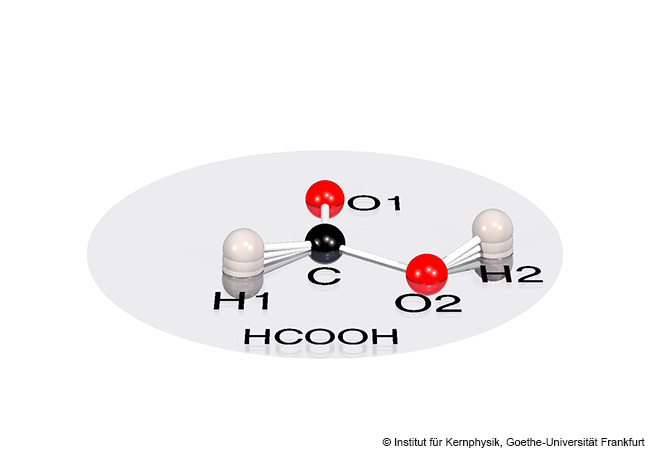UniReport: Frau Prof. Deitelhoff, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HSFK veröffentlichen regelmäßig Policy- Papiere, bloggen und twittern zu aktuellen Themen, sind häufig in den Medien präsent oder organisieren öffentliche Veranstaltungen mit Praxispartnern im Rhein-Main-Gebiet oder auch in Brüssel. Kommt bei so vielen Aktivitäten nicht die Forschung zu kurz?
Nicole Deitelhoff: Die Balance zwischen Forschung und Wissenstransfer ist in einem Institut wie unserem ein Dauerthema. Gerade unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler wollen sich qualifizieren für Hochschullehrerpositionen und dafür spielt der Wissenstransfer – leider – nach wie vor nur eine sehr nachgeordnete Rolle. Als Leibniz- Institut sind wir unserem Motto verpflichtet: Theoria cum praxi und das gilt für uns nochmal mehr, da wir ein Friedensforschungsinstitut sind. Darum legen wir großen Wert darauf, Grundlagenforschung und Wissenstransfer miteinander zu verknüpfen. Um das zu erreichen, bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig Trainings und Fortbildungen an und wir versuchen, eine Umgebung zu schaffen, in der beides, Grundlagenforschung und -transfer, gut und einträchtig gedeihen können.
Ist es für ein Institut der Grundlagenforschung wichtig, in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein?
Für ein Leibniz-Institut gehört das zum Forschungsauftrag untrennbar dazu. Wir machen Grundlagenforschung für die und im Auftrag der Gesellschaft. Darüber hinaus lernen wir auch immens viel durch die beständige Interaktion mit der Gesellschaft: Wir erhalten neue Einblicke in unseren Forschungsgegenstand, wenn wir die Problemwahrnehmungen in der Gesellschaft kennenlernen. Das hilft uns, unsere Fragen zu schärfen, bessere Instrumente für unsere Analysen zu finden und unsere Erkenntnisse einzuordnen.
Denken Sie an den Dialog mit der Praxis, wenn Sie Ihre wissenschaftlichen Projekte planen oder haben politikwissenschaftliche Projekte immer einen Praxisbezug?
Nein, das tue ich nicht bei allen Projekten. Es gibt Forschungsprojekte, die sich aus der innerwissenschaftlichen Debatte und Logik, aus einer grundlegenden wissenschaftlichen Irritation ergeben, die zunächst wenig mit Praxis zu tun haben. Das muss auch so sein, weil wir, wenn wir den Blick zu starr auf die Praxis und auf die Anwendung unserer Forschung richten, auch Gefahr laufen, wichtige Fragen aus den Augen zu verlieren. In vielen Fällen müssen wir verstehen, wie bestimmte Zusammenhänge aussehen und wie sie funktionieren, bevor wir darüber nachdenken können, was uns das für die gesellschaftliche Praxis sagt. Umgekehrt gibt es auch immer wieder eine Reihe von Projekten, die von Beginn an an politischen Entwicklungen ansetzen und konkrete Fragen beantworten wollen, also direkt an Anwendungsfragen ansetzen.
Erleben Sie bei Ihrem Praxisengagement auch Situationen, in denen Sie als Wissenschaftlerin keine Antwort parat haben?
Andauernd – zumindest nicht die gewünschte Antwort. Das liegt daran, dass die Öffentlichkeit häufig überschätzt, welche Art von Wissen die Friedens- und Konfliktforschung, aber auch die sozialwissenschaftliche Forschung allgemeiner liefern kann. Die häufige Erwartung, dass wir konkrete Vorhersagen treffen können (wird ein konkreter Putsch niedergeschlagen? Wird und wann wird das Minsk-Abkommen für die Ostukraine durchgesetzt? Oder auch: Hat Putin wirklich Interesse daran?), können wir nicht erfüllen. Wir bieten Orientierungswissen an.
Sie bilden seit mehreren Jahren den Diplomatennachwuchs im Auswärtigen Amt aus. Wie können wir uns dies vorstellen?
Das sind jeweils mehrere Wochen im Sommer/ Herbst mit einem Intensivkurs, den ich gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Daase unterrichte. Wir versuchen, den angehenden Diplomatinnen und Diplomaten genau dieses Orientierungswissen mitzugeben. Wir entwickeln mit ihnen Analyseraster, die ihnen helfen sollen, politische Entwicklungen analytisch einschätzen zu können und begründete Handlungsempfehlungen auszusprechen, und wir trainieren beispielsweise Verhandlungskompetenzen. Das alles basiert immer auf Erkenntnissen, die wir aus der Grundlagenforschung mitbringen, die wir dann aber für die praktischen Probleme zuschneiden, die für die Diplomatinnen und Diplomaten in ihrer Arbeit von Bedeutung sind.
Wenn Sie Nachwuchsdiplomaten mit Ihren Studierenden an der Universität vergleichen: Sehen Sie hier mehr Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
Ich sehe unterschiedliche Anforderungen. Unseren Studierenden möchte ich zunächst das politikwissenschaftliche Handwerk beibringen: wie sie Theorien anwenden und entwickeln und wie sie dafür methodisch sauber Daten erheben und auswerten. Der diplomatische Nachwuchs muss in die Lage versetzt werden, die generierten Daten zu interpretieren und zu nutzen, um in politischen Situationen handlungsfähig zu sein. Was beide benötigen, sind analytische Werkzeuge und politisches Grundwissen. Wir haben inzwischen damit begonnen, den Kurs, den wir für die Diplomatinnen und Diplomaten geben, umzudrehen und einen Masterkurs „Diplomatie für Politologinnen und Politologen“ an der Goethe-Universität zu unterrichten, der Studierende gezielt auf dieses Arbeitsfeld vorbereitet.
Sie sind am neu gegründeten Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt beteiligt. Wie der Name schon sagt, soll das Institut den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland stärken. Übernimmt damit die Wissenschaft die Rolle der Politik?
What‘s in a name? Das Institut soll zunächst einmal den Zusammenhalt erforschen. Was ist das eigentlich genau, Zusammenhalt? Was meinen wir, wenn wir darüber sprechen, dass die Gesellschaft nicht genügend zusammenhält, was soll da gehalten werden? Und wie viel Halt sollte es geben? Hier lauern erhebliche ungelöste empirische und normative Fragen, die das neu gegründete Institut ausloten will. Ich glaube, dass dieses Institut durch die Diskussionen dieser Fragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen kann, aber letztlich ist das wohl eine empirische Frage.
Im Rahmen des Instituts für gesellschaftlichen Zusammenhalt sind auch Dialog-Komponenten mit der Praxis vorgesehen. Wie sollen diese aussehen?
Wir haben ganz unterschiedliche Formate im Blick. Zum einen wird es ein Praxisnetzwerk geben, das die Arbeit des Instituts begleitet und dessen Expertise uns helfen soll, unsere Forschung richtig aufzustellen, zum anderen wird es Forschungswerkstätten geben, in denen Bürgerinnen und Bürger direkt an der Forschung teilnehmen können. Wir planen Veranstaltungsformate, in denen wir Zusammenhalt praktisch ausloten wollen, wir werden Angebote in der politischen Bildung haben, für Schulen, aber auch für Universitäten und beispielsweise unterschiedliche Workshops für Journalistinnen und Journalisten oder für Verwaltungsbeamte.
Wenn Sie rückblickend auf Ihre Kontakte mit der Praxis schauen, was würden Sie heute anders machen?
Vielleicht etwas mutiger sein und nicht darauf warten, dass die Praxis auf mich zukommt. Ich glaube, es geht vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so wie mir am Anfang: Ich war unsicher, ob das, was ich mache, überhaupt relevant ist für die Praxis. Das ist ein Lernprozess. Die Perspektive der jeweils anderen Seite verstehen lernen und wie sie auf die Welt schaut, das benötigt Zeit. Zeit, die man sich nehmen wollen muss, denn dazu gehört nicht nur, zu fragen, was kann meine Forschung hierzu bieten, sondern auch zu bestimmen, welche Wünsche der Praxis man definitiv nicht erfüllen kann und möchte.
Welchen Tipp geben Sie Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis, die in Kontakt mit der Wissenschaft kommen wollen?
Werden Sie sich zunächst darüber klar, was genau Ihr Ziel ist und vermitteln Sie das offen und transparent. Machen Sie sich darauf gefasst, dass die Wissenschaft davon nur einen kleinen Teil wird liefern können, aber seien Sie offen, sich überraschen zu lassen. Oftmals liefert Ihnen die Wissenschaft Erkenntnisse, mit denen Sie vielleicht nicht gerechnet haben, die Ihnen aber neue Optionen eröffnen.
Die Fragen stellte Tome Sandevski
Das Interview ist erschienen in: Wolff, Birgitta; Krausch, Georg; Prömel, Hans Jürgen (Hg.), Mehr als Politikberatung und Medienpräsenz: Reflexionen über die Bedeutung dialogorientierter Wissenschaftskommunikation für Hochschulen und Praxis. Science Policy Paper 4 des Mercator Science-Policy Fellowship-Programms.
www.uni-frankfurt.de/74997299/Publikationen
Nicole Deitelhoff hat seit 2009 eine Professur für Internationale Beziehungen und Theorien Globaler Ordnungen an der Goethe-Universität Frankfurt inne. Sie ist Mitglied des Direktoriums des Frankfurter Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ an der Goethe-Universität und Geschäftsführende Direktorin des Leibniz- Instituts Hessische Stiftung Friedensund Konfliktforschung (HSFK). Zu ihren bekanntesten Veröffentlichungen zählt „Überzeugung in der Politik“, für die sie unter anderem den Heinz-Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erhielt. Prof. Deitelhoff ist seit einigen Jahren auch für die politikwissenschaftliche Ausbildung der angehenden Diplomatinnen und Diplomaten im Auswärtigen Amt zuständig. 2017 wurde sie für ihre wissenschaftliche Arbeit und deren Dialog mit der Praxis mit dem Schader-Preis ausgezeichnet. Sie ist u. a. Mitglied des Beirats für Fragen der Inneren Führung des Bundesministeriums für Verteidigung und Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 5.19 des UniReport erschienen.