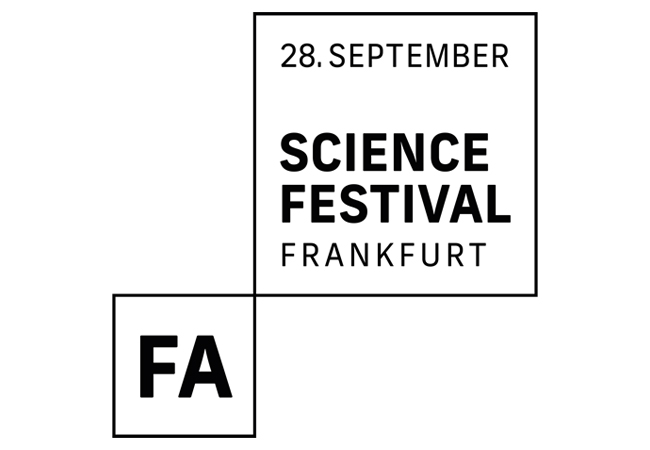Als Alumna der Goethe-Universität studierte Sylvia Schenk in den 70er Jahren Jura in Frankfurt. Erfolgreich war sie außerdem als Leichtathletin. 1972 wurde sie Deutsche Meisterin und nahm an Olympia teil.
Als Leichtathletin sind Sie 1971 von der Eintracht nach Frankfurt geholt worden. Fiel die Entscheidung für Frankfurt leicht?
Über Frankfurt als Stadt habe ich damals kaum nachgedacht. Die Frage war: Gehe ich weg von zu Hause oder nicht? Ich habe noch bei den Eltern gewohnt und bin zum Studium nach Marburg gependelt. Und vor allen Dingen brauchte ich einen Verein, wo ich mit anderen trainieren kann. Das war entscheidend: nicht die Stadt oder die Uni, sondern das Eingebundensein in einen Verein.
Warum haben Sie sich für Jura entschieden?
Ganz einfach: Ich wollte alles andere nicht studieren. Auf keinen Fall wollte ich Lehrerin werden, und Sport kam nicht in Frage, dann hätte ich ja gar nichts anderes mehr gemacht. Ärztin wollte ich auch nicht werden, mein Vater war ja Arzt. Und da dachte ich: Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich Jura. Da kann ich Journalistin werden, Anwältin, Richterin, in die Verwaltung gehen.
Welches Ereignis aus Ihrer Studienzeit haben Sie in besonderer Erinnerung?
Ich habe mein Studium runtergespult, mein Leben war der Sport. Und da waren es die deutsche Meisterschaft und die Olympischen Spiele, die mir am lebhaftesten in Erinnerung geblieben sind. Und wann haben Sie gelernt? Ich habe immer im Winter mehr gelernt und studiert, im Sommer war Sportsaison. Das konnte man sich bei Jura gut einteilen. Trainieren musste ich im Winter ja auch, aber für die Reisen im Sommer brauchte ich den Rücken frei.
Welche Professoren haben Sie geprägt?
Ich weiß, dass ich Examen bei Denninger gemacht habe, an ein paar andere Namen kann ich mich auch erinnern.
Aber geprägt?
Nein. Ich fand das Studium nicht so prickelnd. Die Zusammenhänge habe ich erst bei Kuschmann, dem Repetitor, gelernt.
Ist Ihnen die Uni wegen des Sports entgegengekommen?
Davon wusste ja kaum jemand. Damals war für viele Spitzensport etwas Negatives. Selbst in meiner kleinen Lerngruppe haben die anderen erst nach einem Jahr erfahren, dass ich Spitzensport mache. Irgendwann kriegten die mit, dass ich ein Wochenende in London war für einen Wettkampf. Damals waren solche Kurztrips ja eher ungewöhnlich.
Wie haben die Kommilitonen reagiert?
Sie fanden das ganz interessant, aber es war kein großes Thema. Das war mir auch ganz recht so.
Was haben Sie selbst von der Studentenbewegung mitbekommen?

1974 war ich dabei, als es um besetzte Häuser an der Schumannstraße ging, und habe mich dann auch mehr um solche Themen in der Stadt gekümmert. Sonst habe ich mich eher rausgehalten. Der Sport hat mich stark in Anspruch genommen. Natürlich war ich politisch interessiert. Aber die Studentenbewegung sah ich skeptisch: In Marburg hatte ich erlebt, dass einer in der Vorlesung aufsteht und sagt, wer Marx nicht so interpretiert, wie wir ihn interpretieren, kann das sowieso nicht verstehen. Das war nicht mein Ding. Ich hatte auch keine Lust, mich ständig zu verteidigen: Wie kannst Du nur Spitzensport machen, wie kannst Du nur einen Vater haben, der bei der Bundeswehr ist (mein Vater war als Arzt dort)?
Worin sehen Sie Ihren größten akademischen Erfolg?
Meine juristischen Staatsexamina, die ich mit Prädikat gemacht habe. Ich bin so ein Wettkampftyp: Im Wettkampf bin ich gut, ansonsten strenge ich mich nicht so an. Im Klausurenkurs hatte ich eine Fünf geschrieben. Der Professor gab mir die Arbeit zurück und sagte: »Ach, Sie sind die Läuferin.« Und ich dachte mir, was für ein Idiot – und habe keinen Klausurenkurs mehr besucht. Alle haben gesagt, du bist verrückt, du schaffst das nicht. Und dann habe ich die zweitbesten Klausuren geschrieben. Das war mein größter akademischer Erfolg: den Professor zu widerlegen, der gesagt hat, »Ach, Sie sind die Läuferin«.
Ein Misserfolg als entscheidender Impuls für den Erfolg?
Das war kein Misserfolg, warum soll ich Klausuren schreiben, wenn es keine Klausuren sind?
Ihr wichtigstes Thema ist der Kampf gegen Korruption und Doping im Sport. Wie kam es dazu?
Als aktive Sportlerin war ich nicht bequem für die Funktionäre, da gab es immer mal wieder Ärger, ich war dann auch Aktivensprecherin im Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband. 1975 bin ich dort in den Vorstand gegangen, weil ich Dinge ändern wollte. Damals hatte ich nicht den Begriff Korruption im Kopf, aber ich wollte die Verhältnisse ändern, dass manches über unsere Köpfe hinweg entschieden wurde, dass es undemokratisch zuging. Ein weiterer Schwerpunkt sind Frauenrechte.
Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Nach dem Studium habe ich mich in einer Kanzlei beworben, die suchten einen jungen Kollegen, den sie als Sozius aufbauen wollten. Ich hatte meine Prädikatsexamina, war in Frankfurt bekannt wie ein bunter Hund – gute Voraussetzungen, um als Anwältin irgendwo einzusteigen. Innerhalb von zwei Tagen kriegte ich ein Schreiben: Danke für Ihre Bewerbung, das hört sich ja alles gut an, aber wir hatten ausdrücklich geschrieben, dass wir einen Kollegen suchen. Sie sind aber eine Frau und werden früher oder später Mutterpflichten übernehmen, deshalb kommen Sie für die Position nicht in Frage. Das hat der wirklich nett gemeint, dass er der jungen Kollegin sagt, denk doch mal drüber nach, was deine eigentliche Bestimmung ist. Ich hab erstmal gelacht – das mir! – und dann eine Mordswut gekriegt. Deshalb bin ich Richterin geworden und habe meine Freizeit für die Politik genutzt.
Wie gefällt Ihnen der neue Campus Westend? Sind Sie dort manchmal zu Besuch?
Im Normalfall jeden zweiten Tag. Es ist wunderschön. Ich laufe immer am Body of Knowledge vorbei zum Training. Mitten in der Stadt und zugleich mitten im Grünen – wenn das zu meiner Zeit schon so gewesen wäre, das hätte ich schön gefunden.
Haben Sie einen Wahlspruch?
Nur meinen Konfirmationsspruch: »Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.« Dass alles mal zu Ende ist, auch wenn ich ein Amt übernehme, dessen sollte ich mir immer bewusst sein. Das ist für das Amt besser und für einen selber auch. [Die Fragen stelle Dr. Anke Sauter]
[dt_call_to_action content_size=”small” background=”fancy” line=”true” style=”1″ animation=”fadeIn”]
Alumni im Porträt: Sylvia Schenk
In Porträts wird stets ihr langer Atem betont, ihr Durchhaltevermögen. Das passt, war Sylvia Schenk doch in den 70er Jahren als 800-Meter-Läuferin erfolgreich, Olympiateilnehmerin und 1971 beteiligt am 4 x 800-Meter-Staffel-Weltrekord. Doch auch in anderen Bereichen ihres Engagements ist Sylvia Schenk dafür bekannt, nicht so bald aufzugeben, ihr Ziel fest im Blick zu behalten. 1952 im niedersächsischen Rotenburg an der Wümme geboren, ließ sie als 14-Jährige beim Sportabzeichen alle hinter sich, obwohl sie niemals trainiert hatte. Der Beginn einer erfolgreichen, wenn auch kurzen Karriere als Sportlerin. Mit 19 Jahren holte die Eintracht sie nach Frankfurt, wo sie Sport und Jurastudium verbinden konnte. Die beiden Staatsexamina meisterte sie mit Bravour, wurde Richterin am Arbeitsgericht Offenbach, wo sie von 1979 bis 1989 tätig war. Zugleich war sie stets politisch und sportpolitisch aktiv, kämpfte für Frauenrechte und gegen Korruption, bis heute ist sie Mitglied der SPD.
Nach dem rot-grünen Wahlerfolg bei den hessischen Kommunalwahlen 1989 wurde Sylvia Schenk hauptamtliche Stadträtin in Frankfurt. Ihre Zuständigkeiten als Dezernentin wurden in den zwölf Jahren ihrer Amtszeit mehrfach erweitert, sie war unter anderem verantwortlich für Sport, Recht, Frauen und Wohnungswesen. Ein großes Anliegen ist ihr der Kampf gegen Korruption und Doping. Von 2001 bis 2004 war Sylvia Schenk Präsidentin des Radsportverbandes Bund Deutscher Radfahrer (BDR), trat jedoch wegen Meinungsverschiedenheiten zum Thema Doping zurück. Bei einer erneuten Kandidatur 2013 konnte sie sich nicht gegen den inzwischen amtierenden Präsidenten Rudolf Scharping durchsetzen. 2006 bis 2013 war sie Mitglied im Vorstand von Transparency International Deutschland, 2007 bis 2010 dessen Vorsitzende. Seit 2014 leitet sie die Arbeitsgruppe Sport in dieser Organisation. Seit 2004 arbeitet Sylvia Schenk als Rechtsanwältin.
[/dt_call_to_action]
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 33 des Alumni-Magazins Einblick erschienen.