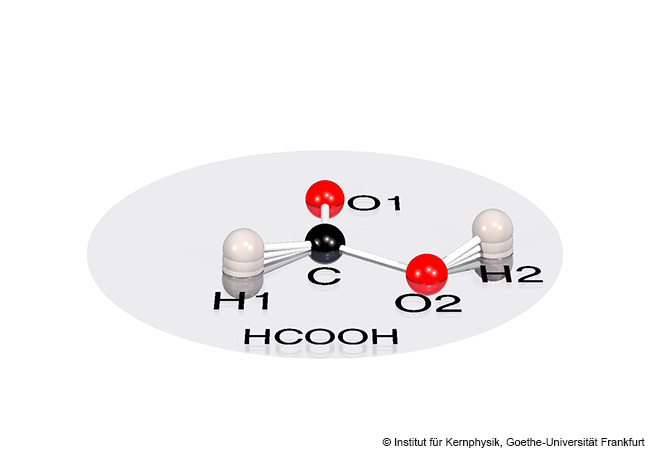Rüdiger Krauses Sprache verrät viel. Nicht nur über seine schwäbische Herkunft, sondern vor allem über seine Einstellungen. Das ist zu hören, wenn er von der Faszination berichtet, die archäologische Funde seit seiner frühen Jugend auf ihn ausüben: „Als 13 Jahre alter Schüler habe ich mich bei uns zu Hause, bei Ludwigsburg nördlich von Stuttgart, am Dorfrand herumgetrieben, wo ein Neubaugebiet erschlossen wurde. Einer der Bagger hat dabei eine Siedlungsgrube angeschnitten“, berichtet Krause, „und ich habe in der Baugrube sehr viele Keramikscherben entdeckt.“ Er habe seine Funde dann bei der Archäologie-Abteilung des Landesamts für Denkmalpflege in Stuttgart gemeldet, und dort sei ihm bestätigt worden, dass er tatsächlich spätbronzezeitliche Keramiken der sogenannten Urnenfelder-Kultur entdeckt hatte, angefertigt zwischen 1200 und 800 vor Christus.
„Seit 3000 Jahren war ich der Erste, der diese Dinge aus dem Boden geholt hat und in Händen halten durfte, das war eine absolute Faszination für mich“, schwärmt Krause. Ihm, dem Professor für Prähistorische Archäologie an der Goethe-Universität, steht diese Initialzündung auch noch fast ein ganzes Forscherleben später klar vor Augen: Wenn er nicht „hielt“ sagt, auch nicht „halten konnte“. Sondern „halten durfte“.
Nach Studium und Promotion kehrte Krause dann zunächst ans Stuttgarter Landesdenkmalamt zurück, ergänzte seine dortige Arbeit als Konservator allerdings einige Jahre später um die Lehrtätigkeit an der Freien Universität Berlin, wo er sich im Jahr 2000 habilitierte. 2006 vollzog er endgültig den Wechsel von der Denkmalpflege an die Universität: „Ich hatte eine tolle Stelle beim Landesamt. Aber indem ich den Ruf an die Goethe-Universität annahm, habe ich es nach fast der Hälfte meiner Dienstzeit geschafft, mich nochmal grundlegend zu verändern. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar“, kommentiert Krause, „zumal mich in Frankfurt eine große, offene, liberale Universität mit einem interessanten Kollegenkreis erwartete.“
Grabungen in Taunus und Trans-Ural
Seither vertritt er am Institut für Archäologische Wissenschaften das Fach „Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie“, konzentriert sich dabei vor allem auf die prähistorischen Epochen Bronze- und Eisenzeit, also das erste und das zweite vorchristliche Jahrtausend, in denen es noch keine Schrift gab, sei es im Vordertaunus, im Osten der Schwäbischen Alb, im österreichischen Montafon oder im russischen Trans-Ural. Um etwas über die menschliche Entwicklung, über das Entstehen von Gesellschafts-, Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen, über Rahmenbedingungen wie Nahrungsgrundlagen und Klimaeinflüsse herauszufinden, muss Krause mit naturwissenschaftlichen Methoden verschiedener Disziplinen in archäologischen Kontexten „lesen“ – in Siedlungen und Befestigungen genauso wie in Alltagsgegenständen, Werkzeugen und Waffen.
Wir haben zum Beispiel vier Jahre lang in einem LOEWE-Schwerpunkt anhand bronzezeitlicher Burgen zwischen Taunus und Karpaten prähistorische Konfliktforschung betrieben“, berichtet Krause. Einerseits hätten er und seine Arbeitsgruppe dabei bedeutende Weiterentwicklungen der Waffentechnik beobachtet – so etwa, wenn bronzezeitliche Krieger anstelle von Langdolchen jetzt mit Schwert und Schild oder Lanzen mit scharfen Spitzen gekämpft hätten, „oder nehmen Sie die Festungsanlage Santana bei Arad in Rumänien, an der wir intensiv gegraben haben: Dort haben wir Hunderte gebrannte Lehmkugeln gefunden, drei- bis vierhundert Gramm schwer, die als Schleudergeschosse dienten“.
Konfliktstrategie Verhandeln
Andererseits hätten sie auch etliche Burgen untersucht, an denen nichts auf bewaffnete Auseinandersetzungen hindeutete: „Wir haben nur auf ganz wenigen Burgen Spuren von Angriffen gefunden, ebenso wenig wie „Brandhorizonte“, also Brandreste, die durch das Verbrennen von Gegenständen oder Gebäuden entstanden sind“, berichtet Krause, „das lässt nur einen Schluss zu: Schon die bronzezeitlichen Burgherren waren bestrebt, Konflikte fernzuhalten. Die Strategie, Konflikte durch Verhandlungen zu lösen, war also keine Erfindung des Mittelalters.“
Er genießt es, wenn er in Lehrveranstaltungen nicht nur das längst etablierte archäologische Fachwissen weitergeben kann, sondern über neueste wissenschaftliche Beiträge aus jüngerer Zeit ebenso sprechen kann wie beispielsweise über neue genetische Erkenntnisse, die seine Vorlesung über die Jungsteinzeit bereichern: „Ich kann es mir gar nicht erlauben, darauf nicht einzugehen – insofern zwingen mich die Studierenden, wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Man kann also sagen, sie halten mich jung!“
In Rüdiger Krauses Sprache klingen seine klaren Standpunkte immer wieder an, nicht nur, wenn er sich über das echauffiert, was er seit Jahren als Fehlentwicklung einstuft: „Personalkostenbudgetierung, Stellenstreichungen, Mittelkürzungen und so weiter: Unter solchen Rahmenbedingungen sollen wir Hochschullehrer erfolgreiche Arbeit leisten… und unsere Studierenden müssen am Ende das Desaster ausbaden, das die Politik da angerichtet hat.“
Ebenso, wenn er über die berühmte „Himmelsscheibe von Nebra“ spricht und darauf hinweist, dass an deren allgemein verbreiteter Geschichte etwas nicht stimmen könne: „Die Scheibe ist echt, sie ist ein hochinteressantes Artefakt, aber sie stammt unserer – gut begründeten – Meinung nach nicht aus der frühen Bronze-, sondern aus der Eisenzeit, also aus dem 1. Jahrtausend vor Christus.“ Für die menschliche Entwicklung habe sie damit eine ganz andere Bedeutung. Diesen archäologischen Konflikt aufzulösen, werde aber wohl Sache der nächsten Archäologen-Generation werden.
Stefanie Hense