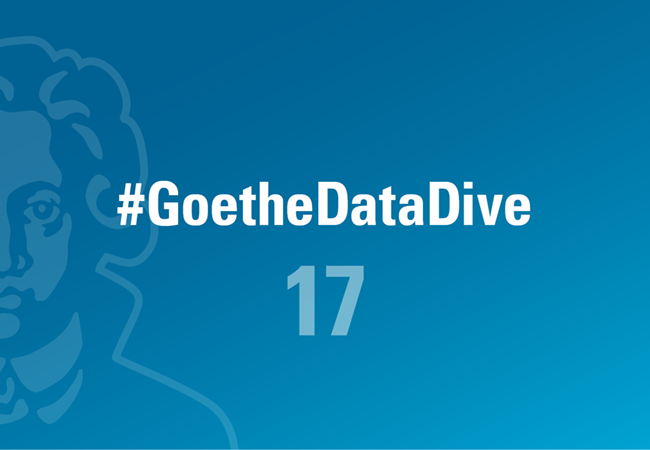Der Amerikaner Gregory Jones-Katz beschäftigt sich am Forschungskolleg Humanwissenschaften mit der Geschichte der amerikanischen Philosophie und Kulturwissenschaft seit den 1960er Jahren bis zur Gegenwart.

UniReport: Herr Jones-Katz, Ihr Postdoc-Projekt beschäftigt sich mit der Idee einer „American Theory“; was zeichnet Ihrer Meinung nach eine solche aus, warum sollten wir sie historisch betrachten?
Gregory Jones-Katz: Ich definiere „American Theory“ derzeit als eine intellektuelle und kulturelle Bewegung, die in den 1970er Jahren an US-Hochschulen entstand und später internationale Bedeutung erlangte. Diese Bewegung beschäftigte sich mit Fragen von Differenz und Marginalität und hat viele heutige Ideen über Geschlechteridentität, race, Fördermaßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen („affirmative action“) und kulturelle Aneignung geprägt. Trotz ihrer Bezeichnung als „amerikanisch“ ist „American Theory“ ein Hybrid aus Ideen mit verschiedenen Wurzeln, unter anderem aus der deutschen und französischen Philosophie sowie der russischen Literaturtheorie. Diese hybride Theorie, die in den Vereinigten Staaten entstanden ist, wurde später in verschiedene Teile der Welt exportiert und dort weitervermittelt. Ein Beispiel dafür ist Jacques Derrida, ein in Algerien geborener französischer Philosoph, dessen Ideen zunächst im amerikanischen Universitätssystem große Popularität erlangten, bevor sie in andere Länder exportiert wurden. Ein weiteres Beispiel ist der intellektuelle Austausch zwischen China und den Vereinigten Staaten, der sich von 1978 bis zu den Ereignissen auf dem Platz des Himmlischen Friedens erstreckte und meiner Ansicht nach zur Demokratiebewegung in China in den 1980er Jahren beitrug. Diese Beispiele verdeutlichen die miteinander verknüpften Knotenpunkte und Kreisläufe, durch die Ideen reisen.
Durch die Untersuchung der materiellen Verbreitungswege – wie Institutionen, Zeitschriften, Seminarräume, wichtige Vorträge und Bücher – können wir verstehen, wie „American Theory“ sowohl in den Vereinigten Staaten als auch darüber hinaus zwischen 1970 und den frühen 2000er Jahren populär wurde.
Ich denke jedoch, dass dieser historische Moment vorbei ist. Die breite Begeisterung, ja Euphorie für „American Theory“ wurde durch die massiven Investitionen in und den Ausbau von Universitäten im gesamten Nordatlantik in den späten 1950er, 1960er und frühen 1970er Jahren begünstigt. In dieser Zeit stiegen die Einschreibezahlen an den Universitäten und die Zahl der Lehrkräfte sprunghaft an, wodurch ein Umfeld geschaffen wurde, in dem theoretische Ideen florierten und über die akademische Welt hinaus Eingang in die breitere Kultur fanden. Die Bedingungen für die Produktion dieser Ideen haben sich jedoch geändert. Wissenschaftler*innen in den Vereinigten Staaten haben heute mit schwindender Unterstützung und einer Gegenbewegung gegen „American Theory“ zu kämpfen, worin sich eine Veränderung der intellektuellen Landschaft und Herausforderungen für die Geisteswissenschaften ankündigen.
Was ist Ihr Beitrag zum Projekt Democratic Vistas, und wie beeinflusst Walt Whitmans Vorstellung, dass die Demokratie das tägliche Leben durchdringen sollte, Ihre Arbeit?
Mein Beitrag zum Projekt schließt an Whitmans Auffassung von Demokratie an. Für ihn war Demokratie nicht nur ein politisches System, sondern auch ein intellektuelles und existenzielles Bekenntnis zu liberalen Werten. Auch ich verstehe Demokratie nicht nur als eine Ansammlung von Gesetzen und Institutionen, sondern als eine Lebensweise, die unser tägliches Leben prägt. „American Theory“ ist mit demokratischen Idealen verwoben, da sie die Menschen dazu anregt, sich mit Begriffen wie Differenz und Marginalität auseinanderzusetzen. Häufig wird Theorie als abstrakt kritisiert, aber sie hat Auswirkungen auf die reale Welt. Das Lesen und Diskutieren von Texten trägt zu einem tieferen Verständnis von Geschichte und Kultur bei und stärkt damit die Demokratie.
Die Wirkung von Theorie tritt jedoch nicht sofort ein, sondern kann sich auch erst Jahre später entfalten. „American Theory“ beeinflusste nicht nur Aktivist*innen, sondern auch Fachleute in verschiedenen Bereichen, von Hochschullehrenden bis hin zu Anwält*innen und Journalist*innen, die diese Ideen in die breitere Gesellschaft hineintrugen. Bildung hat häufig indirekte Einflüsse und wirkt auf Umwegen: Manchmal kehren Texte, die wir vor vielen Jahren gelesen haben, auf unerklärliche Weise zu uns zurück, um uns bei der Bewältigung aktueller Probleme zu helfen. So entstehen über Jahrzehnte hinweg tiefgreifende kulturelle Veränderungen, die sowohl gesellschaftliche als auch persönliche Sichtweisen prägen.
Wie hat Ihre bisherige Zeit in Bad Homburg Ihre Forschung geprägt?
Am Forschungskolleg recherchiere und schreibe ich ein Buchkapitel über die Gender-Dimension und andere Diversity-Aspekte von „American Theory“. In den letzten Monaten wurde ich ermutigt, „außergeschichtlich“ zu denken, das heißt, mehr über die politischen Aspekte meiner Arbeit nachzudenken. Ich wurde dazu ermuntert, die Frage zu beantworten: Was, wenn überhaupt, ist meine Kritik an „American Theory“? Darüber hinaus habe ich ein tieferes Verständnis für den transatlantischen intellektuellen Austausch zwischen Amerika und Europa gewonnen und aus erster Hand erfahren, wie Ideen, Projekte und Menschen institutionelle und regionale Grenzen überschreiten.
Wie hat Ihnen der Aufenthalt am Kolleg und die Zusammenarbeit mit Ihren Kolleg*innen in Frankfurt und Bad Homburg bisher gefallen?
Das Forschungskolleg in Bad Homburg ist ein seltener und besonderer Ort – die Umgebung, die Einrichtung, die Kolleg*innen und die Mitarbeiter*innen machen den Aufenthalt wirklich unvergesslich. Die ruhige und angenehme Atmosphäre regt zum Nachdenken und Reflektieren an und die Diskussionen mit meinen Kolleg*innen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Erfahrungen bereichern mein Projekt, da sie die Tendenz, in nationalen Grenzen zu denken, in Frage stellen. Der interdisziplinäre Austausch fördert eine breitere Perspektive und trägt zu einem differenzierteren Verständnis meiner Forschung bei. Darüber hinaus haben meine Verbindungen zum Studiengang Vergleichende Literaturwissenschaft und zum Fachbereich Geschichte der Goethe-Universität meine intellektuelle Welt nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa geöffnet.
Mit dem John McCloy Transatlantic Forum möchte das Projekt Democratic Vistas eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Was hat es für Sie persönlich bedeutet, daran mitzuwirken?
Zusammen mit Johannes Völz, dem Co-Sprecher des Projekts, hielt ich im Januar an einem Wiesbadener Gymnasium einen Workshop über Demokratie als Lebensform im öffentlichen Raum. Ich sprach über meine Erfahrungen mit der Demokratie – oder ihrem Fehlen – auf öffentlichen Plätzen wie dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und dem Liberty Square in Taipeh. Der Kontrast zwischen den beiden Plätzen könnte nicht schärfer sein, etwa was die Bewegungs- und Meinungsfreiheit betrifft, die auf dem Liberty Square herrscht. Die Schüler*innen waren sehr interessiert und engagiert und stellten sofort den Bezug zu ihrer eigenen Nutzung von öffentlichen Räumen her. Sie nannten Beispiele wie die Proteste gegen die AfD, die zu dieser Zeit stattfanden, aber auch Rockkonzerte und den Karneval. Der Gedanke, dass Demokratie nicht nur ein politisches System, sondern auch eine Lebens- und Denkweise im Alltag ist, war für die Schüler*innen so spannend, dass viele von ihnen auch nach dem Ende der Schulstunde noch weiterreden wollten.
Fragen: Monika Hellstern
Dr. Gregory Jones-Katz
ist ein amerikanischer Geistes- und Kulturhistoriker. Er promovierte 2016 in amerikanischer Geschichte an der University of Wisconsin-Madison. Danach lehrte er sechs Jahre lang an der Chinese University of Hong Kong in Shenzhen, bis er China 2022 unter dem Druck des zunehmenden Autoritarismus verließ. 2022/2023 lehrte er an der Universität Duisburg-Essen. Jones-Katz war Stipendiat am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) und am Center for Advanced Studies der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sein erstes Buch Deconstruction: An American Institution wurde 2021 von der University of Chicago Press veröffentlicht. Als Stipendiat des Forschungsschwerpunktes »Democratic Vistas. Reflections on the Atlantic World« arbeitet er am Forschungskolleg Humanwissenschaften an seinem zweiten Buchprojekt Empire of American Theory and the Triumph of Neoliberalism 1965–2008. Darin befasst er sich mit der Geschichte der amerikanischen Theorie und ihrer breiteren Wirkung in den Vereinigten Staaten von 1960 bis in die 2000er Jahre.