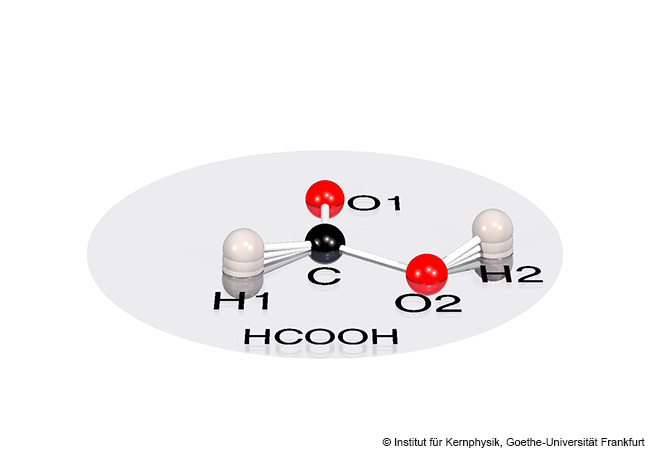Demokratie (auch) als Lebensform / Johannes Völz und Till van Rahden zum Buch „Horizonte der Demokratie“, erschienen im Rahmen des Frankfurter Forschungskreises „Democratic Vistas: Reflections on the Atlantic World“.

UniReport: Herr Völz, Herr van Rahden, der Untertitel des Buches lautet „Offene Lebensformen nach Walt Whitman“. Im (Gegenwarts-) Deutschland kennt man ihn wahrscheinlich (nur) noch von der Verwendung des Gedichts „O Captain! My Captain“ im Film „Club der toten Dichter“. Warum ist eine Beschäftigung mit Whitman aus Sicht der Demokratieforschung so fruchtbar?
Till van Rahden: Für uns ist Whitman einer der Denker der Stunde. Das Thema der Demokratie zieht sich durch das Werk dieses großen amerikanischen Dichters der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Indem wir uns darauf einlassen, was er über die Demokratie zu sagen hat, erkennen wir viel über die blinden Flecken unserer aktuellen Diskussionen. Mit Whitman können wir anders über die Demokratie nachdenken, als wir es heute üblicherweise tun. Statt darauf zu schauen, was Demokratien sterben lässt, fragt Whitman, was sie am Leben hält.
Johannes Völz: Whitmans Schaffen ist geprägt vom amerikanischen Bürgerkrieg – angefangen von dessen Vorboten, der zunehmenden Gewalt ab Mitte der 1850er Jahre, bis hin zu den Konsequenzen nach dem Krieg, als die USA gewissenmaßen ein zweites Mal gegründet werden müssen. Hinter seinem Werk steht also eine Krise der Demokratie, im Vergleich zu der sich die heutige Situation als beinahe harmlos darstellt. Aber meistens betrauert Whitman nicht etwa, dass das amerikanische Experiment des Republikanismus mit dem Bürgerkrieg an den Punkt des Scheiterns gekommen ist. Er bekennt sich stattdessen zur Demokratie. Und er tut dies nicht theoretisch, oder durch Appelle und Durchhalteparolen, sondern er nutzt die Mittel der Literatur. So macht er sinnlich erfahrbar, was es heißt, in einer demokratischen Kultur zu leben.
Wie hat man sich das vorzustellen: Literatur, die demokratische Kultur erfahrbar macht?
JV: In seinen Langgedichten lässt Whitman das „Ich“ durch die amerikanische Gesellschaft seiner Zeit streifen. Er nimmt diejenigen wahr, die am Rande der Gesellschaft stehen: Arbeiter, Sklaven, Prostituierte. Ihnen begegnet er nicht etwa mit Mitleid, sondern er gibt ihnen Raum, er macht sie sichtbar, und er stellt sie auf eine Stufe mit sich selbst und allen anderen. Er bindet sie ein in die Listen und Kataloge des amerikanischen Lebens, die seiner Lyrik Form verleihen. Wobei „Liste“ und „Katalog“ eigentlich irreführende Begriffe sind. Das klingt nach trockener Bürokratie. Whitmans Lyrik liest sich fast atemlos, oft euphorisch. Er schreibt in freier Form, manchmal in geradezu wilder Form. In seinen Gedichten aufzutauchen, bedeutet: erfahrbar zu werden, und zwar erfahrbar als gleich. Das ist eine aufregende Erfahrung.
Üblicherweise verbindet man mit Demokratie das Recht zu wählen, die Verfahren und Institutionen kollektiver Selbstregierung. Sie dagegen sprechen von sinnlichen Alltagserfahrungen. Von welchem Demokratieverständnis gehen Sie aus?
TvR: Das ist der vielleicht wichtigste Gedanke, den wir bei Whitman finden. Für ihn ist die Demokratie nicht nur eine Sache von Wahlen und Parteien. Sie ist sowohl eine Regierungs- als auch eine Lebensform. Beides ist miteinander verschränkt. Bei der Demokratie geht es um Formen des Zusammenlebens – also etwa Umgangsformen –, die den Alltag durchziehen und die gar nicht auf den ersten Blick etwas mit Politik zu tun haben. Whitman nimmt das Diktum Ernst-Wolfgang Böckenfördes vorweg und führt es aus. Der Staatsrechtler betont: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“. Die Regierungsform der Demokratie braucht mit anderen Worten Demokratinnen und Demokraten, aber auch in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen fallen diese nicht vom Himmel. Zu Demokraten werden Menschen durch ihre Einbettung in eine Lebensform. Ohne diese Lebensform geht die Demokratie ein.
Und wie sieht diese Lebensform laut Whitman aus?
TvR: Der Clou liegt in Whitmans Einsicht, dass es keine festgelegten Formen gibt. Oder geben darf. Erstarren die Formen, werden sie nicht mehr gelebt, sondern es bilden sich feste, unverrückbare Hierarchien, es entstehen Ungleichheit und Unfreiheit. Die Formen müssen sich also weiterentwickeln, oder, wie Whitman schreibt: Es geht um „Formen, die Formen hervorbringen“. Es gibt also keinen demokratischen Wertekanon und es lässt sich auch keine demokratische Leitkultur festlegen.
JV: Es gibt keine ewigen Werte, aber es gibt ein ewiges Prinzip: das der Gleichheit. Sie ist zwar nie vollkommen verwirklicht in real existierenden Gesellschaften, aber sie durchzieht – so sieht es jedenfalls Whitman – unser aller Existenz. Whitman geht es hier nicht um eine abstrakte Norm oder um eine pure Idee. Er betont, dass wir alle körperliche Wesen sind, und als solche Teil desselben durch und durch materiellen Kosmos. Whitman steht in der Folge des amerikanischen Transzendentalismus und dessen zentraler Gedanke besagt: Wir sind alle eingebunden in ein großes Ganzes, auch wenn uns das nur in besonderen, flüchtigen Momenten bewusst wird. Wenn man so will, ist das Demokratische laut Whitman in unserem Sein immer schon angelegt. Es geht darum, diese virtuelle Gleichheit zu verwirklichen. Dabei können Literatur und die anderen Künste behilflich sein, aber letztlich muss diese Gleichheit im Alltag spürbar werden.
Die Autor*innen Ihres diskursiv angelegten Sammelbandes mit Essays, Repliken und einem Gespräch kommen aus unterschiedlichen Disziplinen, das Spektrum reicht von Amerikanistik über Geschichtswissenschaft bis hin zu Philosophie, Sinologie und Ästhetik. Verstehen Sie diese Vielfalt der Zugänge als ein Mittel, mit dem sich auf die Gefährdung der Demokratie reagieren lässt?
JV: Der Politikwissenschaftler Gunther Hellmann und ich haben den Forschungsverbund „Democratic Vistas: Reflections on the Atlantic World“ während der ersten Trump-Jahre am Forschungskolleg Humanwissenschaften konzipiert, und natürlich trieb uns die Sorge um die Demokratie um, wie auch die Sorge um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Till van Rahden hatte zu diesem Zeitpunkt gerade sein Buch Demokratie: Eine gefährdete Lebensform (Campus, 2019) veröffentlicht und lieferte darin wichtige Stichpunkte für unseren Kreis. Dass Demokratie als Lebensform zu begreifen ist, die das Alltagsleben durchzieht – das war von vornherein ein wichtiger Ansatz von Democratic Vistas, und deswegen finden sich in unserem Kreis Forscherinnen und Forscher aus Disziplinen quer durch die Sozial- und Geisteswissenschaften. Es war also programmatisch, einen Forschungsverbund zur Demokratie nach dem Werk eines Dichters zu benennen – dem Essay „Democratic Vistas“, den Whitman unmittelbar nach dem Bürgerkrieg schrieb. Und für unsere nun gestartete Buchreihe, die sich in ihrem Titel – „Democratic Vistas/Demokratische Horizonte“ – abermals auf Whitman bezieht, lag es nahe, den ersten Band der Frage zu widmen, wie sich aus verschiedenen Fachperspektiven mit Whitman über Demokratie nachdenken lässt.
TvR: Das Buch ist nicht als Beitrag zur Whitman-Forschung gedacht. Wir sind größtenteils auch keine Whitman-Experten. Wir lassen uns vielmehr von seinen Ideen anregen. Das hat in Deutschland wie in Europa übrigens eine Tradition, auch wenn das heute in Vergessenheit geraten ist. Besonders nach den beiden Weltkriegen, als angesichts von „Urkatastrophe“ und „Zivilisationsbruch“ unklar war, wie und ob sich Deutschland in eine Demokratie verwandeln ließe, bezog man sich hierzulande auf Whitman. Thomas Mann pries eine Ausgabe mit gesammelten Werken Whitmans, die 1922 auf Deutsch erschien, als „Gottesgeschenk“. Und Erich Kästner, der als Redakteur den „Pinguin“ betreute – die wichtigste Jugendzeitschrift in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg –, zitierte ausführlich Whitmans „Gesang vom Breitbeil“. Wir sind also sowohl den Impulsen eines amerikanischen Dichters als auch einer deutschen – oder besser europäischen – Denktradition verpflichtet, die sich der Bedeutung Whitmans für die Demokratie in Krisenzeiten bewusst war und für die Namen wie Czesław Miłosz oder Cesare Pavese stehen.
Wie Sie beide in der Einleitung zu Ihrem Buch schreiben, setzte Whitman seine Hoffnung für die Zukunft der amerikanischen Demokratie auf die einende Kraft der Literatur. Nun lässt sich allerdings gegenwärtig beobachten, dass immer mehr demokratische Gesellschaften in einen Kulturkampf geraten. Kann die Kultur die Demokratie retten? Oder ist sie nicht mittlerweile selbst zu einem Krisenherd geworden?
JV: Es stimmt schon: Es wäre naiv, auf die Literatur und die Künste zu setzen, um dem Erstarken antidemokratischer und illiberaler Kräfte entgegenzuwirken. Das war übrigens schon zu Whitmans Zeiten der Fall, wie er sich selbst eingestehen musste. Als er 1855 seinen ersten Gedichtband veröffentlichte, nahm kaum jemand davon Notiz. Die Rezensionen in der Presse schrieb er heimlich selbst. Auch das kann man von ihm lernen: Man sollte die politische Kraft der Literatur nicht überschätzen.
TvR: Wobei man sagen muss, dass wir mit unserem Band keineswegs auf die Kraft der Künste setzen. Es geht uns vor allem um die Frage, was es heißt, Freiheit und Gleichheit sinnlich zu erfahren. Uns interessieren Alltagserfahrungen, Umgangsformen, eine bestimmte Form der Geselligkeit und schließlich auch das, was der von Whitman beeinflusste politische Theoretiker George Kateb „demokratische Individualität“ nennt. Uns geht es also um einen Begriff von Kultur, der breiter gefasst ist als „die Künste“. Im Englischen würde man dieses Kulturverständnis als „way of life“ bezeichnen. Und das heißt rückübersetzt: Lebensform!
Fragen: Dirk Frank
Johannes Völz/Till van Rahden (Hg.): Horizonte der Demokratie. Offene Lebensformen nach Walt Whitman. Band 1 der Reihe Democratic Vistas. Bielefeld: transcript Verlag 2024 https://doi.org/10.1515/9783839462737