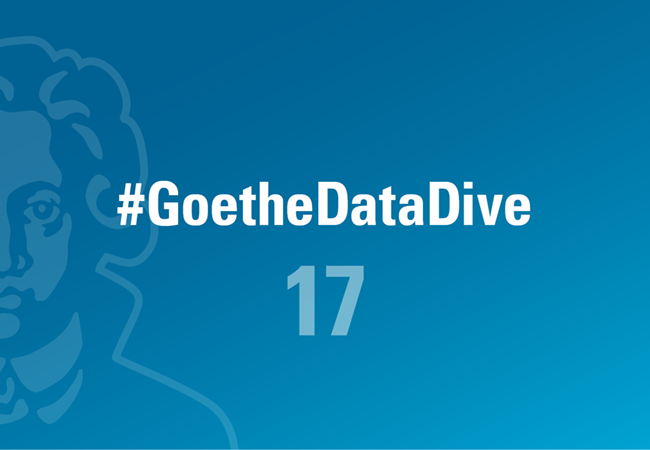Leiden immer mehr Menschen an Depressionen? Die statistischen Daten der Krankenkassen legen das nahe. Epidemiologische Studien zeigen aber, dass die Zahl in den vergangenen 20 Jahren stabil geblieben ist. Die Epidemiologin Prof. Brenda Penninx, diesjährige Merz-Stiftungsgastprofessorin an der Goethe-Universität, erklärt dieses Paradox damit, dass Depressionen heute häufiger erkannt werden. Dass Depressionen durch das moderne Leben verursacht werden, hält Prof. Andreas Reif, Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, für einen Mythos. Stress ist zwar ein Faktor, der Depressionen begünstigen kann. Aber eben nicht bei allen, wie Brenda Penninx von der Amsterdam University herausgefunden hat.
Seit 2004 erforscht sie im Rahmen der „Netherlands Study on Depression and Anxiety“ die auslösenden Faktoren für Depressionen. Sie führt sie zu gleichen Teilen auf genetische Veranlageung und Umweltfaktoren zurück. Ihre wichtigste Erkenntnis: Es gibt nicht „die Depression“, sondern verschiedene Untergruppen. Das hat weitreichende Folgen für die Prävention und Therapie. Letztere könnte zukünftig individuell auf den Patienten zugeschnitten sein. Das gibt Hoffnung, insbesondere für die etwa 30 bis 40 Prozent Patienten, die auf die derzeit verfügbaren Antidepressiva nicht gut ansprechen.
Brenda Penninx erwartet erste Forschungsergebnisse innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre. Psychiater Andreas Reif verwies beim Bürgersymposium im Frankfurter Goethe-Haus darauf, dass derzeit neue Wirkstoffe erforscht werden. In Deutschland werden sie ab nächstem Jahr in Phase-III-Studien getestet, u. a. in der Psychiatrie der Universitätsklinik Frankfurt. Ebenfalls mit vielversprechenden Ergebnissen testen psychiatrische Kliniken inzwischen entzündungshemmende Medikamente, denn es hat sich gezeigt, dass bei einer Untergruppe von Menschen mit Depressionen das Immunsystem vermehrt entzündungsfördernde Botenstoffe wie Zytokine freisetzt. Diese Reaktion bringt Brenda Penninx nicht nur mit Stress, sondern unter anderem auch Ernährung in Verbindung.
„Ein heißes Forschungsthema ist derzeit der Einfluss des Darmmikrobioms auf Depressionen, aber Befunde beim Menschen stehen noch aus“, sagt Reif. Die Versuche an Mäusen sind jedoch ermutigend. Und was bedeuten die neuen Erkenntnisse für die Prävention? Psychiater Prof. Jürgen Deckert von der Universität Würzburg empfahl beim Bürgersymposium, bereits Schulkinder den Umgang mit Stress zu lehren. Kinder und Jugendliche mit Angststörungen oder ADHS, die zu den Hochrisikogruppen für Depressionen gehörten, könnten zusätzlich von Online-Psychotherapie profitieren. Das gilt im Übrigen auch für Erwachsene, die eine depressive Phase überstanden haben.
Über Smartwatches könnte man Anzeichen für eine drohende depressive Episode erkennen und interaktiv gegensteuern. Gute Nachrichten gibt es bereits jetzt: Aufgrund der verbesserten Diagnose und der Aufklärung über Depressionen ist die Zahl der Suizide deutlich zurückgegangen. Waren es im Jahr 1983 noch fast 19 000, so sind es heute noch 9 800. Dennoch bleiben bei vielen Patienten Depressionen immer noch jahrelang unentdeckt. Verbesserungen im Gesundheitssystem wie eine gründlichere Schulung der Allgemeinmediziner und eine verkürzte Zeit zwischen Diagnose und Therapiebeginn könnten das Leid vieler Betroffener lindern.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 6.19 des UniReport erschienen.