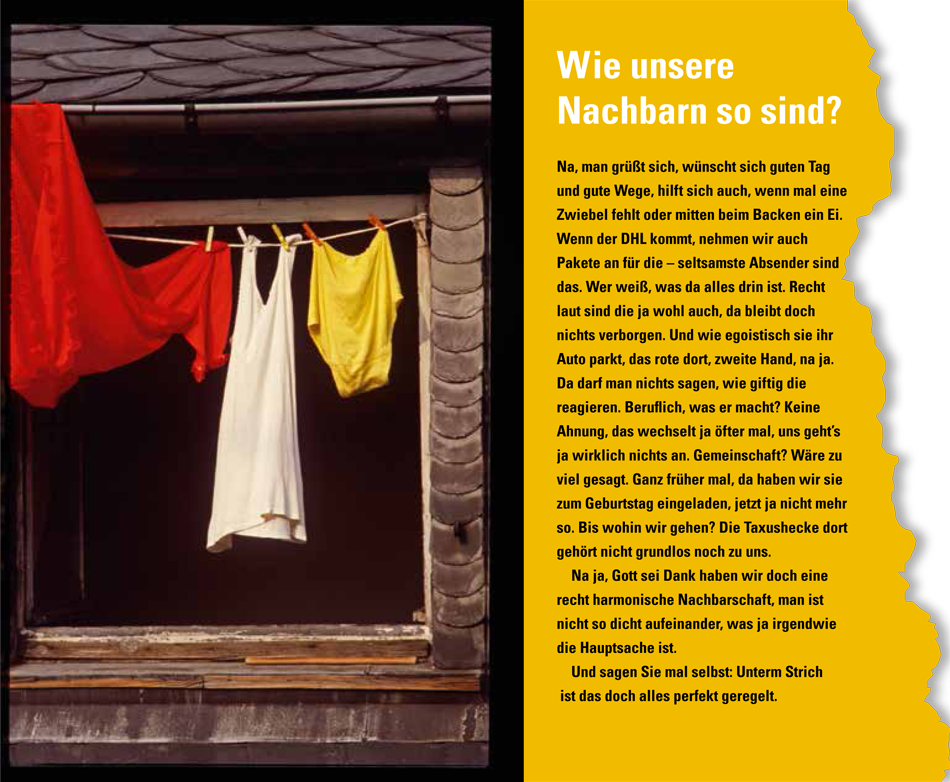Die Begegnung mit dem Nachbarn bleibt nahezu kommunikationsfrei, wenn man nur darauf achtet, dass die Zweige der Birke nicht über die Grenze zu ihm hinüberwachsen. Ist der Nachbar nicht mehr nur der Andere von nebenan und gegenüber, sondern tendenziell längst ein Fremder geworden? Haben Nachbarschaften wirklich ihren sozialen Verpflichtungscharakter weitgehend verloren? Der Kulturanthropologe begibt sich auf Spurensuche.

Zu den Grundthemen der Kulturanthropologie gehört das Verhältnis von Mensch und Raum: Raum gilt als konstitutiv für den Menschen. Er erfüllt – oder soll erfüllen – nicht nur eine Reihe von primären Bedürfnissen der materiellen Existenzsicherung. Ein anderer elementarer Aspekt ist die Kultur des Zusammenlebens von Menschen in einem gegebenen Territorium. Zur Vorstellung von einem »anthropologischen Ort« (Marc Augé) gehören auch lokale Gemeinschaften, nicht denkbar ohne Nachbarn und Nachbarschaften.
Dagegen steht heute das Bild einer individualisierten Gesellschaft mit ihren privaten Selbstbildern und je eigenen Lebenswelten, so scheint aus der lokal gedachten Komplementärfigur Nachbar – angesichts aller Diversität von Lebensläufen und aktuellen Lebensstilen – eine Kontrastfigur zu werden. Ist der Nachbar nicht mehr nur der Andere von nebenan und gegenüber, sondern tendenziell längst ein Fremder geworden?

Fremdsein als zivilisatorische Errungenschaft, wie sie der bekannte amerikanische Soziologe Richard Sennett leidenschaftlich gegen die nachbarschaftliche »Tyrannei der Intimität« verteidigte, kennzeichnet den modernen Modus, Nachbarschaft als Nähe auf Distanz zu leben. Ein Fremder – falls er nicht kommt, um zu gehen – ist ein Einheimischer in spe; er hat zu lernen, was Futur II bedeutet, um dann die Einbürgerung als Initiation durchzustehen.
Um danach weiterhin oftmals als Fremder zu gelten, wofür Physiognomie, Haut und Aussprache sorgen. Aus der alten, eher dörflich-kleinstädtisch geprägten obligatorischen Nachbarschaft als Wechselspiel von Geben und Nehmen ist eine optionale Nachbarschaft – nicht nur in der Stadt – geworden. Sie funktioniert als gegenseitige Hilfe auf der Interessenbasis von Verrechnungseinheiten (tausche Englisch-Nachhilfe gegen Rasenmähen).
Oft folgt auf meine Antwort, worüber ich denn gerade forsche, ein »Nachbarschaft – oh je!«, nicht selten auch der detaillierte Bericht über einen besonders interessanten Nachbarschaftskonflikt. Nachbarschaften haben ihren sozialen Verpflichtungscharakter weitgehend verloren; Teile davon werden der sogenannten kommunalen Daseinsvorsorge übertragen (Beispiel: Feuerwehr); anderes regelt der Mann von der Hamburg- Mannheimer.
Jene »Nähe auf Distanz« scheint zuweilen auch ein Label für den Rückzug in die eigenen vier Wände, ja sogar ins oft zitierte Stammesleben. Distanz als Zeichen zunehmender Fremdheit? Den tendenziellen Verzicht auf das Prinzip Öffentlichkeit, worum eine bürgerliche Gesellschaft seit Jahrhunderten gerungen hat, kompensiert diese mit der Teilnahme an Massenspektakeln à la Public Viewing. Eine nachdenkliche Nachbarschaftlichkeit zeigt sich hingegen bei kollektiven Trauerritualen nach unfassbaren Ereignissen.
Zieht man den thematischen Fokus auf Nachbarschaft als ein territoriales und soziales Prinzip geografisch weiter auf und betrachtet es in anderen räumlichen Dimensionen als dynamischen Prozess – als Kultur –, dann stößt man auf nahezu universale Formen nachbarschaftlichen Handelns. Dem menschlichen »Miteianderzutunhaben « scheint eine seltsame Ko-Assoziationskette eigen: Korrespondenz – Kontakt – Kommunikation – Konkurrenz – Kontrolle – Konflikt – Kompromiss.
Feldforschung mit Studierenden habe ich durchgeführt zur Nachbarschaft von Städten (u. a. Frankfurt – Offenbach, Mainz – Wiesbaden); zur Nachbarschaft Hessens mit seinen sechs Nachbar-Bundesländern; zum Leben an der deutsch-französischen Grenze. Die folgenden Texte beschreiben Beispiele über das Zusammenkommen der zwei Begriffe »fremd« und »Nachbar«. Mit ins Bild gehört die Vorstellung von »Grenze«, die das anhaftende Prinzip des Einerseits – Andererseits augenfällig macht.
[dt_gap height=“15″ /]
Deutschunterricht, Methode Jakob
Das Lehrbuch nach dem »Thalheimer Modell« haben wir beiseite geschoben und machen Unterricht nach der Methode Jakob. Der Deutschkurs mit Jakob geschieht überwiegend auf Englisch, als gemeinsames Referenzial hat sich »The Bible« herausgestellt. Heute geht es um den Zauber der Wortstellung in einem deutschen Satz. Beispiel ist das biblisch klingende »Zwei Jünger gingen nach Emmaus«. Jakob ist verwirrt und entzückt, wenn wir Wörter vertauschen und das den Sinn ändert.
Unkonventionell, dieser Deutschkurs. Jakob ist mir als Nachbar eines Nachbarn anempfohlen. Wir versuchen, unsere je eigene Fremdheit aufzuheben, indem wir Unterschiede suchen und Gemeinsamkeiten finden. Jakob notiert alle neuen Wörter in sein Heft, in deutscher Schreibschrift und in amharischer Schrift. Stets liegt ein Atlas auf dem Tisch. Jakob hat mir seine Geschichte erzählt, sie beginnt mit der Flucht seiner Mutter und fünf Kindern von Äthiopien nach Jemen.
[dt_gap height=“15″ /]
[dt_gap height=“15″ /]
Jakob findet in Aden einen Job als Gärtner bei einer amerikanischen Firma. Zwei Brüder ziehen weiter nach Schweden. Zwei Schwestern bleiben mit der Mutter im kriegszerrütteten Jemen zurück. Jakob selbst geht dann nach Deutschland. Aus der Fremde in die Fremde. Das war vor vier Jahren. Auf der Karte »Europa und nördliches Afrika« zeigt er die Geografie einer Migration. An manchen Punkten bleibt sein Finger stehen.
Warum verließ die Familie ihre Heimat? »Ich bin im falschen Volk«, sagt Jakob, »we are Oromo. Tigray minority are in power, they oppress the Oromo people and the Amhara …« Jakob hält inne. Und jetzt im Passiv: »Unterdrückt werden die Oromo.« – »Ein Oromo«, sage ich irgendwann, »war vor vielen Jahren ein junger Kollege von mir in Frankfurt, ein stiller Typ mit sanfter Stimme, gelächelt hat er gern.
Er war Ethnologe, Äthiopien-Spezialist, hat dann seinen Doktor gemacht. Er hieß Negasso Gidada.« Jakobs große Augen: »He was the president of Ethiopia«, sagt er nach einer Weile. »My Homeland. Negasso, President until the year two thousand and one. And you really know him?« – »Mensch, nicht zu glauben«, sagt er deutsch und schüttelt den Kopf.
[dt_gap height=“15″ /]
Kafkas Nachbar
»Mein Geschäft ruht ganz auf meinen Schultern. Zwei Fräulein mit Schreibmaschinen und Geschäftsbüchern im Vorzimmer, mein Zimmer mit Schreibtisch, Kasse, Beratungstisch, Klubsessel und Telephon, das ist mein ganzer Arbeitsapparat. So einfach zu überblicken, so leicht zu führen. Ich bin ganz jung und die Geschäfte rollen vor mir her. Ich klage nicht, ich klage nicht.« So beginnt Kafkas Geschichte Der Nachbar und sie führt – erwartungsgemäß – in lähmende Ratlosigkeit und ins Unheil.
Denn: »Seit Neujahr hat ein junger Mann die kleine, leerstehende Nebenwohnung, die ich ungeschickterweise so lange zu mieten gezögert habe, frischweg gemietet.« Harras heißt dieser junge Mann, und da bei Kafka jedes Wort ein Signal ist, kündet bereits der Name Böses – Beunruhigung und Drangsal – an. Bereits das doppelte »Ich klage nicht« dürfte den Leser gewarnt haben. Was dieser Harras »eigentlich macht«, weiß niemand.

Also zieht der Ich-Erzähler Erkundigungen ein, die Auskünfte sind vage: Nun ja, der Nachbar betreibe ein Geschäft ähnlich dem eigenen. Er sei vermögenslos zwar, doch ein aufstrebender junger Mann mit Zukunft. »Manchmal treffe ich Harras auf der Treppe, er muß es immer außerordentlich eilig haben, er huscht förmlich an mir vorüber. Genau gesehen habe ich ihn noch gar nicht, den Büroschlüssel hat er schon vorbereitet in der Hand.
Im Augenblick hat er die Tür geöffnet. Wie der Schwanz einer Ratte ist er hineingeglitten …« Die »elend dünnen Wände«, beide Nachbarn trennend, verbinden sie indes auch und halten sie wiederum moralisch auseinander: Sie »verraten« den ehrlich Tätigen und »decken« den faulen Unehrlichen, der auf der Lauer liegt und die Telefongespräche des ehrbaren, zunehmend verzweifelnden Kaufmanns durch die Wand mitbekommt, sie quasi abschöpft und, noch ehe dieser den Apparat aufgehängt hat, durch die Stadt huscht, »vielleicht schon daran, mir entgegenzuarbeiten«.
Eine schnell erzählte Geschichte, die es – kafkatypisch – in sich hat. Was wäre gewesen, wenn einer in dieser Story einen ersten Schritt getan, sich dem anderen – Guten Tag, ich bin Ihr Nachbar – bekannt gemacht oder wenn, beispielsweise, der Mann vom Lande (in Vor dem Gesetz) zeitlebens eine Frage an den Türhüter gerichtet hätte? Die Geschichten hätten nicht erzählt werden müssen. Zwei junge Kaufleute Wand an Wand.
Vom drastisch asymmetrisch geschilderten Kontaktverhalten aus ist rasch auf ein Konkurrenzverhältnis zu schließen. Dem ökonomischen Wettbewerb um dieselbe Kundschaft liegt indes etwas Elementares zugrunde: die Verfügbarkeit des Raums. Dass der Raum – auch mit Aussicht auf Ausweitung des Geschäfts – die Basis der Existenzchancen ist, wird überdeckt von der Schilderung einer Pseudorealität, die ja nichts anderes ist als eine ins Groteske treibende Phantasmagorie, eine Darstellung von Trugbildern.
Die dünne Wand trennt die benachbarten Sphären zwar baulich, die Telefongespräche auf der einen dringen – keineswegs für sie gedacht – zur anderen Seite durch, die stumm bleibt und ein Geheimnis wie ihr Inhaber. Was zunächst als nachbarschaftliche Kommunikationsstörung erscheint, führt für den einen zu einem ausweglosen Dilemma; nur noch die Angst rollt vor ihm her.
Die soziale Figur des Gegenübers wird animalisiert (huschende Ratte), der sich nicht selbst erklärende Kontrahent existiert weitgehend als Angstprojektion. Ihn »genau« sehen? Ihm eine Frage stellen? Fremd bleibt er der bessere Feind. (Zitate aus: Franz Kafka, Der Nachbar. In: Die Erzählungen, Frankfurt, Verlag S. Fischer, 1961, S. 293 f.)
[dt_gap height=“15″ /]
Da drüben ziehen gerade Flüchtlinge ein
»Wir kamen nach Hause und sahen, da tut sich was da drüben. Aha, da ziehen Flüchtlinge ein. Wir sind neugierig, gehen da hin. Es ist uns wichtig, uns vorzustellen, zu sagen, wer wir sind und wo wir wohnen. Das war im Dezember 2015, nach dem Welcome-Sommer. Ein Kleinbus wurde gerade ausgeladen, jede Menge Koffer, Plastiktüten. Die fremde Frau kam zum Zaun mit fragendem Blick. Guten Tag, sagte ich, ich bin Tanja, das ist Robin, wir heißen H. und wohnen da drüben.« Das war, erzählt Tanja H., ein Jahr später im Interview, der Beginn einer »aktiven, geglückten Nachbarschaft«: freundlich, gelöst, ja fröhlich.
Natürlich von Spannung begleitet: Was sind das für Menschen? Welche Geschichte bringen sie mit? Können wir uns überhaupt verständigen? Sie deutsch zu begrüßen, war eine Probe, ob es da schon Sprachkenntnisse gibt. Wenn nicht, dann helfen Gesten oder Englisch oder das Handy mit der Google-Übersetzung. Und so war in der ersten Zeit beim Teeoder Kaffeetrinken immer das Handy dabei. Saba, Ahmed und die zwei Kinder, die ganze afghanische Familie lernte sehr schnell Deutsch, gerade durch diesen Kontakt.

»Wenn ich nach Hause komme und sehe, da drüben ist jemand draußen, dass man da aufeinander zuläuft und am Gartenzaun redet miteinander, dann wird man sofort reingebeten zum Tee, ganz ohne Verabredung; Termine mögen sie gar nicht. Ja, und so wird im Plausch umgesetzt, was sie im Deutschkurs lernen. Ich kann noch kein Wort Afghanisch.« Wir sind in einer Siedlung aus den 1960er Jahren am Ortsrand der Gemeinde D., irgendwo im Rhein-Main-Gebiet.
Tanja H., 40 Jahre alt, ist freischaffende Baustatikerin. Sie erzählt von ihrer übrigen Nachbarschaft mit »solchen und solchen« Nachbarn, von den kontaktfreudigen und den verschlossenen, den »Anti-Nachbarn«. Nein, eine Stimmung gegen Migranten gibt es in D. nicht. Das öffentliche Klima ist pro Flüchtlinge, viele Helfer hat die örtliche Initiative. Integration passiert lokal. Mit »ihren« Flüchtlingen hat Familie H. mehr als vertrauten Umgang.
Es geht um vertrauliche Dinge, wenn Tanja H. wieder einmal Arztbriefe erklärt, Kontoauszüge checkt oder den Behördendschungel bis »rauf zum Ministerium« durchquert, um Falsches im Asylantrag zu korrigieren. »Ich bin regelrecht entsetzt, was an offizieller Post bei unseren Nachbarn so reinflattert, in einem Deutsch, das so schwer verständlich ist. Ich muss dann immer die Flüchtlinge beruhigen: Auch ich muss diesen Satz fünfmal durchlesen, ihn mir regelrecht erst einmal übersetzen. Oder mit einer Behörde telefonieren. Und Saba oder Ahmed steht dann irritiert daneben und, merkwürdig, ich komme mir dann plötzlich so fremd vor.«
Als Patin von Flüchtlingen macht sie sich deren Nöte zu eigen, beispielsweise in »Telefonmarathons « mit Behörden. Wer ist sie selbst bei solch einem Fight? Jeder Fall hat einen eigenen Grad von Identifikation mit dem Fremden. Zutrauen ist ein anderes Wort in meinem Interview mit Tanja H. Den Flüchtlingen zu helfen, sei eine Selbstverständlichkeit. Doch hätschelndes Overprotecting hält sie für falsch. Die afghanischen Nachbarn sollten nicht das Gefühl haben, dass sie immer die Bedürftigen sind, sondern auch, dass sie etwas geben können.
So fragt Tanja H.: »Was könnt ihr gut, was macht ihr gern? Saba, zum Beispiel, hat eine Nähmaschine, kann mir mal eine Hose umnähen.« Wichtig sei reziproke Hilfe und dass man den Flüchtlingen Anerkennung gibt für das, was sie können, denn »sie wollen auch geben, wollen sich revanchieren«. Alltagssachen. So tauschen die Frauen Gewürze oder Rezepte aus, man backt gemeinsam und macht beim »deutschen« Kochen und Essen mit den Afghanen geschickt einen Bogen um Schweinefleisch.

Weit weg von D. leben die Verwandten der H.s, es gibt keine Oma nebenan, keine Schwester gegenüber. »Vielleicht sind mein Mann und ich deshalb so offen und neugierig auf Nachbarn. Ja, vielleicht sind Nachbarn ein Ersatz für Verwandtschaft.« Doch was ist »fremd«? Was erstaunt immer noch und immer wieder? »Ich sage mal ein Beispiel: Wir bieten Hilfe an, falls was ist, dann kommt doch rüber. Und dann kommen sie nicht. Man denkt: alles o.k. …. Erst wenn ich zu ihnen komme, heißt das für sie offenbar: Jetzt hab ich Zeit, jetzt stören sie nicht.
Im Grund werden Hilfsangebote nicht wörtlich genommen. Das ›Komm zu mir, wenn du etwas willst‹ – das machen sie nicht. Was steckt da kulturell dahinter?« Brauchen die Flüchtlinge die Sicherheit ihres eigenen vertrauten Raums, auch ihres Zeit- Raums? Und möchten sie nicht einbrechen in die Zeitordnung der anderen? Bekommen die Flüchtlingsfamilien Besuch von gegenüber, dann bedeutet das: Aha, die Nachbarn haben sich Zeit genommen in ihrem üblichen, von Tempo, Pünktlichkeit und Nutzwert bestimmten deutschen Zeitreglement.
Spätestens in der Bürokratiefalle namens Asylverfahren lernt, wer sie nicht bereits mitgebracht hat: Geduld. Von Flüchtlingen in punkto Zeit etwas lernen, sagt Tanja H., heißt Entschleunigung lernen. Diese »geglückte« Nachbarschaft ist für Tanja H. auch Ergebnis gegenseitiger Anpassung. Sie nennt Beispiele: »Ich lerne täglich dazu. Sie haben eine andere Vorstellung von Arbeit. Ständig kommen hier kleine Gebäcke an, zu meiner ›Stärkung‹.
 Ich habe gerade beruflich viel zu tun, das weiß Saba. Die afghanische Frau aber meint, ich habe im Haushalt viel zu tun. Arbeit für sie ist Haushalt, körperliche Betätigung, nicht immer leicht. Bis sie begriffen hat, meine Arbeit ist am Schreibtisch. Das leuchtet ihr nicht so ganz ein. Was ist das – Arbeit am Schreibtisch, am Computer? Schwer zu beschreiben. Ich versuch’s.«
Ich habe gerade beruflich viel zu tun, das weiß Saba. Die afghanische Frau aber meint, ich habe im Haushalt viel zu tun. Arbeit für sie ist Haushalt, körperliche Betätigung, nicht immer leicht. Bis sie begriffen hat, meine Arbeit ist am Schreibtisch. Das leuchtet ihr nicht so ganz ein. Was ist das – Arbeit am Schreibtisch, am Computer? Schwer zu beschreiben. Ich versuch’s.«
Tanja und Robin H. machen Fotobücher über ihre weltweiten Reisen. Saba und Ahmed sind kaum interessiert an schönen Fotos; sie wollen wissen, wer da besucht wurde. »Wenn sie über unser Leben etwas erfahren wollen, dann im Grunde über unsere Verwandtschaft, Storys aus dem Familienleben. Das ist für sie wichtig.«
Ein wesentliches Thema heißt Bleiben oder Gehen: »Ja, wir reden da öfter drüber, viele sind ja hierher geflohen, nicht – wie das oft behauptet wird –, um sich hier in eine Hängematte zu legen. Sondern sie möchten in Ruhe und Frieden leben. Das ist in ihren Heimatländern nicht möglich. Aber sie möchten doch lieber in Ruhe und Frieden in ihren Heimatländern sein. Dort haben sie die Landschaft, die ihre Augen kennen, die Gerüche, die ihre Nasen kennen. Das ist ihnen schon lieber, als in der Fremde wieder heimisch zu werden.«
[dt_gap height=“15″ /]
Anno 1740: Der aufgeklärte Nachbar
Einen ganz anderen Blick auf das Thema Nachbarschaft eröffnet Johann Heinrich Zedlers nahezu als normativ geltendes Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste. Zedler war kein Gelehrter, sondern ein risikofreudiger Verleger, der die Wissbegierde seiner Zeit – der Epoche der Aufklärung – bediente. Das Lexikon erschien von 1732 bis 1750 in 68 dicken Foliobänden mit insgesamt 67 000 Seiten.
Weltruhm und intellektuellen Glanz der französischen Encyclopédie (22 Bände von 1751 bis 1777) von Montesquieu, Rousseau und Voltaire erreichte »der Zedler« allerdings nie. Der ausführliche Artikel im »Zedler« beginnt so: »Nachbarn, Nachbauer, Lat. Vicinus und Accola, Franz. Voisin, nennen einander nicht nur diejenigen so nahe bey einander wohnen, sondern auch deren Aecker, Wiesen, Holtzungen, Weinberge und andere Grund-Stücken, auch gantze Güter und Herrschafften zusammen gräntzen.«
Territoriale Nähe und gemeinsame Grenze sind demnach konstitutiv für die Definition von Nachbarschaft. Es folgen zahlreiche gute Ratschläge; vorab wichtig sei, dass ein Fremder, der ein Haus »an sich kauffen will«, nach den künftigen Nachbarn sich erkundige. Deute dies auf »zänckische, haderhafftige, mißgünstige, leichtfertige, untreue, diebische, oder sonst lose Leute«, dann soll er »das Kauffen lieber gar unterlassen, weil er sonst keine Ruhe haben, und was er erworben, mit ihnen würde wiederum verrechten und verfechten müsse«.
Im Duktus der Aufklärung belegt »der Zedler « solche Ratschläge mit klassischen Autoren und dem Weisheitsvorrat der Welt: Ein jüdisches Sprichwort etwa besagt: Gott selbst lasse den, »welchem er feind sey, an den bösen Nachbar gerathen«. Eine spanische Redensart lautet: »Gegen einen guten Nachbar verheyrathe deine Tochter, und verkauffe deinen Wein.« Die Deutschen wiederum wissen über territoriale Konditionen: »Eine Heer-Strasse, ein Strom und ein grosser Herr sind böse Nachbarn, denn sie greifen ein, und es ist schwer ihnen zu wehren. … Weit von Herren und nahe bey Freunden wohnen, ist das beste.«
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“plain“ line=“false“ style=“1″ animation=“none“]
Ein DFG-Projekt ermöglicht heute den Blick in das enzyklopädische Wissen des 18. Jahrhunderts auch an einem scheinbar so unscheinbaren Beispiel via www.zedler-lexikon.de > Suchbegriffe: Nachbar, Nachbarrecht > Band 23
[/dt_call_to_action]
Und für die die Reziprozität des Zusammenlebens gilt: »Es ist keiner so reich in seiner Haushaltung, er bedarf seines Nachbarn. … Nachbarn muß man heben und leben. … Ein Nachbar ist dem anderen einen Brand schuldig.« Generell unterscheidet »der Zedler« – als eine quasi das geltende Wissen der Zeit darbietende Instanz – zwei Kategorien von Nachbarn: »Böse Nachbarn – sind welche, die andere[n gegenüber] sich liebloß erweisen, ihnen allen Verdruß verursachen, ihnen, wo sie können, Schaden zufügen und sich freuen, wenn es ihnen übel gehet.
 Gute Nachbarn sind welche, die den andern alle Liebe und Freundschaft erweisen, ihnen in Nöthen beispringen und mitleidend Theil an ihrer Noth und Leiden nehmen, deren Bestes mit suchen, und wenn es ihnen wohlgehet, ihre hertzliche und aufrichtige Freude darüber bezeugen.« »Der Zedler « empfiehlt durchaus auch vorausschauendes Nachbarschaftsverhalten:
Gute Nachbarn sind welche, die den andern alle Liebe und Freundschaft erweisen, ihnen in Nöthen beispringen und mitleidend Theil an ihrer Noth und Leiden nehmen, deren Bestes mit suchen, und wenn es ihnen wohlgehet, ihre hertzliche und aufrichtige Freude darüber bezeugen.« »Der Zedler « empfiehlt durchaus auch vorausschauendes Nachbarschaftsverhalten:
»Dahero soll ein Haus-Vater dem Neid und Feindtschafft zu entgehen…., zu erst und vor allen Dingen sorgfältig verhüten, daß weder von ihm selbst noch von seinen… Hausgenossen der Nachbarschaft sich über ihn zu beschweren…, die geringste Ursache nicht gegeben wäre: Vielmehr soll er seinen Nachbarn mit leutseeligen und sittsamen Gebehrden, freundlichen und behutsamen Worten und Wercken höflich begegnen; hingegen aber alle Großsprecherei, Pralerey und eiteln Selbst-Ruhm ferne von ihm seyn lassen.«