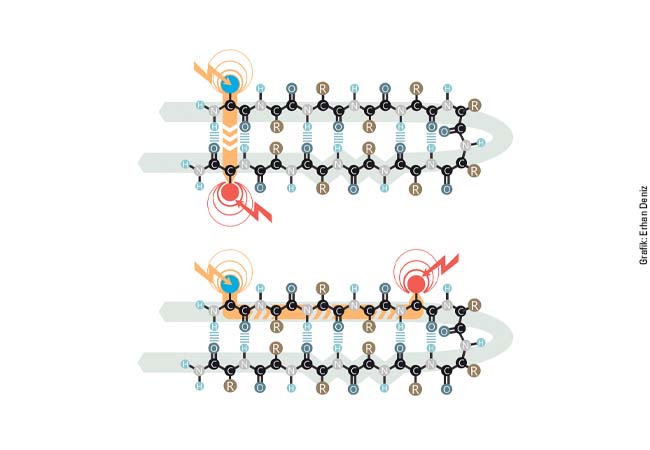Der Zeithistoriker Lutz Raphael sprach in seinen Frankfurter Adorno-Vorlesungen über die Gesellschaftsgeschichte der Deindustrialisierung.
Der Zeithistoriker Lutz Raphael sprach in seinen Frankfurter Adorno-Vorlesungen über die Gesellschaftsgeschichte der Deindustrialisierung.
Noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts stellte der Industriearbeiter in den meisten Ländern Westeuropas die größte Berufsgruppe dar, heute liege sein Anteil bei gerade noch zwischen 18 und 25 Prozent, wie Prof. Lutz Raphael einleitend in seinem ersten Vortrag feststellte. Der Industriearbeiter sei in dem Prozess der Deindustrialisierung an den gesellschaftlichen Rand gedrängt, seiner Zukunft beraubt worden; er habe geschichtlich betrachtet damit ein ähnliches Schicksal erlitten wie der Handwerker.
Der im Ruhrgebiet geborene und heute an der Universität Trier lehrende Historiker führte weiter aus, dass der Rückgang der Industrie, der einen Verlust an Arbeitsplätzen und ein Schrumpfen an industriell geprägten geografischen Räumen bedeute, auf einem Anpassungsdruck beruhe: einmal durch den binneneuropäischen Raum, aber vorallem durch die asiatische Konkurrenz.
Dieser tiefgreifende Strukturwandel habe erstmals seit dem 18. Jahrhundert eine Verschiebung der Wachstumsraten von Europa nach Asien nach sich gezogen. Die „Industriebürgerschaft“ sei ab den 1970er Jahren unter Legitimationsdruck geraten, gerade von neoliberalen Kräften. EDV-basierte Datenverarbeitung und Kommunikation seien Kennzeichen der die Gesellschaft fortan prägenden Dienstleistungsgesellschaft.
Der sich formierende „Finanzmarktkapitalismus“, so Raphael, bedeute eine zunehmende externe Kontrolle der Unternehmen. Ein weiteres Phänomen der Deindustrialisierung sei die „Musealisierung“ ganzer Landstriche – für Raphael eine „Selbsthistorisierung der Industriegesellschaft“.
Marktradikalisierung und sozial-liberale Ansätze
In Großbritannien sei der Zusammenbruch traditionsreicher Industrien als Schock erlebt worden; in Deutschland sei die Deindustrialisierung hingegen nicht so extrem verlaufen. Zudem habe ab 1979 die Regierung unter Maggie Thatcher die sogenannte „britische Krankheit“ mit marktradikalen Mitteln zu bekämpfen versucht, während die Kohl-Regierung einen gemäßigteren Weg sozial-liberaler Reformen beschritten habe.
Auch die Privatisierung des Wohnungsmarktes habe zur Entstehung von städtischen Problemzonen geführt. Soziale Konflikte, wie sie in den französischen Banlieues und in einigen britischen Städten verstärkt seit den 1980er Jahren zu beobachten sind, seien dann aber anders erklärt worden, beispielsweise als Rassenkonflikte oder Beispiele von jugendlicher Delinquenz.
[dt_call_to_action content_size=”normal” background=”fancy” line=”false” style=”1″ animation=”fadeIn”]
Die Frankfurter Adorno-Vorlesungen
Seit 2002 veranstaltet das Institut für Sozialforschung in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag jährlich Vorlesungen, die an drei Abenden an Theodor W. Adorno erinnern sollen. Dabei geht es nicht um eine philologische Ausdeutung seines Werks, sondern darum, seinen Einfluss auf die heutige Theoriebildung in den Humanwissenschaften zu fördern und die lebendigen Spuren seines interdisziplinären Wirkens in den fortgeschrittenen Strömungen der Philosophie, der Literatur-, Kunst- und Sozialwissenschaften sichtbar zu machen. 2019 wird anlässlich Adornos 50. Todestag sein Schaffen selber im Fokus der Vorlesungen stehen, sprechen wird der Geistesgeschichtler Prof. Peter Gordon (Harvard).
[/dt_call_to_action]
Tatsache sei aber, so Raphael, dass Industriearbeiter nach den letzten großen Konflikten Mitte der 80er Jahre sich aus der politischen Partizipation zurückgezogen hätten. Zwar sei beispielsweise im legendären Bergarbeiterstreik in Großbritannien nochmal viel Protest mobilisiert worden; jedoch sei nach dem Scheitern auch jegliches Vertrauen in das Regierungshandeln verloren gegangen.
Der Spruch vom „Klassenkampf ohne Klassen“ habe dann die Runde gemacht, ein unpolitischer Hass gegen „die da oben“ sei entstanden. In Deutschland hätten es die Gewerkschaften aber vermocht, den Kampf um die Einführung der 35-Stunden-Woche als eine Machtprobe mit der Regierung zu gestalten. Aber der Ausgang des Konflikts sei auch für die Unternehmen ein Erfolg gewesen, hätte sich daraus eine fortan mögliche Flexibilisierung der Arbeitszeit ergeben.
Soziale Resilienz
Jedoch habe es bestimmte soziale „Beharrungskräfte“ gegeben, die sich dem neuen Kapitalismus entgegengestellt hätten, wenn auch in unterschiedlicher Prägung in den drei von ihm behandelten Ländern Großbritannien, Frankreich und Deutschland. So wies Raphael darauf hin, dass es ein großes Risiko für Regierungen darstelle, soziale Netze abzubauen.
So seien beispielsweise Kündigungsschutz, Mindestlöhne oder Arbeitslosengeld soziale Errungenschaften, die den Industriearbeiter überhaupt erst zu einem „Industriebürger“ gemacht hätten. Auch wenn im industriellen Sektor viele Arbeitsplätze verloren gegangen seien, der Einfluss von Gewerkschaften geschwunden sei und die private Altersvorsorge allmählich Priorität vor der staatlichen Absicherung erhalte, habe es im Bereich des Arbeitsrechts keine vergleichbare Aushöhlung gegeben.
In Deutschland könnte man im Unterschied zur Situation in Großbritannien im großen Maße von einer „einvernehmlichen Konfliktpartnerschaft“ zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den Betrieben sprechen, was allerdings auch einhergehe mit einer als notwendig erachteten kontinuierlichen Produktivitätssteigerung.
Der politische Bedeutungsverlust der Industriearbeiterschaft trage, so Raphaels Zwischenfazit am Ende der ersten Vorlesung, mit zur augenblicklichen Demokratiekrise bei; allerdings zeigten die Diskussion über Hartz IV und die von vielen Politikern geteilte Forderung, Teile der Arbeitsmarktreform wieder rückgängig zu machen, doch auch die „Prägekraft“ der sozialen Konflikte seit den 1970er Jahren.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 4.18 des UniReport erschienen. PDF-Download »