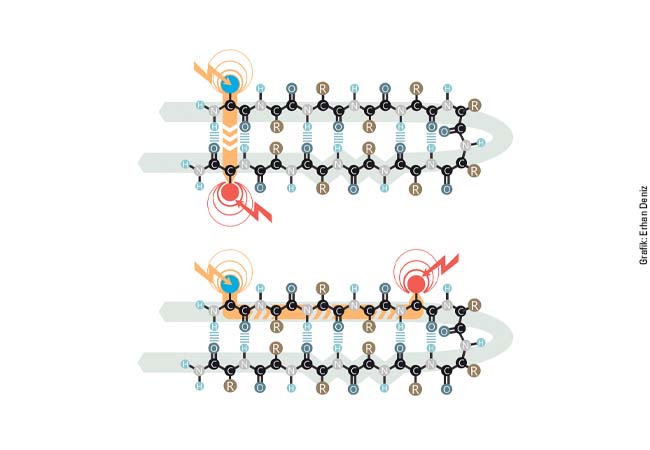Die Gremienwahlen im Kontext formeller und informeller Mitspracheformen.
von Michael Dobbins
Die Hochschulsysteme Europas befinden sich seit geraumer Zeit in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess. Als Schlüsselakteure in der globalisierten Wissensgesellschaft werden Hochschulen zunehmend als treibende Faktoren für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Staaten betrachtet. Vor dem Hintergrund des Bologna- Prozesses und der Verbreitung neuer Management- orientierter Steuerungsmuster sehen sich Universitäten und Hochschulen im Allgemeinen zunehmend mit unterschiedlichen Ansätzen zur Optimierung pädagogischer und administrativer Prozesse konfrontiert.
Trotz starkem Veränderungsdruck stellen Universitäten allerdings auch nach wie vor historische Institutionen dar, die in nationalen regulativen Regimes eingebettet sind und nationale historische Erfahrungen widerspiegeln. Spätestens seit Wilhelm von Humboldts Reformen des preußischen Bildungssystems Anfang des 19. Jahrhunderts lag das deutsche Universitätswesen sehr nahe am „ Modell der akademischen Selbstverwaltung“. Basierend auf den Grundprinzipien Einsamkeit und Freiheit sollte die Wissenschaft zum Selbstzweck werden, frei von jeglichen externen Einflüssen und Betrachtungen ihres politischen, ökonomischen und sozialen Nutzens.
Damit stellten die (nahezu alle männlichen) Lehrstuhlinhaber historisch die zentralen Entscheidungseinheiten der deutschen Universitäten dar, deren kollektive Macht in starken akademischen Senaten konsolidiert wurde. Auch nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland konnte die Professorenschaft die internen Angelegenheiten der Universität eindeutig dominieren. Im Einklang mit der Auffassung, dass akademische Berufe nicht effektiv von Märkten oder Verwaltungen gesteuert werden können, kehrten deutsche Universitäten nach dem Krieg zu einem System zurück, welches – zumindest auf interner universitärer Ebene – durch die „Präferenz-Aggregation“ der Lehrstuhlinhaberinnen und -inhaber gekennzeichnet war.
Dennoch erhielten die Bundesländer umfangreiche Regulierungskompetenzen, vor allem im Finanz- und Personalbereich, welche allerdings durch eine Vielzahl neuer Institutionen zur Sicherung des Einflusses der „akademischen Oligarchie“ (z. B. Hochschulrektorenkonferenz, Deutscher Hochschulverband, Wissenschaftsrat) relativiert wurden. Demokratisierung In den 1960er und 1970er Jahren kam es zu einigen Reformen, die darauf abzielten, die interne Steuerung von Universitäten zu „ demokratisieren“ und die Macht der Professorenschaft aufzuweichen.
Die Bildungsexpansion sowie die studentischen Proteste der späten 1960er Jahre gegen die vermeintliche Verschlechterung der Lehre und der Unterstützungsleistungen sowie das als autoritär empfundene Universitätsleben riefen das Konzept der „Gruppenuniversität“ ins Leben. Dabei wurde versucht, die Beteiligung eines breiteren Akteurspektrums an der universitären Selbstverwaltung zu ermöglichen. Zur Förderung moderner und gerechter Entscheidungsprozesse wurden Studierende, (Post-)Doktoranden sowie technisches und administratives Personal zunehmend in universitäre Entscheidungsprozesse eingebunden. Somit wurden bestehende Vorläuferinstitutionen der Studierendenvertretungen ausgebaut und neue Entscheidungsorgane zwecks Demokratisierung der Universität eingeführt. So entstanden neben den bereits historisch mächtigen akademischen Senaten spätestens in den 60er Jahren und zumindest an den meisten großen Universitäten Studierendenparlamente und weitere Vertretungsorgane studierender Interessen.
Diese wurden jedoch häufig zum Spielball politischer Auseinandersetzungen zwischen linken und bürgerlich- konservativen Gruppen, was wiederum deren Glaubwürdigkeit und Einfluss schmälerte. Dennoch gelang es den Studierenden im Rahmen der Hochschulgesetzgebung der Bundesländer ihre Vertretung in allen wichtigen universitären Entscheidungsgremien zu sichern, so dass die Präsenz von studentischen Vertretern in akademischen Senaten, den Fachbereichsräten und anderen Ausschüssen auf Fachbereichsebene kaum wegzudenken ist. Allerdings verringerte diese im Sinne der Demokratisierung vorangetriebene Vergrößerung universitärer Entscheidungsstrukturen und Einbeziehung eines größeren Interessenspektrums die ohnehin schwache kollektive Handlungsfähigkeit deutscher Universitäten und führte zu einer noch komplexeren Verschachtelung von Entscheidungskompetenzen.
An vielen Universitäten versuchte man infolgedessen die Gremienarbeit durch die Einrichtung weiterer Kommissionen, Beiräte und Gremien zu entlasten, was die Leistungs-, Reaktions- und Anpassungsfähigkeit von Universitäten als Gesamtorganisationen weiter beeinträchtigte. Somit verstärkte die breitere Interessenvertretung trotz neuer formeller und informeller Einflusskanäle für Studierende in vielen Fällen jedoch letztendlich das historische Modell der akademischen Selbstverwaltung. Angesichts massiv steigender Studierendenzahlen und andauernder Unzufriedenheit mit der administrativen Handlungsfähigkeit der Universitäten sowie mit der universitären Lehre versuchte der Bund in den 1970er ein Stück weit die Kontrolle über die Hochschulpolitik der Bundesländer zurückzuerlangen. Infolge des Hochschulrahmengesetzes (HRG) von 1976 erhielt der Bund neue Kompetenzen hinsichtlich der Zulassung von Studierenden und bei Durchführung von Studienprogrammen wie auch der Ausgestaltung interner Verwaltungsstrukturen.
Allerdings wurde an der Grundstruktur der akademischen Selbstverwaltung und den seit den 1960er Jahren immer stärker institutionalisierten Prinzipien der Mitbestimmung nicht gerüttelt. Im Gegensatz zu anderen nord- und westeuropäischen Staaten wie beispielsweise Großbritannien und den Niederlanden, in denen die Hochschulleitung und der/die Rektor(in) bzw. Universitätspräsident( in) in ihren unternehmerischen Handlungskapazitäten gestärkt wurden, hielten die deutschen Universitäten weitgehend am Modell der akademischen Selbstverwaltung fest, in der es an einer proaktiven zentralen Steuerungseinheit fehlte.
Mit anderen Worten blieben die von der Professorenschaft dominierten akademischen Senate die zentralen Beschlussfassungsorgane für alle Angelegenheiten der Lehre und Forschung, der Organisation des Lehr- und Studienbetriebs, der universitären Entwicklungsplanung sowie die Wahl des / der Rektor( in) bzw. Universitätspräsident(in), während die aus einmal jährlich gewählten Vertretern bestehenden Fachbereichsräte über weitgehende Selbstverwaltungskompetenzen hinsichtlich Forschung, Lehre und Personal auf dezentraler Ebene verfügten. Universitäten als „Unternehmen“?
In den späten 1980ern und 1990ern wurden jedoch Rufe laut, das Humboldt’sche Erbe mit dem „Markt“ zu balancieren, und erste Versuche, Steuerungsinstrumente aus dem New Public Management zu implementieren, wurden in einigen Bundesländern Staaten initiiert. Beispielsweise wurden 1997 die ersten Zielvereinbarungen zwischen Universitäten und Bundesländern getroffen. Diese leistungsorientierten Vereinbarungen, welche gemeinsam festgelegte Ziele wie z. B. Ausbau der Qualitätssicherung, bessere Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Erhöhung des Anteils an Forscherinnen und Professorinnen beinhalten, haben sowohl das Universitätsmanagement (d. h. das Rektorat oder Präsidium) als auch die Dekaninnen und Dekane der Fakultäten gestärkt, welche nunmehr mit der Implementierung der Vereinbarungen betraut sind.
Darüber hinaus wurden neue Hochschulräte (in manchen Bundesländern „Universitätsräte“) als Pendants zu den bestehenden Universitätssenaten gegründet, um die Einbeziehung externer Akteure aus der Wirtschaft und der jeweiligen Region in strategische universitäre Entscheidungen zu ermöglichen. Aus den obigen Überlegungen geht hervor, dass die moderne deutsche Hochschulpolitik durch das „Hinzufügen“ von neuen Institutionen und Einflusskanälen in bestehende, eher dezentrale und „akademikerlastige“ Strukturen geprägt ist.
Diese Strategie, die in der politikwissenschaftlichen Literatur als „layering“ bezeichnet wird, lässt sich in den letzten Jahren besonders deutlich am Ausbau der internen und externen Qualitätssicherung im Hochschulwesen beobachten. Im Jahre 1998 wurde der sogenannte Akkreditierungsrat etabliert, um minimale Standards und die Arbeitsmarktrelevanz von Studienprogrammen sichern. Allerdings führt der zentrale Rat keine eigenen Akkreditierungen durch, sondern bevollmächtigt zahlreiche dezentralisierte Akkreditierungsagenturen, disziplinspezifische Evaluationen von Studienprogrammen durchzuführen.
Auf Drängen der Bundesländer entstanden zeitgleich im Rahmen der Zielvereinbarungen auch neue interne Organe der Qualitätssicherung, welche der Studierendenschaft neue Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten gewähren. Zudem entstanden an den einzelnen Universitäten diverse neue Qualitätssicherungsgremien und -kommissionen. Insofern werden ähnlich wie in den 1960er und 1970er Jahren erneut immer mehr Institutionen und Mitbestimmungsorgane in das bestehende institutionelle Gefüge eingefügt. Vor diesem Hintergrund kann man von einer „Heterarchisierung“ der deutschen Hochschulpolitik sprechen, in der es – trotz Vorrangstellung der akademischen Gemeinschaft – neue Einflusszentren und -kanäle für gesellschaftliche, ökonomische und studentische Impulse zum koordinierten Vorantreiben von Veränderungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der historisch tradierten Grundstruktur des Universitätswesen gibt.
Dies hat den Vorteil, dass die Hochschulmodernisierung zunehmend als kollektive Angelegenheit und Herausforderung betrachtet wird und die Prozessoptimierung zunehmend im Mittelpunkt steht. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Hochschulpolitik in eine Phase der Überkomplexität gerät, in der die Konsensfindung durch die zunehmende Heterogenität an Akteuren und Institutionen massiv erschwert wird. Trotz aller Komplexität sind die deutschen Universitäten des 21. Jahrhunderts offener denn je zuvor und bieten allen beteiligten Akteuren noch nie zu vor dagewesene Mitwirkungs- und Einflussmöglichkeiten. Dies gilt insbesondere für die urbane, weltoffene und zukunftsorientierte Goethe-Universität. Ergreifen Sie also die Chance, die Zukunft dieser einzigartigen Universität mitzugestalten und gehen Sie wählen!
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“plain“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]
Über den Autor: Michael Dobbins, Juniorprofessor für Politikfeldanalyse mit dem Schwerpunkt Bildungspolitik an der Goethe-Universität.
[/dt_call_to_action]
[dt_call_to_action content_size=“normal“ background=“plain“ line=“false“ style=“1″ animation=“fadeIn“] 
Zum Weiterlesen:
Wahlaufruf von Universitätspräsidentin Prof. Birgitta Wolff »
UniReport „Wahl Spezial“ (PDF)
[/dt_call_to_action]